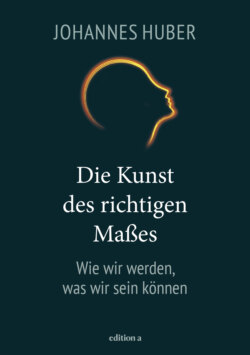Читать книгу Die Kunst des richtigen Maßes - Johannes Huber - Страница 28
Ein Kardinal als Vermittler zwischen den Welten
ОглавлениеIndem geistige Führer die Gesetze der Baumeister sakraler Gebäude für die Seele und die Gesinnung des Menschen adaptierten, wurde das richtige Maß zu einem Thema für ganz Europa. Die freimaurerische Botschaft davon scheint besonders tiefe menschliche Wahrheiten zu berühren, denn sie hinterließ inzwischen über Jahrhunderte hinweg in vielen Ländern ihre Spuren.
Als der einstige amerikanische Präsident George Washington den Grundstein für das Weiße Haus legte, trug er das Winkelmaß um den Hals. Washington war Freimaurer, ebenso wie Benjamin Franklin, der als Drucker, Verleger, Schriftsteller, Naturwissenschaftler, Erfinder und Staatsmann einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten war und die amerikanische Unabhängigkeitserklärung mitverfasste und unterschrieb.
Der Mann, der in Deutschland die Freiheit des Menschen zum großen philosophischen Thema machte, Immanuel Kant, war selbst kein Freimaurer, aber seine engsten Freunde und Wegbegleiter waren es, sein Verleger Johann Jakob Kanter etwa, sein Testamentsvollstrecker Pfarrer Wasianski oder die Gelehrten Theodor Gottlieb von Hippel und Johann Gottfried Frey.
Gehen wir in der Geschichte rund hundert Jahre weiter nach vorne, finden wir weitere interessante Spuren freimaurerischen Wirkens. Im frühen 20. Jahrhundert trafen sich im Schweizer Hotel Waldhaus in Sils-Maria die großen Denker ihrer Zeit und viele waren Freimaurer. Sie machten dort Urlaub, um zu überlegen, wie sich im Europa nach der Französischen Revolution die großen Themen Toleranz, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit politisch verwirklichen lassen könnten. Es war übrigens das gleiche Dorf, in dem Nietzsche Jahrzehnte früher wohnte. Anscheinend ist es ein guter Platz für große Ideen.
Machen wir nun noch einen großen Schritt in der Geschichte, herauf in die jüngere Vergangenheit, in der bereits einige Missverständnisse über die Freimaurerei herrschten. Die einen sahen sie als Männerbund, dessen Mitglieder sich mit gegenseitigem Schulterklopfen die Welt untereinander aufteilen. Wenn jemand den Blick hinter die Kulisse des Vereinshaften warf, war es meist ein flüchtiger, sodass sich ihm ein Bild von Esoterik oder sogar von einer Art Gegenkirche zeigte. So sah das auch die Kirche, weshalb sich ein tiefer Graben zwischen ihr und der Freimaurerei aufgetan hatte.
Der Wiener Kardinal König fungierte hier als Vermittler zwischen den Welten. Befragt zur heiklen Haltung der Kirche gegenüber der Freimaurerei, sagte er: »Die Ähnlichkeit zwischen beiden ist viel größer, als man glaubt. Lasst sie uns doch wieder zusammenbringen.«
Der Kardinal wollte eine Brücke bauen zwischen den Gesinnungen, deren Schnittmenge tatsächlich groß ist. Das Streben nach innerem Wachstum, danach, zu werden, was wir sein können, die Existenz eines Weltenbaumeisters, die Beschreibung eines von ihm vorgegebenen Regelwerkes, dessen Einhaltung den Menschen empor zu neuer Größe heben kann: Bei vielem davon lagen die Unterschiede zwischen der Kirche und der Freimaurerei nur im Wording und im Kleingedruckten.
Papst Paul VI. sah das genauso und wollte, dass Kardinal König einen Friedensvertrag zwischen der Kirche und den Freimaurern verhandelte. Das Ganze, so sein Wunsch, sollte möglichst diskret vonstatten gehen, leise und hinter verschlossenen Türen. Ich genoss damals das Privileg, Zeitzeuge dieses Prozesses zu sein, und ich erinnere mich noch gut daran, denn letztendlich beobachtete ich einen einmaligen kirchlichen und politischen Vorgang, bei dem viele Mächte eine Rolle spielten und der zu einem überaus erstaunlichen Ende führte.
Als Erstes initiierte der Kardinal ein Gespräch mit dem damaligen Großmeister der Freimaurer, Kurt Baresch. Es fand recht spät am Abend statt, damit niemand sehen konnte, dass der große Mann mit einer kleinen Entourage das erzbischöfliche Palais in Wien betrat.
Kurt Baresch agierte offensiv. »Wenn Sie das Riesentor des Wiener Stephansdomes durchschreiten, dann sehen Sie, dass darüber Jesus Christus beim Jüngsten Gericht als Meister vom Stuhl dargestellt ist«, sagte er zu Kardinal König.
Das romanische Riesentor des Stephansdomes liegt an seiner Westseite zwischen den sogenannten Heidentürmen und ist der Haupteingang des Doms, den alle Gläubigen und Touristen nutzen. Dort sollte Jesus Christus als Freimaurer dargestellt sein? Was Baresch sagte, klang für den Kardinal wie eine Mischung aus Witz und Wahrheit. Immerhin ist »Meister vom Stuhl« eine Bezeichnung für den Vorsitzenden einer Freimaurerloge, den Logenmeister.
Kardinal König, der das Riesentor selbst schon ungezählte Male durchschritten hatte, glaubte seinem Gegenüber zunächst nicht und ließ umgehend den Kunsthistoriker des Diözesanarchivs kommen. Der Mann kratzte sich am Kinn und bestätigte. Jesus erscheint an besagter Stelle des Stephansdomes tatsächlich wie ein Meister vom Stuhl. Dies mit einem ganz besonderen Detail. Ein Knie von Jesus ist nackt, eine Form der Entblößung, die es nur in wenigen Jesus-Darstellungen gibt. Das ist eine schon sehr konkrete Anspielung auf die Freimaurerei. Denn empfängt ein Meister vom Stuhl, also der oberste Vertreter einer Loge, einen Neuling, ist eins seiner Knie immer nackt.
Kardinal König war beeindruckt. Er bestätigte Baresch seinen päpstlichen Auftrag, als Vermittler zwischen den aus seiner Sicht sinnlos verfeindeten Welten zu fungieren. Das Ketzerische, das die offizielle Kirche in der Freimaurerei sah, hielten der Papst ebenso wie der Kardinal für unbegründet, und das Bestreben des Kardinals trug Früchte. Es mündete in einer Art Friedensvertrag, der Lichtenauer Erklärung, 1970 zu Papier gebracht. Die Übereinkunft bestand in klaren Regeln: Beide Gruppen sollten einander mit Respekt begegnen, so der Tenor. Die Erklärung wurde damit ganz im Sinne Königs dem Geist der Moderne, der Verständnis für andere Vorstellungen zeigt, gerecht.
Auf Papst Paul VI. folgte als übernächster Papst Johannes Paul II. Seine Wahl war ein diplomatischer Akt mit einem Hintergrund, der sich wie eine Verschwörungstheorie liest und dennoch real ist, wie ich aus eigener Beobachtung bestätigen kann.
Der amerikanische Präsident Ronald Reagan gab dem Erzbischof von Chicago vor dessen Reise zur Papstwahl in den Vatikan eine mündliche Botschaft an das Konklave mit. Sie lautete, die Kardinäle mögen doch einen Papst aus einem europäischen, kommunistischen Land wählen.
Reagan, der ehemalige B-Movie-Darsteller, verfolgte dabei keineswegs religiöse Ambitionen. Vielmehr ging es ihm darum, einen Vorteil im damals noch unentschiedenen Kampf der Systeme, des Kapitalismus und des Kommunismus, zu erzielen. Reagan hoffte, ein Papst aus einem kommunistischen Land wäre so eine Art trojanisches Pferd mit Scheitelkäppchen, wie die päpstliche Kopfbedeckung heißt. Er würde den Kommunismus aufweichen, so sein Kalkül.
Der Erzbischof von Chicago und Kardinal König taten sich in diesem Sinne zusammen. Sie kamen zu dem Schluss, dass der fitteste und jüngste Kandidat ein Pole war. Karol Wojtyła, so sein Name. Für diesen Polen betrieben nun der Wiener und der Chicagoer Kardinal nächtens im Konklave Lobbying, gleichsam als Strippenzieher im Auftrag des Herrn mit einer Agenda Reagans.
Tatsächlich war es am Ende Wojtyła, der sich den weißen Pileolus, das Scheitelkäppchen, als Nächster aufsetzen durfte. Das Erste, was er als frisch gebackener Papst unternahm, war eine große Reise nach Polen, wo er die berühmten Worte sprach: »Macht auf die Tür für Jesus Christus.«
Reagan durfte stolz auf sich sein. Denn in Wahrheit war das natürlich eine Chiffre für den Westen. Der amerikanische Präsident hatte nun einen mächtigen Verbündeten im Herzen des Feindeslandes und zur Sicherheit schob er noch sehr viele Dollars nach Polen. Bekannt ist diese Geschichte kaum, dafür umso mehr, wie sie ausging. Der Kommunismus ging in die Knie, die USA griffen nach den Sternen. Eine phänomenale weltpolitische Idee war aufgegangen.
Kardinal König hatte weniger Grund zur Freude. Denn der neue Papst erwies sich als nicht gerade dankbar gegenüber dem Wiener für dessen Rolle bei seiner Bestellung. Vielmehr enthob er ihn eines seiner wichtigsten Ämter und stellte sich ihm schließlich auch beim Friedensprozess mit den Freimaurern in den Weg. Und zwar auf eine recht unschöne Art.
Ohne es König zu sagen, erteilte er 1983 Kardinal Ratzinger den Auftrag, im L’Osservatore Romano, der Tageszeitung des Vatikan-Staates, einen Brief zu veröffentlichen.24 Mit dem Inhalt, dass es »nicht die Aufgabe von Ortsbischöfen ist, mit den Freimaurern Gespräche zu führen«. Eine Schmach für Kardinal König, dem nicht als Einzigen klar war, dass mit dem für ihn despektierlichen Wort »Ortsbischof« nur er gemeint sein konnte. Die zu diesem Zeitpunkt bereits weit gediehenen Gespräche mit den Freimaurern fanden damit ein abruptes Ende.
Doch die Geschichte schlägt immer wieder neue Kapitel auf, und Dinge, die Sinn machen, lassen sich selten für immer verhindern. Heute, bald zwanzig Jahre nach dem Tod von Papst Johannes Paul II., kommt der von Kardinal König angedachte Schulterschluss wieder in Schwung. Unter den Monsignori im Vatikan gibt es einen Freimaurer in der Administration.