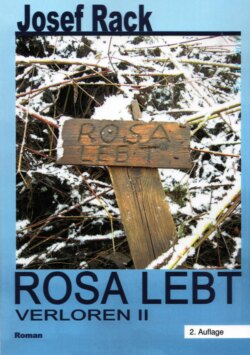Читать книгу Rosa Lebt - Josef Rack - Страница 8
Kapitel 3
ОглавлениеDie scheinbar alte Frau bewegt sich mühsam durch den matschigen Schnee; der letzte Kampf gegen den nahenden Frühling. Der alte Mantel, die Mütze tief über den Kopf gezogen - ein trauriges Bild.
Hier am Bethaniendamm zieht sich die verhasste Mauer vor bis zur Spree, überall vollgekritzelt und mit Graffitis besprüht.
Was sucht sie da? Zum wiederholten Male ist sie schon an der Böschung ausgerutscht, ihr Blick meist auf den Boden gerichtet. Es ist beschwerlich, an der Böschung, die an die Mauer anschließt, entlang zu gehen. Aber die Frau bewegt sich immer weiter suchend in Richtung Spree. Je näher sie der Spree kommt, umso aufgeregter wird sie. Hier endet die Mauer, und es gibt die Möglichkeit, auf die Rückseite der Mauer zu gelangen. Vorher war ja alles dicht, da gab es kein Durchkommen. Jetzt befindet sie sich praktisch auf dem „Todesstreifen“, also zwischen der äußeren Mauer und der HSiM (Hinterlandsicherungsmauer). Sie fröstelt. Es kostet sie viel Überwindung, die Mauer wirkt immer noch bedroh-lich. Zu ungeheuerlich ist der Gedanke, sich hier aufzuhalten und doch gefahrlos herumzulaufen, ohne Angst haben zu müssen, erschossen zu werden. Hier, auf der Rückseite der Mauer, geht sie wieder zurück. Ihr Augenmerk ist nach wie vor auf den Boden direkt vor der Mauer gerichtet. Ab und zu scharrt sie mit dem Fuß Schneereste weg. Dann stockt sie. Ein Dohlendeckel fesselt ihre Aufmerksamkeit. Ihre Augen inspizieren prüfend die Umgebung.
Hier müsste es gewesen sein, wo Hartmut erschossen wurde!
Erschüttert steht sie davor und faltet ihre Hände. Dann, mit dem Rücken an die Mauer gelehnt, lässt sie sich in die Hocke rutschen. Die vor das Gesicht geschlagenen Hände und das Zittern ihres Körpers, verraten ihre große Erregung. Nach geraumer Zeit erhebt sie sich wieder, streckt einen Arm nach oben und ballt die hagere Hand zur Faust. So steht sie da wie ein Mahnmal:
„Ihr Schweine, ihr Mörder!“ Die Anklage ist gegen die noch stehenden Wachtürme gerichtet. Es sind noch viele Menschen unterwegs. Auch Touristen natürlich, die den alten Grenzverlauf bei einem Urlaubsaufenthalt mit eigenen Augen sehen möchten, bevor die Zeugnisse abgetragen und verschwinden werden. Sich noch Mal ein Bild machen wollen von den menschenverachtenden Unterdrückungs-Maßnahmen gegenüber ihrem eigenen Volk. Die drohenden Wachtürme vermitteln eine ge-spenstische Kulisse. Die Menschen bewegen sich sonderbar ruhig. Ihre Unterhaltung ist gedämpft, als ob sie sich in einer riesengroßen Grabanlage befinden. Ja, dies war die Todeszone.
Oder ist es, weil sie dem Frieden noch nicht ganz trauen? Da wird doch keiner mehr auf einem Wachturm stehen und schießen? Tatsächlich muss sich mancher ab und zu vergewissern, dass wirklich keine Gefahr mehr droht.
Die einsame Frau, die an der Mauer steht mit ihrer hochgereckten Faust und „Schweine“ und „Mörder“ ruft, betrachten sie schockiert. Bestimmt hat sie ein trauriges Schicksal zu beklagen. Die Worte hallen schaurig zwischen den Mauern, und die vorbeiziehenden Men-schen werden noch leiser oder verstummen betreten. Bestimmt haben noch viele andere von ihnen unliebsame Erfahrungen mit dem Regime gemacht und wollen sich jetzt vergewissern, dass der Spuk wirklich vorbei ist.
Langsam geht die Frau wieder in Richtung Spree.
Sie überquert die Köpenicker-Straße. Die Böschung hinter der Fabrik am Viktoriaspeicher zur Heckert-Straße, die dann als Schillingbrücke über die Spree führt, hat es ihr besonders angetan. Aber was kann sie hier schon finden? Hier an diesem Hang der Südseite ist die wärmende Kraft der Sonne schon ganz schön zu spüren. Der Schnee ist fast gänzlich weggetaut. Hinter den Fabrikgebäuden ist es windstill und angenehm. Oben auf der Straße, an der Brücke, überall wird schon gearbeitet, um die Überbleibsel der DDR-Zeit zu vernichten – des DDR-Gefängnisstaates!
Ihre Augen drücken Entsetzen aus, wenn sie zur Spree hin blicken. Hier hat ihr Leid begonnen, die entsetz-lichsten Jahre ihres Lebens – sechs lange Schreckens-jahre!
Sie hat sich in diesen Jahren hundert Mal gewünscht, dass sie hier zusammen mit Hartmut gestorben wäre und vielleicht auch mit Toni.
Ob Toni auch umgekommen ist oder das schreckliche Abenteuer vielleicht doch überlebt hat, das weiß sie nicht. Ziemlich unwahrscheinlich kommt es ihr vor, aber die winzige Hoffnung glimmt trotzdem ganz tief in ihrer Seele. An diese Hoffnung hat sie sich auch immer wieder geklammert. Es war dieses Auf und Ab der Gefühle, das teuflische Verzagen, die Selbstaufgabe, das Sterben-wollen, dann aber wieder der Hoffnungsfunke: Er lebt vielleicht doch noch!
Aber was ist jetzt: Sie hat die schrecklichen Jahre wohl überstanden, und nun?
Der Mauerfall hat sie gerettet. Ein weiteres Jahr hätte sie noch absitzen müssen. Ob sie das überlebt hätte? Sie ist ja nur noch Haut und Knochen und auch keine alte Frau, nein, in vier Wochen wird sie gerade mal vierundvierzig Jahre alt!
Da, unter ihr, in den Abwasserrohren, hatte es das Schicksal so bestimmt: Es sollte ihnen, ihr mit ihren beiden Begleitern Toni und Hartmut, nicht vergönnt sein, in die Freiheit und dadurch in ein besseres Leben zu gelangen.
Ratlos, was sie jetzt weiter tun soll, quält sie sich an der Böschung hoch zur Schillingbrücke. Von hier hat sie eine gute Sicht hinüber zur Thomaskirche, auf das Fabrik-gelände mit dem Lagerhaus am Viktoria-Speicher und dann daneben auf die Spree – ihren Schicksalsfluss. Auf der anderen Seite verläuft die Mauer parallel an der Spree entlang bis zur Oberbaumbrücke. Dahinter sichtbar der Ostbahnhof. Unschlüssig betrachtet sie die Umgebung. Überall geschäftiges Treiben. Soll sie in die verschiedenen Betriebsgelände gehen und fragen, ob hier vor sechs Jahren ein Mann aus dem Untergrund aufgetaucht ist? Sie ist unschlüssig, da wird sie bestimmt ausgelacht. Inzwischen ist sie in der Mitte der Schilling-brücke angelangt. Die frühere Personenbrücke wird jetzt so umgebaut, dass auch Autos darüber fahren können. Es ist schon ergreifend: Früher wurde hier jeder unerlaubte Übergang mit Waffengewalt verhindert, Menschen gar totgeschossen, und jetzt spaziert man einfach darüber. Wofür hatten die Menschen ihr Leben lassen müssen?
Von der Brücke aus sucht sie die Ufermauer der Spree ab. Aha, etwa fünfzig Meter stromaufwärts erkennt sie ein dunkles Loch, das muss ein Zuflussrohr sein. Unansehnliche Brühe schießt aus dem Rohr – Schnee-schmelze wie damals! Hartmut hatte Recht gehabt: Das Abwasserrohr führt vom früheren Ost-Sektor unter der Mauer durch, dann weiter unter dem Gelände der auf der Westseite liegenden Anwesen und dann hier in die Spree. Das war dann aber ihr Pech und vielleicht auch das von Toni, dass die Spree wieder in Richtung Ost-Sektor fließt.
* * *
Ja, sie kam wieder im Osten an. Mehr tot als lebendig. Ihre Flucht durch die Unterwasserkanäle wurde ja bemerkt. Der ganze Umkreis war bestimmt alarmiert worden, und so hat man sie sehr schnell im Wasser entdeckt und herausgefischt. Sie hatte davon nichts mehr mitbekommen, sie war schon so gut wie tot gewesen, ertrunken, erfroren. Dass sie das bei den eisigen Wassertemperaturen überlebt hat, grenzt sowieso an ein Wunder. Dass sie dann in einem Krankenhaus tat-sächlich wieder ins Leben zurückgerufen wurde, ist der Kunst der Ärzte zu verdanken. Aber wozu wurde sie gerettet? Es war doch ein Hohn und absoluter Sadismus. Sie wurde gerettet und geheilt, um anschließend in grausamen Kerkern wieder zugrunde gerichtet zu werden. Wenn sie nach ihrer kolossalen Untat der Republikflucht so einfach, mir nichts dir nichts, ertrunken wäre, das wäre denen zu human gewesen.
um den Genuss der Rache, des Quälens, des Ausübens der Allmächtigkeit über das Volk gebracht!
Solange sie im Krankenhaus war, begriff sie noch nicht den Sinn ihrer widersinnigen Errettung. Ihre Genesung machte gute Fortschritte. Wo sie sich befand, dass überall Wachposten den Kontakt zur Außenwelt ab-schirmten, bekam sie anfangs noch nicht mit. Die warteten aber nur darauf, dass sie halbwegs gesund sein würde, um die nächsten Schritte einleiten zu können, die dann auch prompt folgten:
Diejenigen Herren, die sie schon nach ein paar Tagen am Krankenbett vernahmen, verhielten sich noch einiger-maßen menschlich, sie unterhielten sich noch mit ihr. Zuerst versuchte Rosa zu erklären, dass ihr Aufenthalt in der Spree nichts mit einer fehlgeschlagenen Flucht zu tun hätte. Sie versteifte sich darauf, dass sie West-berlinerin sei, am Ufer ausgerutscht und dann eben nach Ostberlin abgetrieben worden wäre.
Schnell merkte sie aber, dass es nicht so einfach war, sich als Westberlinerin auszugeben. Mit sichtlich steigendem Genuss ließ sie der Stasi-Mann Angaben zu ihrem angeblichen Wohnort, Straße, Umgebung, Arbeits-platz, Personen und so weiter zu machen. Rosa bemerkte schnell mit Schrecken, dass sie keine kon-kreten Angaben zustande brachte, sie kannte sich ja in Westberlin nicht so gut aus. Ihr wurde schnell klar, dass sie in der Falle saß.
Der Stasi-Beamte ließ ein Päckchen bringen. Ein Päck-chen versprach meist etwas Schönes, eine Über-raschung. Und was für eine Überraschung:
„Wollen Sie nicht auspacken?“
Mit zittrigen Fingern zog Rosa den Deckel der Schachtel herunter – (? ? ?)
„Na, gefällt Ihnen das?“
Welch ein triefender Zynismus! Eine zerrissene Jacke?
„Kennen Sie die?“
Rosa spürte ihre Kehle eng werden.
„Auf, weiter!“
Unsicher zog sie den nächsten Gegenstand aus der Schachtel – eine Hose, an den Knien zerrissen.
„Weiter, weiter.“
Langsam beförderte sie Unterwäsche zutage, natürlich nicht irgendwelche, es war ihre Unterwäsche, die sie bei der Flucht getragen hatte, ihre verdoppelte Unterwäsche!
Ganz unten in der Schachtel lagen ihre Ausweis-Papiere, Bilder und vieles mehr.
Alles vom Wasser ausgewaschen, vergilbt, teils unkenntlich, aber immer noch so leserlich und aussage-fähig, dass man sie ihr eindeutig zuordnen konnte.
„So, ich glaube, jetzt können wir mit dem Katz-und-Maus-Spiel aufhören!“
Rosa war geschafft. Sie hatten sie sich erstmals in Sicherheit wiegen lassen. Und dabei hatte sie sogar gehofft, dass man sie nach ihrer Genesung in den Westen abschieben würde.
Die folgende Nacht war schlimm. Sie fand keine Minute Schlaf. Wie im Delirium wälzte sie sich herum. Oh, hätte man sie doch sterben lassen!
Es wäre für sie eine Gnade gewesen.
Der nächste Tag bereitete sie auf den kommenden Alltag vor.
Ohne falsche Freundlichkeit ging es jetzt zur Sache, die „faule“ Zeit im Bett war vorbei. Gleich morgens wurde sie von zwei Wächterinnen aus ihrem Krankenzimmer ge-holt.
Mit sichtlichem Genuss riss man sie aus dem Bett. Jetzt zum Morgen hin war sie doch wohl etwas eingeschlafen. Um sich etwas frisch zu machen, dafür wurde ihr keine Zeit gegeben.
„Auf geht’s, jetzt weht ein anderer Wind!“
Das Gesicht der beiden Wächterinnen erschreckte sie richtig. Vor denen musste sie sich in Acht nehmen.
In einem separaten Raum warteten schon zwei Herren, einer davon in Uniform.
„So Verehrteste, jetzt wolln mer mal zur Sache kommen. Name? Geboren?“ So ging es los. Sie wurde nicht zum Sitzen aufgefordert. Als sie das tun wollte, wurde sie scharf angefahren: „Hat hier irgend jemand etwas von Sitzen jesacht?“
Stunden vergingen. Rosa war ohnehin noch sehr ge-schwächt und dieser Situation bei Weitem nicht gewachsen.
Wie ein Pfeil traf sie die nächste Frage:
„Wer ist Toni!?“
„Den kenne ich nicht.“
In ihrem Zustand war es ihr nicht möglich, die Worte gefasst und überzeugend rauszubringen. Sie musste sich erst auf die Situation einstellen.
„Ein Freund“, versuchte sie schwach.
„Wo ist er? Wie heißt er? Wo wohnt er?“
„Es ist ein alter verflossener Freund.“
„Ach, und darum träumen Sie jede Nacht von ihm und rufen seinen Namen?“
Schock. Sie hatten sie nachts abgehört. Dann hatte sie vielleicht in ihren Alpträumen noch mehr preisgegeben, aber was?
Ihre Stimmung sank immer tiefer, sie saß in der Falle. Da kam sie nicht mehr heraus.
„Also, wo ist denn dieser Toni? Waren da noch mehr dabei?“
So ging die Befragung stundenlang.
„Wer war denn der erschossene Tote an der Mauer?“
„Wenn Sie schon alles wissen, dann wissen Sie doch bestimmt auch dessen Namen.“
Verängstigt, aber innerlich erbost, wagte Rosa aufzu-begehren.
„Damit det en für alle Mal klar is, frech dürfen Se nich werden. Wir fragen und Sie antworten! Sie sind sich ihrer Lage noch nicht richtig bewusst. Sie werden der vollendeten Republikflucht nach Paragraph 213 ange-klagt, und was darauf steht, werden Se noch erfahren und auch deutlich zu spüren bekommen.“
„Aber, - aber, ich bin doch nicht geflüchtet“, wagte sie einzuwenden.
„Ha, ha, ha“, sadistisches Gelächter.
„Ach nee, Se ham wohl in der Spree jebadet. Das hamse sich so jedacht. Nur dank unseres heldenhaften Ein-satzes in den Unterwasserkanälen konnten wir Ihre Flucht verhindern. Im Übrigen werden Se weiterhin noch des Mordes anjeklagt.“
Mit sichtlichem Triumph: „Mord an unserem Genossen Unterleutnant Brauer! Den haben wir auch noch aus der Spree jefischt. Des Weiteren fehlt noch ein Vopo. Wir werden noch herausfinden, ob der ebenfalls durch Ihr schändliches Verbrechen ums Leben kam. In Ihrer Haut möcht ich nich stecken.“
Rosa blieb stumm.
Wie Schuppen fiel es ihr von den Augen:
‚Mein Überleben war umsonst.’ Soviel war ihr klar: Aufgrund dieser Anschuldigungen war ihr Leben verwirkt. Es konnte nur die Todesstrafe auf sie warten!
Ja, sie wäre dann zwei Mal gestorben. Das erste Mal hatte sie ja schon hinter sich. Sie wusste im Abwasserrohr nichts mehr von sich, sie spürte nichts mehr – sie war praktisch tot - erlöst.
Und jetzt stand ihr eine schlimme Zeit bevor, bis sie hingerichtet werden würde, das war ihr klar. Diesmal aber bei vollem Bewusstsein.
„He, aufwachen! Hier unterschreiben!“
Ihr war alles egal. Unterschrift.
Am nächsten Tag ging’s schon in der Frühe um sechs Uhr los. Egal, sie hatte sowieso nicht geschlafen. Fertigmachen, kaum Körperpflege, egal. Fort, in den Hinterhof, ins Transportfahrzeug, egal. Sie war apa-thisch, ihr Lebenswille erloschen.
Holprige Fahrt. Wohin? – Egal.
Dass sie ins Untersuchungsgefängnis Hohenschön-hausen gebracht wurde, wusste sie damals noch nicht.
In dem engen Transporter befanden sich noch drei andere Leidensgenossinnen und drei Aufsichtspersonen. Rosa war kaum fähig, während der schaukelnden Fahrt gerade zu sitzen. Sie kippte zur Seite auf ihre Nachbarin. Eine Aufsicht packte sie unwirsch an den Haaren und schloss ihre hochgezogenen Arme mit den Handschellen an eine oben verlaufende Stange. Ohne Kraft hing ihr ganzes Gewicht an den Eisenschellen. Sie hatte das Gefühl, alle Gelenke würden auskugeln. Als sie zum Aussteigen aufgefordert wurde, fielen ihre Arme kraftlos herunter, vollkommen taub und leblos. Sie war nicht mehr fähig, ihre Tasche mit den wenigen Habseligkeiten zu tragen.
„Na ja, auch gut. Die brauchste sowieso nich mehr.“
Die ersten Tage döste sie in einer unterirdischen Einzelzelle: Ganz oben ein winziges vergittertes Luftloch, nur ein Eimer, fürchterlicher Gestank, und ein Feldbett, das aber während des Tages hochgeklappt wurde – und oben bleiben musste.
Am zweiten Tag, spät abends, war sie erleichtet, dass sie, obwohl unter groben Befehlen, abgeholt wurde.
Hauptsache, das endlose Warten in der kalten Zelle hatte ein Ende.
Jetzt gingen die Verhöre offiziell erst los.
Stundenlang immer wieder dieselben Fragen. Natürlich auch über den Verbleib von Toni, des fehlenden Vopos und auch Fragen über Hartmut. Soviel sie entnehmen konnte, saßen ihre Eltern auch schon zu Befragungen über sie in U-Haft.
Ja, das konnten sie. Sie waren Verhörspezialisten ersten Ranges!
Die Unsicherheit darüber, was ihre Eltern dachten und inwieweit sie eingeweiht waren, setzte ihr sehr zu. Ihren Eltern hatte sie bewusst nichts von ihren Fluchtplänen erzählt. Dass Toni letztendlich die DDR verlassen wollte, um seine Eltern zu finden, vermuteten sie natürlich. Ob dann ihre Tochter mitgehen würde, konnten sie sich eventuell denken. Rosa wusste es nicht, das Thema wurde bei Unterhaltungen mit ihren Eltern ausge-klammert. Es war allgemein üblich, dass selbst engste Familienangehörige brisante Themen nicht ansprachen, aus unterschiedlichsten Gründen, mitunter auch darum, weil man niemanden trauen konnte oder weil selbst ein Angehöriger eventuell ein IM sein konnte. Aber nicht nur deshalb, sondern einfach nur um die Angehörigen zu schützen. Bei einer prekären Situation, wie jetzt bei der Flucht eines Angehörigen, konnte es leicht passieren, dass ein Familienmitglied unter Befragungszwang doch Angaben machte, bewusst oder unbewusst. Zwangs-mittel hatte der Stasi vielfältigster Art parat.
Rosa konnte guten Gewissens aber verneinen, dass ihre Eltern etwas von ihrem Vorhaben wussten.
Nahmen die Befrager das ab, konnte dies als Pluspunkt für sie gewertet werden. Wenn nicht, würde man es ihr dann als Lüge anlasten und ihr mangelnde Bereitschaft zur Aufklärung des Sachverhaltes vorwerfen. Was sich dann wieder strafverschärfend auswirkte.
Im Fall Hartmut erkannte sie deutlich die Genugtuung über dessen Tod. Wenigstens hatte man einen zur Strecke gebracht.
Rosa war schockiert über soviel Hartherzigkeit. Sie prahlten damit, dass sie ihn „wie ein Kaninchen abge-schossen“ hatten. Für seinen Vater Martin sah Rosa ganz schwarz. Der stand bei ihnen sowieso als absoluter Störenfried auf der „Schwarzen Liste“. Ihm lasteten sie jetzt natürlich auch eine Mittäterschaft an. Zusammen mit seinen schon vorher bekannten Verfehlungen würde er wahrscheinlich nie mehr das Tageslicht in Freiheit erblicken. Der Mann tat ihr leid, mehr konnte ein Mensch nicht mehr auf seinem Konto verbuchen. Das war aber jetzt nicht ihr Problem, schließlich stand sie jetzt auch davor, ihre „Negativkarriere“ zu beginnen.
Toni war das große Rätsel, und der verschwundene Vopo. Der interessierte sie aber weniger. Was war aber mit Toni? Sie hätte es ja auch gerne selbst gewusst.
Sie wünschte sich so sehr, dass wenigstens er das gefährliche Abenteuer lebend überstanden hatte.
Wusste er dann überhaupt, was mit ihr war? – bestimmt nicht.
Er musste nicht denken, sie sei ertrunken?
Wenn sie je durchkam, konnte er sich denken, dass sie wieder in den „Osten“ abgetrieben wurde, darüber hatten sie ja vor der Flucht gesprochen.
Würde er sie dann suchen? Aber wie und wo?
Sie flehte innerlich: ‚Toni ich wünsche mir so sehr, dass es dir gut geht, du hast es verdient! – wir hatten eine schöne Zeit miteinander, die bleibt mir in Erinnerung.’
Die Tage der Vernehmungen, die meistens nachts stattfanden, zogen sich endlos dahin. Rosa hätte gern nach der dritten Nacht alle Befragungs-Protokolle anstandslos unterschrieben. Es genügte aber nicht. War es nur aus der Lust, einen Menschen zu quälen? Wer weiß? Rosa konnte nur immer wieder die mit ihrer Flucht verbundenen Fakten wiederholen. Trotz der brutalen schikanösen Methoden, sie konnte keine weiteren An-gaben, weder über ihre zwei Fluchtgefährten noch über weitere Personen, machen.
Die Quälereien schlossen eine ganze Palette von widerstandsbrechenden Schikanen ein:
Einzelhaft in einer modrigen Zelle, knappe anderthalb auf drei Meter, ohne Fenster natürlich, ein Eimer und eine Matratze, die tagsüber an die Wand hochgeklappt wurde. Nachts ging alle paar Minuten das Licht an, so war an Schlaf nicht zu denken. Die Türspionklappe wurde ständig bewegt und ein Auge starrte hinein. Die ersten Tage war sie nicht imstande, ihre große Notdurft zu verrichten. Irgendwann geht das aber nicht mehr anders. Als sie sich anfänglich mit dem Rücken zur Türe auf den Eimer setzte, wurde ihr das heftig ausgetrieben. Die Türe wurde aufgerissen und ein Knüppelhieb sauste auf ihren Rücken. Sie wollten alles mit ansehen, und das von vorne. Es musste ihnen wohl tierischen Spaß machen. Ob sich Männlein oder Weiblein ihr Auge an den Tür-Spion drückten, wusste sie nicht. Sie durfte nachts nur auf dem Rücken liegen, und ihre Hände mussten auf der Decke zu sehen sein. Entsprach ihre Schlafstellung nicht den Vorgaben, wurde sofort die Türe aufgerissen und mit dem Schlagstock gegen den Metallrahmen geschlagen. Es war nur ein unruhiges traumatisches Hin- und Herwälzen, wie konnte sie da die Rückenstellung mit aufgelegten Händen einhalten?
Ein zweitägiger Aufenthalt in der Wasserzelle galt aber als das Härteste: Die Türschwellen waren erhöht und man ließ Wasser in die Zelle laufen – eiskaltes Wasser natürlich. Es gab keine Möglichkeit, auf einen erhöhten Platz zu gelangen, denn die Zelle besaß kein Inventar. Zudem war sie angekettet, sodass sie unentwegt dem kalten Wasserstrahl ausgesetzt war.
Eine Anrede an sie bestand nur aus gebrüllten Anweisungen. Die Gesichter und Augen der Auf-seherinnen drückten ihre ganze Abscheu gegen sie, die „Politische“, aus. Republikflucht war das Verwerflichste, was jemand tun konnte, dies stand noch über Mord. Aber den lastete man ihr ja auch an. Eine Steigerung gab es also nicht mehr. Zu essen gab es nur eine Scheibe hartes, trockenes Brot mit einem Becher Flüssigkeit, Tee-ähnlich oder „Muckefuck“. Einmal am Tag bekam sie einen Teller Kohlsuppe. Hunger hatte sie aber sowieso nicht. Sie war irgendwann soweit, kein Gefühl mehr zu haben.
Früh am Morgen wurde sie abgeholt. Keine anderen Gefangenen bekam sie zu Gesicht. Durch lange Gänge, viele Türen und Schlösser. In jeder Etage waren Drahtnetze über die Treppenschächten gespannt. Für jegliche selbstmörderischen Vorhaben gab es keine Möglichkeit.
Die Taktik der Vernehmung wechselte sprunghaft. Zuerst bemühte man sich noch mit übertriebener Höflichkeit und Anbieten einer Tasse Kaffee oder gar Zigaretten. Mit dem Hinweis auf eine mögliche frühzeitige Entlassung wollte man die Bereitwilligkeit zur umfassenden Aussage wecken. Es war Rosa aber von Anfang an klar, dass sie bei ihrem Delikt so oder so keine Chance hatte. Und als sie dann Zugeständnissen zu Dingen forderten, die wirk-lich nicht geschehen waren, entschloss sie sich schnell zu schweigen.
Die Vernehmungs-Protokolle enthielten dann eingefügte Aussagen, die sie nie gemacht hatte. Trotzdem unter-schrieb sie, Hauptsache man ließ sie dann für den heutigen Tag endlich in Ruhe!
Die Anklagepunkte: Republikflucht nach Paragraph 213, plus Beihilfe zum gemeinsamen Mord an zwei verschwundenen Volkspolizisten. Das war dann keine Überraschung mehr für sie. Sie konnte sich auch denken, was darauf stand.
Weitere Tage vergingen, an denen sich niemand um sie kümmerte. Nur das Essen wurde gebracht und ihr Eimer geleert.
Sie war jetzt so weit und wollte nur noch, dass alles schnell über die Bühne ging.
So verspürte sie eine gewisse Erleichterung, als um fünf Uhr die Schlüssel schepperten und die Türe aufgerissen wurde:
„Aufstehn, fertig machen, alles zusammenräumn, in ner halben Stunde Abmarsch!“
Todesurteil
Unsanft wurden ihr Fesseln an Händen und Füßen an-gelegt. Genauso unsanft wurde sie in den Transport-wagen gestoßen. Bloß keine Fluchtmöglichkeit. Aber wie wollte sie flüchten, sie konnte ja selbst kaum mehr laufen, man zog sie hinter sich her. Mit ihr wurden noch drei weitere Gefangene transportiert.
„Schnauze haltn, damit das klar ist!“ Aber es war ohnehin niemandem zum Reden zumute. Die Gesichter waren gezeichnet, Hoffnungslosigkeit ausdrückend. Rosa ver-mied es sowieso, ihre Leidensgefährtinnen richtig anzuschauen, denn so schlimm dürfte sie ja selbst aussehen, und auf den Anblick war sie nicht erpicht.
Gerichtsverhandlung.
Eine Farce! War klar. Ihr zugewiesener Verteidiger Herr V. bemühte sich redlich, für sie eine Entlastung zu erreichen. Es blieb ihr unklar, inwiefern sein Bemühen ehrlich war. Bestimmt war er nur eine Marionette, aber damit wollte man zum Schein eine gewisse Rechts-staatlichkeit demonstrieren.
Die Verhandlungsdauer von knapp zwei Stunden für so einen „schweren Fall“ brachte dies auch deutlich zum Ausdruck.
Das Todesurteil „Im Namen des Volkes“ war dann wenig überraschend.
Für Rosa spielte sich das ganze Procedere wie in einem Film ab, einem Film, dem sie teilnahmslos zusah und in dem sie doch die Hauptrolle spielte.
Beim Hinausgehen versagten ihr aber dann die Beine. Sie fühlte ihre Beine nicht mehr, sie fühlte überhaupt nichts mehr. Von zwei Uniformierten wurde sie regelrecht hinaus geschleift und in den wartenden Transportwagen hineingeworfen. Ein Stück Vieh würde man wahrschein-lich menschlicher behandeln. Sie war jetzt aber weniger wert.
Wieder fort. Mit dem Transporter unterwegs. Wohin? Sie wusste es nicht, weshalb auch?
Nach stundenlanger holpriger Fahrt kamen sie endlich an. Den mitfahrenden Leidensgenossinnen schien es genauso elend zu gehen. Aber kein Wort durfte gewech-selt werden. Gerne hätte bestimmt jede von ihnen gewusst, was die andere „verbrochen“ und welche Strafe sie erhalten hatte. Aber unter den wachsamen Augen der Aufpasserinnen wagte es niemand, ihnen einen Grund zur Züchtigung zu liefern. So saßen sie eben in dem fensterlosen, stickigen Transporter wie Tiere, die zur Schlachtbank geführt wurden. Die brauchten auch nicht zu wissen, was mit ihnen geschieht. Und „Schlachtvieh“ waren sie schließlich jetzt auch.
Bei ihrer Ablieferung hatte Rosa das Gefühl, dass dies die letzte Station in ihrem Leben war. Wie gerne hätte sie wenigstens unterwegs noch etwas von der schönen Welt gesehen, es war ihr aber nicht vergönnt gewesen.
Tatsächlich landete sie im Frauenzuchthaus Hoheneck in Stollberg bei Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz.
Die Ausladung erfolgte in der Einlassschleuse, tatsäch-lich wie bei einer Herde Tiere. Ringsum standen Auf-passer, aber nicht nur mit Holzprügeln, sondern mit Gummiknüppeln und Maschinenpistolen. Auf dem Weg durch den Gang wurden sie mit unsanften Knüppel-stößen drangsaliert. Wehe dem, der stehen bleiben wollte!
Zuerst ging es zu den Effekten. Alle Kleider ausziehen, und zwar alle, und abgeben. Ein entwürdigendes Schau-spiel inklusive Leibesvisitation aller Körperöffnungen vor fünf strengen Bediensteten. Sie könnte sonst ja irgend-welche schlimme Dinge hineinschmuggeln.
Ärztliche Untersuchung, ein Häftling sollte ja schließlich gesund sein, haftfähig, wenn er den Gang zum Henker antrat.
Dann wieder zu den Effekten zurück, um ihre zukünftige Kleidung und eine raue Decke, wohl für die Nacht, in Empfang zu nehmen. Die Unterwäsche war das Schlimmste: dicker, kratziger Stoff. Rosa war froh, dass sie sich nicht im Spiegel sehen konnte. Kratzige Strümpfe, ein Rock, ein Hemd und eine Jacke, wohl aus abgelegtem Uniformstoff angefertigt, und Sandalen. Zum Schluss der Einweisungszeremonie wurde ihr ein Pro-tokoll vorgelegt, um die Richtigkeit der Untersuchungen, aller Handlungen, den Empfang der staatseigenen Kleidungstücken und die Korrektheit von Seiten des Personals der Staatsorgane durch ihre Unterschrift zu bestätigen. Es sollte ja schließlich alles nach den Gesetzen der Rechtsstaatlichkeit ablaufen. Danach ging’s zum Friseur. Rosa ließ alles über sich ergehen. Erst als sie mit Entsetzen feststellte, dass ihre Haare in voller Länge vom Kopf fielen, ging ihr beim Betrachten im Spiegel auf, dass sie eine Glatze verpasst bekam. Im „Frisiersalon“ hatte man wohl bewusst einen Spiegel angebracht, die Häftlinge sollten doch sehen, wie schlimm sie aussahen. Der Schock saß tief. Nur durch die gebrüllten Befehle ihrer ständigen Aufseherinnen brachte sie die letzten Kräfte auf, um sich zu erheben. Torkelnd setzte sie einen Fuß vor den anderen.
Einmarsch in den „Raubtierkäfig“ mit dem Gefühl, dass sie hier wohl nie mehr heraus kommen würde, jedenfalls nicht mehr lebendig.
Sie hatte schwach gehofft, dass sie wenigstens zusammen mit anderen Leidensgefährtinnen in eine größere Zelle kam. Diese Freude gönnte man ihr aber nicht, sie war ja schließlich eine „Politische“, und die standen auf der untersten Stufe, für die gab es nur Ein-zelhaft, erst mal.
Ihre Zelle war dann auch dementsprechend groß: knappe zwei Meter breit, circa drei Meter lang und gerade mal zwei Meter hoch, zudem dunkel. Nur ein winziger Licht-schimmer drang von ganz oben durch ein kleines Luftloch.
So, wie sie jetzt untergebracht war, konnte es nicht lange dauern, bis ihr Todesurteil vollstreckt wurde. Nur im Dunklen, ohne irgendwelche Betätigungsmöglichkeit, keine Sitzmöglichkeit, keine ausreichende Verköstigung, das konnte nicht lange gut gehen. Sie war froh, dass sie sich nicht im Spiegel sehen konnte.
Die Tage gingen endlos langsam dahin, die schlaflosen Nächte aber auch nicht schneller. Anfangs versuchte sie, Striche in die Wand einzuritzen, damit sie die ver-brachten Tage zählen konnte. So konnte sie sich doch wenigstens mit irgendetwas beschäftigen. Da zerbrach ihr aber der Plastiklöffel, mit dessen Stiel sie gekratzt hatte. Da war was los. Von Zerstörung von Volkseigen-tum war die Rede. Das brachte ihr gleich einen Tag Essensentzug ein. So gab sie diese Betätigung auch auf. Alle Lieder, die ihr irgendwie einfielen, Gedichte, Briefe, die sie jemals bekommen hatte, die sie an jemand ge-schrieben hatte, Theaterstücke und so weiter, alles ließ sie Revue passieren, murmelte die Texte vor sich hin. Oft saß sie auf dem kalten Boden, wiegte sich hin und her. Man hatte schon Tiere im Zoo gesehen, die sich genauso stundenlang vor den Gittern hin und her bewegten. Ihr erging es aber schlechter als diesen Tieren. Wenn sie wagte, Liedtexte laut zu singen, wurde sie sofort abge-mahnt:
„Ach, Ihnen geht’s ja wohl noch zu gut, Sie Schlampe.“
Grundsätzlich wurde sie im Wortwechsel mit ordinären und entwürdigenden Anreden bedacht.
Die einzigen Lebewesen, die ihr Gesellschaft leisteten, waren Ungeziefer: Egel, Ameisen, Kakerlaken, Würmer, Fliegen und noch andere namenlose. Ach so, und Läuse gab es natürlich auch noch. Zuerst ekelte sie sich vor diesem Getier. Mit der Zeit überwand sie aber ihre Abscheu. Dann fing sie an, mit ihnen zu sprechen, nahm sie schließlich in die Hand und streichelte sie. Sie beneidete sie sogar noch, hatten sie doch ein normales freies Leben, für sie gab es keine Mauern. Selbst als ein Mäuschen auftauchte, wich die angeborene Scheu schnell, und Rosa empfand eine riesengroße Freude. Bei der Maus hatte sie das Gefühl, es mit einem Lebewesen mit Gehirn zu tun zu haben. Ja, soweit war sie jetzt. Auf dem Boden sitzend versuchte sie, das Mäuschen anzulocken. Aber womit? Von dem bisschen Essen, das sie erhielt, konnte sie kaum etwas abgeben, und doch war es ihr das wert. Mit winzigen Stückchen Brot ver-suchte sie, das Zutrauen der Maus zu gewinnen. Stun-denlang saß sie da und wartete auf den Besuch. Einmal mit ihrem Finger über das zarte Fell der Maus zu streicheln, erschien ihr als das höchste Glück, aber soweit kam es nicht. Rosa war jedes Mal traurig, wenn sich das Mäuschen wieder verzog.
Das Gefühl von Menschsein tendierte gegen null.
Ihr körperliches Unwohlsein – Kopfweh, Magen- und Unterleibskrämpfe, Koliken, zwei Zähne fielen ihr auch schon aus - verstärkte sich immer mehr. Sie konnte kaum irgendwelche Körperpflege betreiben. Sie hatte das Ge-fühl, dass ihr Mundraum regelrecht verfaulte. Dass ihre Regelblutungen unter diesen Strapazen ausblieben, war nicht verwunderlich. Wiederholt erbrach sie die ab-scheulich schmeckende Kohlsuppe.
Ihre Wächterin, ein frauenähnliches Wesen mit dem Titel „Obermeisterin“, war menschenverachtend und sah brutal und ordinär aus. Sie erboste sich einmal so sehr, dass sie Rosa mit dem Gesicht in das Erbrochene drückte:
„Friss das auf, du Sau!“
Rosas Gesundheitszustand verschlechterte sich von Tag zu Tag. Sie blieb auf dem Boden liegen und wimmerte vor sich hin, wobei sie noch versuchte, dies so leise wie möglich zu tun. Von Essen war keine Rede mehr, ihr Magen behielt nichts mehr.
Wenn jemand die Zellentüre öffnete, flehte sie nur noch:
„Macht Schluss mit mir, lasst mich sterben.“
Ein Tag unterbrach ihren Alltag. Morgens wurde eine Mitgefangene in ihre Zelle beordert, die Putzzeug dabei hatte. Nun wurden sie aufgefordert, ihre Zelle zu schrubben und alles ordentlich hinzurichten. Mittags verstand Rosa den Sinn: Vor der Zellentüre vernahm sie mehrere Stimmen. Dann wurde ihre Türe geöffnet. Die Obermeisterin gestattete verschiedenen Herren in Zivil Einblick in ihre Zelle und machte dienstbeflissen Mel-dung:
„Verwahrraum 26 mit der Strafgefangenen Nummer 293, wegen Republikflucht und Mord zum Tode verurteilt.“
Der nächste Tag verlief wieder anders: Gleich morgens wurde Rosa abgeholt.
Dass sie dann in den Waschraum geführt wurde, um sich zu duschen und sonstige Körperpflege zu verrichten, deutete auf ein ganz besonderes bevorstehendes Ereignis hin.
Für sie war klar: Ihre letzte Stunde steht bevor!
Aber sie täuschte sich. Sie wurde abgeholt und in den medizinischen Trakt gebracht.
Die wollen sich wohl vergewissern, dass sie keine Kranke umbringen, dachte Rosa.
Im Prinzip war es auch so.
Untersuchungen um Untersuchungen folgten. Sie durfte sogar in einem sauberen Krankenbett liegen. Die Tränen liefen ihr ungehemmt übers Gesicht. Dass sie das noch einmal erleben durfte, ein weiches sauberes Bett…
Bestimmt bekam sie dann anschließend ein ganz tolles Essen, die Henkersmahlzeit, wie man es sich so vorstellt, dann würde aber wohl endgültig Schluss sein.
Rosa verspürte keinerlei Unbehagen oder gar Angst vor dem scheinbar Bevorstehenden. Sie hatte schon längst damit abgeschlossen. So wollte sie auf keinen Fall mehr weiterleben, dann lieber alles schnell hinter sich bringen.
Es kam aber wieder anders.
Eine ganze Kommission verschiedenster Personen erschien in ihrem Zimmer, der Anstaltsarzt Major P., drei männliche und weibliche Ärzte bzw. Assistenten, zwei Uniformierte und eine Person in Zivil, wahrscheinlich Staatssicherheit.
Rosa begriff gar nichts: Ach lasst mir meine Ruhe, dachte sie still.
Der Arzt ergriff das Wort:
„Strafgefangene Frau F., Ihre Diagnose ist überraschend, aber eindeutig.“
Rosa begriff die Welt nicht mehr, eigentlich schon lange nicht mehr.
Jetzt werde ich auch noch mit meinem Namen angesprochen, welch eine Ehre.
Sie konnte sich nichts dafür kaufen, wie man so sagt, aber es tat ihr unendlich gut, ein bisschen Menschgefühl!
„Machen Sie’s kurz, ich habe mich abgefunden, dass ihr mich umbringen wollt.“
Für diese Aussage musste sie ihre ganze Kraft aufbringen. Sie brauchte jetzt aber auch kein Blatt mehr vor den Mund zu nehmen – sie hatte ja nichts mehr zu verlieren.
Der Arzt wusste nicht recht, wie er beginnen sollte. Rosa war nicht klar, ob der Arzt tatsächlich mitleidige Augen machte, - ‚ach, bestimmt Heuchelei’.
Ungeduldig schubste ihn der anscheinend ranghöhere Uniformierte an, aber sichtlich wenig erfreut:
„Auf, jetzt bringen wir’s zum Schluss.“
Der Arzt wandte sich dann zu Rosa:
„Was reden Sie denn da von Umbringen, wir Ärzte sind doch dafür da, Leben zu retten.“
Für Rosa war soviel Heuchelei kaum mehr zu ertragen, sie empfand nur noch Ekel und Hass. Im Weinkrampf vergrub sie ihr Gesicht im Kopfkissen.
Sie spürte aber die sanfte Hand des Arztes, die über ihren kahlen Kopf strich – ach, tat das gut.
„Frau F., Sie müssen doch nicht sterben, Sie schenken sogar Leben dazu. Sie bekommen ein Kind!“
Rosa begriff die Worte nicht. Mit ihren Händen ergriff sie die Hand des Arztes und hielt sie fest, damit er sie nicht entfernen konnte. Sie führte seine warme Hand immer wieder über ihr Gesicht. Wie sehr sehnte sie sich nach Streicheleinheiten, wenn es doch ehrlich wäre...
„Sagen Sie es bitte noch einmal!“
„Sie haben richtig gehört: Sie sind schwanger und bekommen ein Kind!“
Die Uniformierten wollten sich einmischen und Fragen an Rosa richten. Jetzt sah ja schließlich alles anders aus. Ein sicheres Opfer für den Henker versuchte, ihnen zu entwischen. Aber der Chefarzt wurde darauf energisch:
„Aber meine Herren, ich bitte Sie um ein bisschen Respekt vor der Kranken. Jetzt gehört sie erstmal mir!“
Betreten verließen die Störenden das Krankenzimmer. Einer davon konnte es sich nicht verkneifen und mur-melte noch:
„Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.“
Dankbar umklammerte Rosa die Hand des Arztes. Sie verspürte ein winziges Glimmen der Hoffnung tief im Herzen: Begann nun ihr Leben wieder?, wahrscheinlich nur kurzfristig.
Das neue Leben in ihr kann ja nur von Einem sein – von ihrem TONI!
Toni würde so in ihr, in dem Kind weiterleben.
Eine ungeheure Welle des Glücks durchströmte sie. Jetzt war ihr egal, was anschließend mit ihr geschah. Das Kind würde sie mit Freuden zur Welt bringen. Hoffentlich blieb sie so lange gesund, um alles zu überstehen. Haupt-sache das Kind würde gesund geboren. In ihm sollte Toni weiterleben, auch wenn es vielleicht eine Tonia werden würde.
Der Arzt schickte seine Leute aus dem Zimmer und blieb noch alleine an ihrem Bett sitzen.
Rosa erkannte seine aufrichtige, ehrliche Anteilnahme.
„Ich gratuliere Ihnen. Haben Sie es wirklich nicht gewusst?“
„Nein.“ Mehr brachte Rosa nicht heraus. Das Glücks-gefühl hatte ihr so eine angenehme innere Wärme beschert, die sich in ihr ausbreitete wie ein Vulkan.
„Ja, dann weiß es der Vater bestimmt auch nicht?“
„Er weiß es auf keinen Fall. Ich fürchte sogar, er wird es nie erfahren, denn ich weiß ja nicht einmal, ob er noch lebt und wenn, wo er lebt.“
„Oh je, Kind.“ Mehr konnte er im Moment nicht sagen. Er hatte wahrscheinlich keine Ahnung von ihrer Vorge-schichte, ahnte aber, dass sich dahinter ein größeres Drama verbarg.
Als er sie verlassen wollte, hielt ihn Rosa noch am Ärmel fest:
„Herr Doktor, wenn ich je doch sterben sollte, soll es mir egal sein. Ich hab’ nur einen Wunsch, einen letzten: Kümmern Sie sich bitte darum, dass mein Kind gesund zur Welt kommt und es gut versorgt wird. Es soll Toni heißen, wenn’s ein Junge wird, aber auch für ein Mädchen habe ich einen Namen: Tonia.“
Die drei Tage, die Rosa in der Krankenstation verbringen durfte, empfand sie wie ein Wunder.
Die Euphorie der ersten Zeit legte sich jedoch bald. Die momentane Selbstlosigkeit, dass es jetzt nur noch wichtig war das Kind zu bekommen, egal was dann mit ihr geschehen würde, wich bald. Ihre Gedanken richteten sich immer mehr auf die Zeit danach. Sollte das Kind dann ohne Mutter leben? Mit jedem Tag verspürte sie deutlicher das neue Leben in sich, und ein unbekanntes Gefühl wuchs in ihr. Die Zugehörigkeit des neuen Lebens zu ihm und ein unbekanntes Gefühl erwuchs in ihr. Die bisherigen Selbstgespräche richteten sich jetzt an ein menschliches Lebewesen, an das gemeinsame von Toni und ihr. Die Liebe zu diesem Ungeborenen wuchs.
Ja, jetzt machte sie sich Sorgen um ihre Zukunft. Wie würde es wohl weitergehen? Es war ihr nicht mehr egal, dass man sie nach der Geburt umbringen würde. Das war endgültig vorbei. Aber darüber würde sie leider nicht entscheiden.
Dass man sie wegen der Schwangerschaft entlassen würde, daran glaubte sie nicht. Sie befürchtete auch, dass man ihr das Kind wegmachen könnte, sie hätte ja keinen Einfluss darauf, und alle störenden Umstände wären beseitigt. Aber welche Alternative wäre denn tatsächlich vorteilhafter? Eine Umwandlung der Todes-strafe, darauf konnte sie vielleicht hoffen. Dafür würde dann bestimmt eine langjährige Haftstrafe übrig bleiben, zehn oder fünfzehn Jahre Zuchthaus! Sie schauderte bei dieser entsetzlichen Vorstellung.
Wenn sie an die zurückliegenden Wochen dachte, er-schien ihr das als nicht erstrebenswert. Konnte das ein Mensch überhaupt aushalten?
Wie lange es dauerte, bis ein Todesurteil vollstreckt wurde, wusste sie nicht, vielleicht ein paar Wochen, höchstens Monate. Sie sah keine Möglichkeit ihr Schick-sal zu beeinflussen, oder doch?
Heimlich versteckte sie ab und zu eine Tablette, wer weiß, ob sie einmal darauf zurückgreifen möchte.
Am vierten Tag wurde sie wieder abgeholt. Der letzte Händedruck des Chefarztes. Bei einem Gespräch unter vier Augen hatte er ihr seine Privatadresse gegeben. „Vielleicht kann ich Ihnen einmal helfen, aber bitte zu niemanden ein Wort darüber.“
Rosa war so dankbar. Gott sei Dank, es schienen doch nicht alle Unmenschen zu sein.
Sie wurde aber schnell wieder in die Wirklichkeit zurück-geholt:
„Auf, Sachen packen, die faulen Tage sind vorbei!“ Die zwei „Gefängnishündinnen“ nahmen sie unsanft unter ihre Fittiche. Ihre auf die Seite geräumten Tabletten legte sie zu den anderen, die sie zur weiteren Einnahme vom Krankenrevier mitbekommen hatte. So hoffte sie, durch die Kontrolle zu kommen. Aber gefehlt:
„Wat Tabletten mitgebn. Det könnt de so passn. Wir bestimmn, wenn’s wat jibt – verstandn!“
In der Kleiderkammer bekam sie neue Häftlingskleidung, etwas umfangreicher als vorher.
Relativ erfreut stellte sie fest, dass man sie in einen anderen Zellentrakt verbrachte. Erster Stock. Endlose Gänge, endlose Reihe von Zellentüren.
Nr. 275. Schlüsselrasseln. Aufschließen. Von innen drang abgestandene Luft auf den Gang.
„So, Ihre neue Heimat, - ha, ha, ha.“
Eine Hand schob sie von hinten in die Zelle, die momentan leer war. Dass die Zelle aber bewohnt war, konnte man sehen. Zwölf Betten, vier mal drei aufein-ander gestellt. Regale, ein Waschbecken, ein Eimer. Jetzt bekam sie gleich einen Schreck: Ein Eimer! Sollte der vielleicht für ihr „Geschäft“ sein – für alle zwölf?
Es stellte sich dann aber anders heraus: Zwischen zwei benachbarten Zellen gab es einen Waschraum mit zwei Toiletten. Der Eimer war als Abfalleimer gedacht.
Ein unteres Bett war noch nicht belegt. Es war klar, das würde sie beziehen. Bei den Regalen war es nicht so einfach, zu erkennen, welches frei war. In einem, das vor ihrem Bett stand, war noch etwas Platz. Sie schob die schon darin befindlichen Gegenstände etwas zusammen und legte ihre Sachen hinein.
Anschwellende Geräuschkulisse auf den Gängen. Schlüsselgerassel, ihre Türe wurde entriegelt. Zwei ihrer zukünftigen Zellengenossinnen wurden abgeliefert.
Erstmal erfreut: „Ach, eene Neue“, aber auch argwöh-nisch. Kritische Augen taxierten sie von oben bis unten. Rosa bemühte sich gleich, ja nicht anzuecken. Sie konnte sich vorstellen, dass es nicht einfach sein würde, mit so vielen Frauen in einer engen Zelle zusammen leben zu müssen. Noch hielten sich die zwei neu hinzugekommenen Frauen zurück. Ein paar Minuten später wurden die nächsten gebracht, bis um 18 Uhr alle zwölf beieinander waren.
Eine große, kräftig gebaute Frau, ganz ihrer Kraft und Stellung bewusst, riss sofort im Vorbeigehen die Sachen von Rosa aus dem Regal. Rosa begehrte gleich auf:
„He, was fällt Ihnen denn ein!“
Die Angesprochene fuhr herum und packte Rosa vorne an der Jacke:
„Is wat Kleene?“
„Na, meine Klamotten“, wagte Rosa einzuwenden.
„Ick bestimme hier, wer wo wat einräumt – klar?“
„Ist mir egal, dann sag mir’s doch.“ Rosa hatte keine Lust auf Streit. Ihr war klar, dass das Zusammenleben nur so erträglich funktionieren konnte, wenn sie sich unter-einander vertrugen. Und dass es hier nur mit einer ge-wissen „Hackordnung“ funktionierte, konnte sie sich den-ken. Sie, als Neuling, würde jetzt der „letzte Dreck“ sein.
„Merk dir gleich Kleene, ick bin die Verwahrraum-sprecherin und hier wird jemacht, wat ick saje – kapiert?“
„Von mir aus.“
Nachdem dies geklärt war, brach jetzt die vorher gezügelte Neugier durch:
„Name?“
„Delikt?“
„Wie lange?“
Rosa versuchte offen alles zu beantworten.
Mit ihrer Republikflucht stieß sie aber auf keine große Gegenliebe. Erst als sie dann von der Anklage, einen Mord an einem Vopo begangen zu haben, erzählte, brachte man ihr so etwas wie Hochachtung entgegen und sie erntete dafür Beifall.
Sie musste erzählen und erzählen.
Ihre Mithäftlinge saßen schon zwischen fünf Monaten bis vier Jahren ein. Da war man natürlich riesig neugierig, was es draußen Neues gab.
Der Start war so für Rosa erleichtert, da sie durch ihr aktuelles Wissen im Mittelpunkt stand. Schnell fügte sie sich in die Zellenhierarchie ein. Der Boss war unange-fochten Moni, ein richtiges Mannweib. Deren treueste Untergebene, man musste schon fast sagen Speichel-leckerin, war Erika, genannt Eri, eine Lesbe, die Moni anhimmelte. Ob sie etwas miteinander hatten, war noch nicht zu erkennen. Es war schnell klar, dass man sich vor Eri in Acht nehmen musste. Ihr war nicht zu trauen. Sie war scheinheilig und jederzeit bereit, andere zu ver-pfeifen, um sich Vorteile zu verschaffen. Solange sie unter dem Schutz von Moni stand, war sie unantastbar, wenigstens nach außen hin. Dann gab’s noch eine Vierergruppe: Edith, Gisela, Anja und Ali, deren richtigen Namen man nicht kannte. Sie mauschelten immer unter sich, undurchsichtig, man wusste nicht, was man von ihnen halten sollte. Die zwei Stockbettbewohnerinnen über Rosa, Tamara und Anni waren eigentlich ganz nett. Rosa vermutete, dass sie lesbisch waren. Zumindest hier im Gefängnis. Vielleicht ergab sich das so.
Im Großen und Ganzen war Rosa zufrieden. Zwei blut-junge Mädchen befanden sich auch darunter. Eine sah aus wie eine Prostituierte, die andere sah aus, als könnte sie nicht bis auf drei zählen. Die Älteste, Frieda, war fünfundsechzig Jahre alt und saß schon vier Jahre. Sie hatte ihren Mann vergiftet, um ihn und wohl auch sich, von dem schon seit vielen Jahren anhaltenden Leid zu erlösen. Ihr Mann hatte einen schweren Betriebsunfall im Bergbau erlitten und lag schon seit drei Jahren im Wachkoma. Für die Frau war es sehr schlimm. Bestimmt hatte sie noch nie in ihrem Leben Unrecht begangen. Diese Tat aus Hoffnungslosigkeit, und auch mit Ein-willigung ihrer sonstigen Angehörigen, konnte jeder verstehen und verzeihen, nur eben der Staat nicht. Sie genoss den Schutz ihrer Mithäftlinge. Das half ihr etwas, die schwere Zeit zu ertragen.
Was die anderen alle auf dem Kerbholz hatten, erfuhr Rosa erst nach und nach. Es war für sie aber ein Schock. Mit fünf Mörderinnen in einem engen Raum zu leben, Tag und Nacht! Es gruselte sie etwas.
Da fiel ihr aber ein, sie war, beziehungsweise galt ja auch als Mörderin. Wie schnell dies gehen konnte. Sie fühlte sich aber keineswegs als Mörderin. Wer weiß, wie es den anderen ergangen war. Es stand ihr somit nicht zu, die anderen zu verurteilen. Außerdem waren zwei Beischlaf-räuberinnen dabei, die Gisela und Ulla. Dann Anja, eine Fluchthelferin. Ali und Tamara, zwei Diebinnen, und Anni, eine Kindesentführerin.
Anja zeigte sich sichtlich erfreut, dass Rosa eine „Politische“ war. Dazu zählten alle Straftaten, die gegen den Staat gerichtet waren. Sie hatten es in der Ge-meinschaft und auch beim Aufsichtspersonal am schwersten. Von den größten Übeltätern, den „richtigen“ Mörderinnen, wurden sie am meisten gepiesackt. Man wusste, dass Auswüchse gegen „Politische“ großzügig übersehen wurden. Die Häftlinge konnten so ihren Frust und Zorn an jemandem abreagieren, ohne selbst Probleme zu bekommen. Vielleicht bewusst, erhielten Schwerverbrecherinnen bevorzugte Posten, wie Kal-faktor, auch Verwahrraumaufsicht, wie bei ihnen, und vieles mehr. Das hatte verschiedene Gründe: Die Bevorzugten übernahmen mit Freude die Schikanen gegenüber den anderen, und die Wächterinnen mussten sich nicht selbst die Hände schmutzig machen. Als Nebeneffekt besänftigte man so auch die brutalen Gemüter.
Rosa bemühte sich, so gut es ging, sich zu fügen. Mit Anja verband sie bald eine enge Freundschaft. Anja war Lehrerin, und so fanden sie für ihre Unterhaltung gegen-seitig geistreichere Themen als die breite Masse. Erst mit der Zeit gewöhnte sich Rosa daran, dass sie sich nicht verächtlich abwenden oder ihre Ohren zuzuhalten durfte, wenn die Gespräche in der Zelle unterstes Niveau erreichten. Man konnte meinen, dass die Frauen wirklich nur noch an eines dachten und genüsslich schilderten, was man eigentlich den Männern zuschrieb. Wenn nachts die Lichter ausgingen, wurde es überall lebhaft: Über die Wasserleitungsrohre wurden durch Klopf-zeichen mithilfe des „Gefängnisalphabets“ Informationen ausgetauscht. Verschiedene Bettinsassinnen huschten aber auch des Nachts unter andere Bettdecken. In der ersten Stunde der Nacht gab es keinen Schlaf, zumindest anfangs nicht, aber man gewöhnt sich mit der Zeit an vieles.
‚Oh je, wenn das so die ganze Zeit geht…’
Die Monate gingen dahin. Zunächst wunderte sich Rosa, dass sie nicht mehr zum „Friseur“ geholt wurde, um ihre nach und nach länger werdende Haare wieder auf Glatzenniveau abzurasieren. Sie konnte sich keinen Reim darauf machen. Ihre Kolleginnen bemerkten über-rascht, dass sie ein Rotschopf war. Verschiedene Hänseleien musste sie deshalb über sich ergehen lassen, aber das nahm sie gerne in Kauf. Ihre Hoffnung bestand darin, dass sie ihr Kind austragen durfte. Was dann anschließend geschehen würde, stand in den Ster-nen.
Aber ihre Kolleginnen erkannten auch, dass sie schwanger war. Das brachte ihr dann unerwartet den Vorteil, dass der Umgang mit ihr doch etwas umsichtiger wurde. Das Miterleben der Entwicklung einer werdenden Mutter war ja nichts Alltägliches im Knast. Es ging so weit, dass man von „unserem Kind“ sprach.
Und noch eine Veränderung trat ein: Rosa wurde den Arbeitskommandos zugeteilt. Mit der Arbeit vergingen die Tage natürlich schneller. Infolge ihrer mangelhaften Ernährung, sowohl was die Vitaminhaltigkeit anbelangte als auch die Kalorienmengen, war dies aber kein Zucker-schlecken. Die Produktionsnormen waren sehr hoch an-gesetzt. So bot sie jetzt wieder Angriffsfläche für Maßregelungen wegen ungenügender Pflichterfüllung. Auf ihre Schwangerschaft wollte man keine Rücksicht nehmen, vorerst wenigstens nicht. Die Kommando-führerin war eine rüde primitive Person, die im Suff ihren ebenfalls besoffenen Vater erschlagen hatte. Wie gemunkelt wurde, hatte sie der Vater schon als Kind missbraucht, mit ihr sogar ein Kind gezeugt und sie dann irgendwann auf den Strich geschickt. Dass sich da kein zart besaiteter Mensch entwickeln konnte, war klar. Den Mithäftlingen nützte dieses Verständnis aber nichts, sie waren die Leidtragenden und mussten die Brutalität ertragen. Rosa, als „Politische“, kam ihr da gerade recht. Es galt für die ganze Gruppe, die geforderten Arbeits-normen zu erfüllen. Bei Nichteinhaltung wurde schließlich auch die Kommandoführerin in die Pflicht genommen. Rosa war, bedingt durch ihre Schwangerschaft, immer wieder Brechattacken ausgesetzt, einhergehend mit Unwohlsein und Schwindelgefühlen. Verständnis für ihre Lage hatte man nicht. Sie war ein Hemmschuh, nur störend in der Arbeitsgemeinschaft. Außer ihren Zellengenossinnen hatte niemand Erbarmen mit ihr. Man zwang sie dann in ihrer freien Zeit, ihre Stückzahlen aufzubessern. Da ging dann mancher Samstag oder auch Sonntag drauf. Natürlich konnte das nicht lange gut gehen. Die schweren Metallteile, die sie bewegen musste, überforderten ihre Kräfte total. Es kam wie es kommen musste: Sie brach zusammen. Heftige Unterleibsblutungen traten ein.
Glücklicherweise wurde sie rechtzeitig von einer Wachmeisterin gefunden, die übrigens von den Häft-lingen abfällig „Wachteln“ genannt wurden. Zuerst ließ diese sie in ihre Zelle bringen. Als aber die Blutungen nicht aufhörten und ihr Zustand sich nicht verbesserte, wurde die stellvertretende Anstaltsleiterin hinzugezogen. Die Verantwortung für eine eskalierende Entwicklung war dieser aber zu groß, und da Rosa schwanger war, ließ sie diese auf die spezielle Krankenstation bringen.
Als Rosa am nächsten Tag registrierte, wo sie sich befand, atmete sie erstmal auf.
Von dem ehrlich besorgten Arzt, Major P., erfuhr sie, dass man sie und ihr Kind nur mit großer Mühe und Glück retten konnte. Rosa war unendlich dankbar und erleichtert. Befreit von der momentanen Stresssituation, verfiel sie in tiefen Schlaf, der einundzwanzig Stunden dauerte.
Vor ihrer Entlassung aus dem Krankenrevier besprach sie sich noch eingehend mit dem verständnisvollen Arzt. Dieser riet ihr, einen offiziellen Brief an die Anstalts-leitung, Major V., zu schreiben. Dieser würde ohnehin den ärztlichen Befund bekommen. Also dürfte sie ruhig darauf hinweisen.
Schlimm war es für Rosa, dass sie keinerlei Post von draußen und auch keinen Besuch erhielt. Was mit ihren Eltern war, wusste sie nicht. Wahrscheinlich wurden sie gar nicht mal benachrichtigt, dass ihre Tochter hier einsitzt. Sie hatte keine Ahnung.
Als sie dann aber erfuhr, dass alle Päckchen, ob zugeschickt oder am Besuchstag mitgebracht, kontrolliert und dabei vielerlei Dinge entnommen wurden, fragte sie sich, was besser war. Sie hatte sich damit abgefunden, dass sie von der Außenwelt vollkommen isoliert war. Diejenigen, die ihre gefilzten Pakete erhielten, waren so dermaßen empört, dass ihnen die ganze Freude darüber vermiest war. Die besten Dinge wurden entwendet, und zwar nicht nur eine Stichprobe, um vielleicht die Echtheit oder darin versteckte Dinge zu überprüfen, sondern es standen tatsächlich niedrigere Beweggründe dahinter. Wenn eine Schachtel mit zehn Keksen dabei war, ließ man zwei davon übrig.
Ja, die Ärmsten der Armen beutete man auch noch aus. Wie bei dem Lohn, den sie für ihre Schinderei erhielten, der war so kärglich bemessen, dass man dies nur als pure Ausbeuterei bezeichnen konnte. Manche Häftlinge mussten sogar zwei Schichten arbeiten. Von dem Hungerlohn von dreißig bis vierzig Mark im Monat mussten sie ihre Körperpflege- oder ein bisschen Kosmetikartikel kaufen. Wenn man Glück hatte, reichte es vielleicht auch einmal für Luxus-Artikel wie Kekse oder eine sonstige Schleckerei. Von ihrer Gefängnis-verpflegung waren sie alle unter- und mangelernährt. Für sie als Frauen war dieser Zustand sehr entwürdigend. Hart war für sie, dass kaum eine Möglichkeit bestand, sich etwas hübsch zu machen. Wagte mal eine, irgend-einen Gegenstand zu einer Art Schmuck umzu-funktionieren, um ihn als Spange ins Haar zu stecken, wurde er von den „Wachteln“ mit Genuss herunter-gerissen. Einer Mitgefangenen wurden selbst hergestellte Ohrringe brutal aus den Ohren gerissen, sodass ihre Ohren dabei aufgeschlitzt wurden und sie stark blutete. Aber Not macht ja bekanntlich erfinderisch: So kam man beispielsweise auf die Idee, Wachs oder Fette von den Maschinen als Rouge zu verwenden oder mit einem Stift die Augenlieder nachzuziehen. Mit Wonne fielen die „Wachteln“ über so eine Übeltäterin her. Mit eiskaltem Wasser, warmes gab es ja ohnehin nicht, musste die Ertappte alles herunter rubbeln.
Ihnen wurde permanent vor Augen geführt, dass sie der letzte Dreck waren.
Rosas Bauch nahm schon ganz schöne Formen an. Der fünfte Monat, sechste, siebte. Die geforderten Tätigkeiten zu bewerkstelligen, bereitete immer größere Anstren-gungen. Auf den Brief, den sie auf Anraten des Arztes an die Gefängnisleitung geschrieben hatte, kam keine Reaktion. Er trug ihr nur hinterher manch zynische und boshafte Bemerkungen ein, was sie als Reaktion auf den Brief wertete. Das Einzige, was ihr bisher nicht widerfuhr, war, dass sie physisch misshandelt wurde, abgesehen von groben Stößen mit dem Gummiknüppel, aber das zählte man schon nicht mehr als Misshandlung. Ob das aus Rücksicht auf ihren Zustand geschah, wusste sie nicht. Es gab Insassinnen, die wurden total zusam-mengeschlagen, so dass sie liegen blieben. Über die Misshandlung reden durfte man aber auf keinen Fall, man war eben irgendwo die Treppen „hinuntergefallen“.
Rosas Schmerzen im Unterleib häuften sich. Ab und zu bekam sie auch Blutungen. Sie war ihren Zellen-genossinnen für ihre Anteilnahme dankbar, die sich jetzt, so gut es ging, um sie Sorgen machten und sich um sie bemühten. Ab und zu steckte eine ihr irgendetwas von ihren Geschenkpäckchen zu.
Alle, außer Eri, atmeten auf, als Moni, die Verwahr-raumälteste, aus der Zelle verlegt wurde. Man munkelte, dass man sie in den Westen verkauft hatte.
Was mit den sonstigen Todeskandidaten geschehen sollte, wusste man nicht.
In diesen Jahren wurden übrigens keine Todesurteile mehr vollstreckt, es wurde sogar auf internationalen Druck die Todesstrafe abgeschafft.
Dies wussten die zu Tode Verurteilten aber nicht. Und so hatte Rosa ihr Todesurteil auch noch immer im Hinterkopf.
Was würde also sein, nachdem ihr Kind geboren wurde?
Wie würde sie mit ihm leben, es stillen, pflegen, erziehen?
Wie würde es aufwachsen?
Aber sie machte sich wohl unnötige Gedanken, da der „gute Staat“ ja für seine Mitbürger sorgte!
Im Arbeiter- und Bauernstaat war die Volksvertretung doch nur dazu da, um für jeden Mitbürger das Allerbeste zu ermöglichen (!).
Und dann war es soweit: Die Wehen setzten ein.
Es war aber erst Mitte des siebten Monats. Das konnte doch nicht sein, das sollte nicht, das durfte nicht sein. Nur keine Frühgeburt! Zwei Tage später wieder das Gleiche, diesmal länger anhaltend. Zuerst wollte Rosa es verheimlichen, aber irgendwann konnte sie es nicht mehr vor ihren Genossinnen verbergen. Die waren gleich ganz aufgeregt. Frieda, die jetzt Sprecherin war, wollte kein Risiko eingehen und alarmierte gleich eine dienst-habende „Wachtel“.
„A, nu, was isn jetz schon wieder. Mit euch hat man stän-dig Ärger. Jetzt ist Feierabnd und Ruhe, sonst gibt’s was!“
Für Rosa wurde es eine lange Nacht. Immer wieder bekam sie Wehen, die Abstände verringerten sich. Mor-gens war Rosa nicht mehr fähig aufzustehen. Die Blutungen hatten sich verstärkt. Beim Zählappell wurde es der jetzt diensthabenden „Wachtel“ zu bunt und sie riss Rosa erbarmungslos am Arm aus dem Bett.
„Ufstehn, du faules Luder, dir werd ick helfn“, schon schwang sie den Gummiknüppel. Tamara fiel ihr in den Arm:
„Sehn Se nich, wat mit ihr los ist. Sie sind ja een Unmensch.“ Wutentbrannt drehte sich die „Wachtel“ um:
„Det wird für euch noch een Nachspiel ham.“
Nach drei Minuten stand aber schon ein Sanitäter da. Die Wachtmeisterin hatte also doch reagiert, wollte es nur vor den anderen nicht zugeben. Jetzt ging alles schnell. Kurz darauf erschien eine zweite Sanitäterin mit einer Bahre. Sie transportierten Rosa im Eilschritt durch die Gänge. Der Vorfall blieb natürlich nicht unbemerkt, und so setzte in kurzer Zeit ein lautstarker Tumult ein. Mit allen er-denklichen Gegenständen wurde gegen Metallteile wie Heizungsrohre, Zellentüren und so weiter geschlagen, begleitet von aufgebrachten Schmährufen: „Ihr Schweine, Menschenschinder“ und dergleichen. Die anderen Zelleninsassen dachten wohl, dass da eine Leidensgefährtin misshandelt worden war. Solche Anlässe entzündeten sich wie ein Funken und breiteten sich blitzartig im gesamten Bau aus. Wenn sich alle beteiligen, war die Gefahr der Bestrafung am geringsten, da man ja kaum alle bestrafen konnte. Zur Folge hätte dies in der Regel drei Tage Wasserzelle, Züchtigung mit dem Gummiknüppel oder Ähnliches. Dass sie am Folgetag nur kalten „Muckefuck“ bekamen und der zwan-zigminütige Freigang gestrichen wurde, nahmen sie in Kauf: So eine kleine Rebellion verschaffte dem Herzen wieder etwas Luft.
Rosa bekam gar nicht mehr viel mit. Mit der letzten verbleibenden Kraft überstand sie die Anstrengungen der Geburt. Ob sie nach Stunden noch die ersten Schreie ihres Kindes miterlebte, ist fraglich.
Dass sie am nächsten Tage wieder die Augen öffnete, grenzte an ein Wunder.
Sie war der Welt so weit entrückt. Was war denn geschehen?
„Mein Kind? - Wie geht es ihm? - Wo ist es? – Kann ich es sehen?“
„Nur ruhig junge Frau, jetzt ruhn Se sich erst mal aus.“
So wurde sie vertröstet.
Wieder Schlaf.
Aber dann mit mehr Nachdruck:
„Ich will endlich mein Kind sehen!“
„Das geht jetzt noch nicht, es war ja eine Frühgeburt. Wir können es Ihnen noch nicht bringen, es ist zu riskant. Es liegt sowieso im Brutkasten.“
So wurde Rosa von Tag zu Tag hingehalten.
Resigniert fügte sie sich in ihre Machtlosigkeit. Eine tiefe Depression überfiel sie. Im Innern hatte sie immer ge-hofft, dass ihr mit dem Kind ein einigermaßen menschen-gerechtes Dasein ermöglicht werden würde. Diese Hoffnung zerplatzte aber wie eine Seifenblase.
Nach drei Tagen wurde sie wieder in ihre Zelle verlegt. Alle waren zuerst hocherfreut, als sie von der über-standenen, gelungenen Geburt erfuhren. Wie üblich kamen die dringendsten Fragen:
„Was ist es? Junge oder Mädel? Wie groß? Wie schwer? Hast du schon einen Namen?“
Rosa konnte nur weinen und schluchzend stammeln, dass ihr jeglicher Kontakt mit dem Kind verwehrt wurde.
Rosa befand sich wieder auf dem Tiefpunkt. Ihre Gedanken kreisten nur noch darum, eine Möglichkeit zu finden, ihrem Leben ein Ende zu setzen.