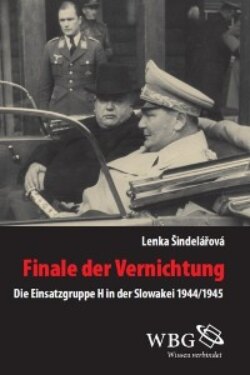Читать книгу Finale der Vernichtung - Lenka Sindelarova - Страница 11
1.1. Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD
ОглавлениеDie Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD waren spezielle mobile Einheiten, die in den annektierten oder okkupierten Gebieten für die „Gegnerbekämpfung“ zuständig waren. Sie gingen gegen alle Personen vor, die zu Feinden des Nationalsozialismus erklärt worden waren.1 Sie waren ein neues Instrument staatspolizeilichen Vorgehens, dessen Aufgabe in der „Bekämpfung aller reichs- und deutschfeindlichen Elemente in Feindesland rückwärts der fechtenden Truppe“ bestand.2 Sie agierten parallel zum militärischen Vormarsch, indem sie möglichst dicht hinter der Wehrmacht nachrückten. Sie wurden mit der Überwachung des politischen Lebens und der Sicherstellung von staatlichen Akten beauftragt; ihr vorrangiges Ziel war jedoch die Ermittlung und Ermordung von tatsächlichen oder vermeintlichen Gegnern des NS-Regimes. Angehörige der Einsatzgruppen waren direkt an der massenhaften Ermordung von Zivilisten (insbesondere von Juden) beteiligt, und viele von ihnen wirkten eigenhändig an Massenerschießungen mit. Nach Mallmann waren die Einsatzgruppen „im Koordinatensystem von Vernichtungskrieg und Holocaust die effektivste Mordwaffe vor der Erfindung der Todeslager mit ihrer Kulmination in Auschwitz.“3
Die Einsatzgruppen setzten sich aus Einsatz-, Sonder- oder z.b.V.-Kommandos zusammen, die sich weiter in Teilkommandos (sogenannte Stützpunkte) untergliederten. Sie unterstanden dem RSHA, dem sie zu berichten hatten und von dem sie Befehle und Anordnungen bekamen. Das Amt I des RSHA war für die personelle Zusammenstellung dieser speziellen Einheiten verantwortlich. Für die höheren Posten wurden für Heydrich bzw. Himmler besondere Listen erstellt, anhand derer sie dann die Einsatzgruppenführer und die Führer der einzelnen Kommandos auswählten. Für die übrigen Angehörigen gab es in der Regel keine förmlichen Richtlinien. Aus den regionalen Gestapo-, Kripo- und SD-Dienststellen wurden geeignete Männer herausgesucht und zum Einsatz abgeordnet.4 Hinzu kamen zumeist Angehörige der Ordnungspolizei und der Waffen-SS sowie eine beachtliche Gruppe an Hilfspersonal (Kraftfahrer, Dolmetscher, Funker etc.). Unterstützung gewährte im Notfall die Wehrmacht, häufiger die im Einsatzgebiet lebenden Volksdeutschen und einheimischen Kollaborateure.
Beim Führungspersonal der Einsatzgruppen handelte es sich keineswegs um eine Negativauslese. Der Einsatzbefehl ist nicht – wie Wildt in seiner Studie richtig herausstellt – als eine Strafmaßnahme zu verstehen: „In Bezug auf die geforderten Fähigkeiten wie Durchsetzungsvermögen und Verhandlungsgeschick gegenüber den Wehrmachtsstellen, Selbständigkeit in der Entscheidung, wie die zentralen Richtlinien vor Ort umgesetzt werden konnten, und Improvisationsvermögen angesichts nicht zu übersehender Schwierigkeiten und Probleme waren Himmler, Heydrich und die RSHA-Führung mit Sicherheit bemüht, erfahrene und in ihren Augen ausgezeichnete Männer für diese Aufgaben zusammenzustellen.“5 Die Befehle aus Berlin enthielten ein hohes Maß an Auslegungsspielraum. Wer als „Partisan“, „Funktionär“, „Kommissar“ oder „Plünderer“ zu bezeichnen war, mussten die Männer vor Ort entscheiden.6
Nach der Besetzung eines Gebietes wurden die mobilen Einheiten meistens in stationäre Dienststellen des BdS und des KdS umgewandelt. Das Personal der Einsatzgruppen verblieb in der Regel am Ort und wurde diesen neu geschaffenen Stellen zugeteilt. Die tatsächliche Auflösung der Kommandos bzw. der aus ihnen entstandenen Dienststellen kam oft erst mit dem kriegsbedingten Rückzug der deutschen Truppen aus dem besetzten Gebiet. Die Männer wurden entweder zu ihren Heimatdienststellen zurückbeordnet oder blieben weiter im Einsatz und wurden zu anderen Kommandos oder Dienststellen im deutschen Herrschaftsbereich abkommandiert. Zurück blieben ihre Opfer. Die Tätigkeit der Einsatzgruppen ist folglich am besten an deren Zahl zu dokumentieren; die Angaben variieren zwischen 850.000 und 1.300.000 Ermordeten.7 Den überwiegenden Teil der Getöteten bildeten die durch die Angehörigen der Einsatzgruppen und ihre Helfer erschossenen Juden in der Sowjetunion.
Doch nicht nur in der Sowjetunion wirkten die Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD. Sie bzw. einzelne Kommandos kamen überall in Europa zum Einsatz. Das erste Einsatzkommando wurde bereits im März 1938 aufgestellt und nach Österreich geschickt, um dort im Zuge des „Anschlusses“ einen schnellen Zugriff auf alle „reichsfeindlichen Elemente“ zu gewinnen. Die Sicherheitspolizei (Gestapo und Kriminalpolizei) und der SD agierten noch institutionell weitgehend getrennt, wobei die Aufgabe der Sipo in systematischen Verhaftungen von Emigranten, politischen und kirchlichen Gegnern sowie Juden bestand, während dem SD die Erfassung und Auswertung des staatspolizeilich relevanten Informationsmaterials des Gegners oblag.8 Mit den gleichen Aufgaben wurden auch die Einsatzgruppen betraut, die bei der Besetzung des tschechoslowakischen Grenzgebietes Anfang Oktober 1938 (Einsatzgruppe Dresden und Einsatzgruppe Wien) bzw. bei der Errichtung des Protektorats Böhmen und Mähren Mitte März 1939 (Einsatzgruppe I mit Sitz in Prag und Einsatzgruppe II mit Sitz in Brünn) eingesetzt wurden. Nach Abschluss der militärischen Operationen verwandelten sich die mobilen Einheiten auf dem besetzten Gebiet in stationäre Dienststellen. Mit den späteren Einsatzgruppen hatten diese Formationen allerdings fast nur den Namen gemein; zur späteren Radikalisierung kam es erst bei Kriegsausbruch.9
Kurz nach dem militärischen Angriff auf Polen überschritten im Rücken der Wehrmacht auch sicherheitspolizeiliche Einheiten die Grenze. Es waren dies die hierzu speziell aufgestellten Einsatzgruppen I bis V, die jeweils aus zwei bis vier Einsatzkommandos mit bis zu je 150 Mann bestanden. Am 3. September 1939 wurde eine zusätzliche Einsatzgruppe z.b.V. mit vier Polizeibataillonen und einem sicherheitspolizeilichen Sonderkommando in Stärke von 350 Mann gebildet sowie in der zweiten Septemberwoche die Einsatzgruppe VI und das Einsatzkommando 16. Diese Einheiten, die offiziell dem Heer unterstellt waren, aber dennoch direkte Befehle von Himmler bekamen, spannten ein breites Netz über das gesamte besetzte Gebiet, sodass fast jede größere polnische Ortschaft in den Operationsgebieten der Einsatzgruppen lag. Dort ermordeten sie Intellektuelle, Angehörige des katholischen Klerus und Juden, organisierten die systematische Vertreibung der Juden aus den an das Reich angegliederten polnischen Westgebieten und brachten sie in die Ghettos im Generalgouvernement. Es kam zu willkürlichen Erschießungen, Plünderungen und Ausschreitungen gegen die Zivilbevölkerung, wobei die Zahl der Opfer nicht genau festzustellen ist, auf jeden Fall aber „deutlich im fünfstelligen Bereich“ liegen dürfte.10 Nach ungefähr einem Monat im Einsatz erreichten die einzelnen Kommandos ihre Zielorte und wurden zu stationären Dienststellen umgewandelt. Die offizielle Auflösung der Einsatzgruppen erfolgte am 20. November 1939. Ihre Bedeutung fasst Wildt wie folgt zusammen: „Der ‚Einsatz‘ in Polen markierte ohne Zweifel eine Zäsur. Die Praxis der Einsatzgruppen […] überstieg bei weitem den Terror, den diese Männer zuvor als Stapostellenleiter oder SD-Führer praktiziert hatten. Im Herbst 1939 führten die Einsatzkommandos Exekutionen in einem Umfang und in einer Weise durch, die bereits an die späteren Massenerschießungen in den besetzten sowjetischen Gebieten erinnern. In Polen lernten etliche SS-Führer […] in ‚großen Räumen‘ zu denken und zivilisatorische Schranken zu überschreiten.“11 Sie waren laut Mallmann „die Weichensteller auf dem Weg in den Rassen- und Vernichtungskrieg“.12
Dieser Vernichtungskrieg erreichte seinen Höhepunkt in der Sowjetunion. Als am 22. Juni 1941 der Angriff deutscher Truppen begann, folgten diesen vier Einsatzgruppen mit etwa 3000 Mann, die seit Mai in der Grenzpolizeischule Pretzsch und den umliegenden Orten Bad Düben und Bad Schmiedeberg ausgebildet und anschließend auf die vier Gruppen aufgeteilt worden waren. Die Einsatzgruppe A (Sonderkommando 1a, Sonderkommando 1b, Einsatzkommando 2 und Einsatzkommando 3) unter Walter Stahlecker schloss sich der Heeresgruppe Nord an und war für das Gebiet des Baltikums zuständig, die Einsatzgruppe B (Sonderkommando 7a, Sonderkommando 7b, Einsatzkommando 8, Einsatzkommando 9 und Vorkommando Moskau) mit Arthur Nebe an der Spitze folgte der Heeresgruppe Mitte nach Weißrussland, der Heeresgruppe Süd wurde für die nördliche und mittlere Ukraine die Einsatzgruppe C (Sonderkommando 4a, Sonderkommando 4b, Einsatzkommando 5 und Einsatzkommando 6) mit Otto Rasch zugeteilt, und in das Gebiet südliche Ukraine, Bessarabien, Halbinsel Krim und Kaukasien rückte mit der 11. Armee die Einsatzgruppe D (Sonderkommando 10a, Sonderkommando 10b, Sonderkommando 11a, Sonderkommando 11b und Einsatzkommando 12) unter Otto Ohlendorf ein.13 Im Laufe der Zeit wurden auch hier die mobilen Einheiten in stationäre Dienststellen umgewandelt, je nachdem wie schnell das Gebiet besetzt und die Lage aus deutscher Sicht stabilisiert werden konnte. Das Personal der Einsatzgruppen war äußerst heterogen. Für die Einsatzgruppe A gibt es eine genaue Aufstellung; die insgesamt 990 Mann starke Gruppe (464 Mann im Stab, der Rest auf die vier Kommandos verteilt) setzte sich wie folgt zusammen: 340 Waffen-SS-Angehörige, 172 Kraftfahrer, 133 Ordnungspolizisten, 93 Dolmetscher, Verwaltungsfachleute, Sekretärinnen, Funker und Fernschreiber, 89 Gestapo-Angehörige, 87 Hilfspolizisten, 41 Kriminalpolizisten und 35 SD-Angehörige.14 Angehörige der Sicherheitspolizei und des SD waren hiernach nicht einmal 17 Prozent des gesamten Personals.
Die Aufgabe, mit der die Einsatzgruppen in die Sowjetunion einmarschierten, bestand in der Ermordung der politischen, sozialen und kulturellen Führungsschicht der Sowjetunion, insbesondere aller Juden in höheren Partei- und Staatspositionen. Kurz darauf wurde diese Vorgabe auf alle wehrfähigen jüdischen Männer ausgeweitet und im Juli 1941, spätestens im August gingen die Einsatzgruppen dazu über, systematisch auch Frauen und Kinder zu erschießen.15 Ogorreck zufolge wurde den Einsatzgruppen der „Judentötungsbefehl“, also der Befehl zur Ermordung aller jüdischen Bewohner in der Sowjetunion, im August 1941 erteilt.16 Auch Mallmann geht davon aus, dass der „Endlösungsbefehl“ vor dem Abmarsch aus Pretzsch „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ noch nicht erteilt worden war.17
Die Erschießungen hatten in der Regel ein ähnliches Ablaufschema. Nach der Festnahme wurden die Opfer außerhalb der Ortschaften zu einem abgesperrten Erschießungsort gebracht, wo sie sich nackt ausziehen, ihre Wertsachen abgeben und manchmal sich selbst ein Grab ausheben mussten. Dann hatten sie sich nacheinander vor dem Grab aufzustellen oder hineinzulegen und wurden erschossen. Meistens fanden die Erschießungen in Panzergräben, Steinbrüchen, Schluchten oder an ähnlichen Plätzen statt, die dann leicht mit Erde zugedeckt werden konnten. Danach wurde Schnaps und Essen gereicht, und es musste Meldung erstattet werden. Unterstützung bei diesen Aktionen kam einerseits von Einheimischen, andererseits von anderen bewaffneten Formationen aus dem Reich, meistens von den Polizeibataillonen, nicht selten von der Wehrmacht. Deutsche Militärangehörige hatten sich seit dem Angriff auf Polen zu „Komplizen und aktiven Teilnehmern an Hitlers Neuordnung Europas entwickelt“.18 Nicht Konfrontation zwischen dem Heer und den Einsatzgruppen, sondern Arbeitsteilung untereinander bestimmte das gegenseitige Verhältnis. Auch wenn die Zahl der Opfer in der Sowjetunion nicht genau zu ermitteln ist, wird deutlich, dass das Jahr 1941 für die Einsatzgruppen „den endgültigen Übergang von der Menschenjagd zum Massenmord, vom Eroberungs- zum Weltanschauungs- und Vernichtungskrieg“ bedeutete.19
Neben den Einsatzgruppen in der Sowjetunion, die zweifellos für die meisten Ermordungen verantwortlich waren, und denen in Polen wurden während des Krieges Einheiten der Sicherheitspolizei und des SD überall in Europa tätig. So kam es 1940 zur Aufstellung mobiler Einheiten für die Unterstützung der deutschen Offensive im westlichen und nördlichen Europa, deren Personal sich zumeist aus den jeweils grenznahen Stapo- und SD-Stellen rekrutierte.20 Für die Niederlande war die Einsatzgruppe I zuständig, für Lothringen die Einsatzgruppe II und für das Elsass die Einsatzgruppe III. Bereits im Sommer 1940 wurden alle in stationäre Dienststellen der BdS mit Sitz in Den Haag, Metz bzw. Straßburg umgewandelt. In Norwegen war seit April 1940 eine Einsatzgruppe mit sechs Einsatzkommandos tätig, während in Frankreich und Belgien lediglich zwei Einsatzkommandos z.b.V. mit ungefähr 25 Beamten zum Einsatz kamen, in Luxemburg wiederum ein Einsatzkommando mit annähernd 80 Mann. Im Falle Großbritanniens blieb es wegen des Scheiterns des Unternehmens „Seelöwe“ letztendlich nur bei der Planung. Aktiv wurde hingegen im Sommer 1941 ein Einsatzkommando im Norden Finnlands, das bis Ende 1942 bestand.21 Im Juli 1942 bildete sich außerdem ein Einsatzkommando bei der Panzerarmee Afrika, das in Erwartung eines siegreichen Vormarsches nach Ägypten und Palästina mit der „Judenfrage“ im Nahen Osten beauftragt wurde. Da die Panzerarmee aber zum Rückzug gezwungen wurde, kam das Kommando nicht zu seiner dort anvisierten Tätigkeit und wurde später nach Tunis bzw. Korsika verlegt.22
Auch in Südosteuropa gab es mobile Einheiten des RSHA. Wichtig ist, dass in den Richtlinien für die Einsatzgruppen in Griechenland und Jugoslawien von Anfang April 1941 neben „Emigranten, Saboteuren, Terroristen“ erstmals auch „Kommunisten und Juden“ als Gegner explizit erwähnt wurden.23 Die Einsatzgruppe Griechenland hatte zwar 1941 noch wegen Personalnot einen eher geringen Einfluss, konnte diesen aber 1943, als Massendeportationen von griechischen Juden bewältigt werden mussten, deutlich steigern. In Jugoslawien etablierte sich eine Einsatzgruppe im April 1941 in Belgrad. Zunächst dem Militärbefehlshaber Serbien unterstellt, wurde sie Anfang 1942 in eine separate BdS/KdS-Struktur unter einem Höheren SS- und Polizeiführer (HSSPF) eingebunden und war als wichtigster Akteur an der Ermordung serbischer Juden beteiligt. In Kroatien kam die Einsatzgruppe E zum Einsatz, die aus mehreren Kommandos bestand und neben der Partisanenbekämpfung vor allem für die Deportation der dortigen Juden verantwortlich war. Im März 1944 wurde in Mauthausen die Einsatzgruppe F aufgestellt, die sieben Einsatzkommandos und ein Sonderkommando mit Adolf Eichmann an der Spitze hatte und für den Einsatz in Ungarn bestimmt war. In den folgenden sechs Monaten wurden unter Mithilfe der einheimischen Gendarmerie mehr als 400.000 ungarische Juden nach Auschwitz deportiert, wobei der überwiegende Teil von ihnen gleich nach der Ankunft vergast wurde. Die Einsatzgruppe G, die im Juli 1944 in Rumänien für den Einsatz in den siebenbürgischen Karpaten gebildet worden war, musste sich nach dem Sturz des Antonescu-Regimes im August 1944 nach Ungarn zurückziehen und wurde anschließend dem dortigen BdS unterstellt.
Im Sommer 1944 wurden weitere Kommandos aufgestellt, so zum Beispiel im August ein hauptsächlich aus Volksdeutschen bestehendes Einsatzkommando z.b.V. in Kärnten und in der Oberkrain sowie im selben Monat eines, das sich vornehmlich aus Angehörigen verschiedener KdS-Dienststellen im Generalgouvernement zusammensetzte und bei der Niederschlagung des Warschauer Aufstands zum Einsatz kam. Im September war die z.b.V.-Gruppe Iltis mit zwei Kommandos, die überwiegend aus den ehemaligen Angehörigen des Sonderkommandos 1005 inklusive seines Führers Paul Blobel bestand, in den slowenischen Hochalpen tätig. Zu dieser Zeit entstanden zudem mehr als 40 z.b.V.-Kommandos, deren Personal sich in der Regel aus den Angehörigen der im Osten sowie im Westen im Zuge des Rückzugs der Wehrmacht aufgelösten Dienststellen rekrutierte. Im Dezember 1944 wurden darüber hinaus noch für die deutsche Offensive in den Ardennen die Einsatzgruppen K und L aufgestellt, wobei die erste aus Euskirchen in den nördlichen Abschnitt vorstieß und die andere aus Cochem in den südlichen Abschnitt einrückte. Da die Offensive jedoch kurz darauf scheiterte, wurden beide Einsatzgruppen Ende Januar 1945 wieder aufgelöst. Die letzten Einsatzkommandos wurden auf deutschem Boden gebildet und waren in den meisten Fällen entscheidend für die dort begangenen Verbrechen am Kriegsende verantwortlich.
Zusammenfassend muss gesagt werden, dass die Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD eines der brutalsten und zugleich ‚wirksamsten‘ Instrumente im Vernichtungskrieg des Dritten Reiches waren. Auch wenn sie mit verschiedenen Aufgaben beauftragt wurden, bestand ihr vorrangiger Zweck doch darin, die zu Feinden des NS-Regimes erklärten Personen und Personengruppen durch physische Liquidierung zu beseitigen. Angrick erklärt: „Bezüglich der Einsatzgruppen kann man […] anführen, daß im Rahmen militärischer Operationen noch nie zuvor so wenige Menschen willkürlich über das Leben so vieler anderer entschieden, sie ermordet und gequält hatten. Mochten sich die intellektuellen Köpfe dieser Einheiten – vor allem gegenüber der Nachwelt – als Nachrichtenbeschaffer, politische Funktionäre, Sicherheitsbeauftragte und weltanschauliche Soldaten des Staatsschutzes verstanden haben, so waren sie doch hauptsächlich und in erster Linie Mörder.“24