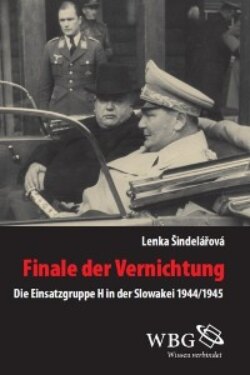Читать книгу Finale der Vernichtung - Lenka Sindelarova - Страница 9
Quellenlage
ОглавлениеAnders als es die mangelhafte Bearbeitung des Themas in der Sekundärliteratur vermuten lassen würde, kann sich eine Studie zur Einsatzgruppe H auf zahlreiche Quellenbestände stützen. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde einschlägiges Material in insgesamt 25 Archiven vor Ort gesichtet. Von deutschen Archiven waren dies die Außenstellen des Bundesarchivs in Berlin, Freiburg und Ludwigsburg, das Landesarchiv Berlin, das Politische Archiv des Auswärtigen Amtes, das Archiv des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, das Institut für Zeitgeschichte in München, die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen sowie die Staatsarchive in Hamburg, Freiburg und Oldenburg. In Tschechien wurden das Nationalarchiv, das Archiv der Sicherheitsorgane, das Militärhistorische Archiv, Staatliche Gebietsarchive in Prag und Litoměřice sowie das Archiv der Kanzlei des Präsidenten der Republik besucht, in der Slowakei das Slowakische Nationalarchiv, die Staatlichen Archive in Bratislava und Banská Bystrica sowie dort ebenso das Archiv des Museums des Slowakischen Nationalaufstands. An Ort und Stelle wurde auch Material im Wiener Stadt- und Landesarchiv, in der Zentralen österreichischen Forschungsstelle Nachkriegsjustiz sowie in London in den National Archives und in der Wiener Library genutzt.
Durch eine Reihe weiterer Archive wurden der Verfasserin zudem angeforderte Dokumente per Post zur Verfügung gestellt, so zum Beispiel durch das Hessische Hauptstaatsarchiv, das polnische Institut für Nationales Gedenken, das Archiv der Slowenischen Republik, das Depot Central d’Archives de la Justice Militaire sowie das Mährische Landesarchiv in Brünn. Weitere Archive erteilten auf Anfrage wichtige Auskünfte schriftlich. Zu diesen gehörten unter anderem die tschechischen Staatlichen Gebietsarchive in Třeboň, Pilsen und Zámrsk, das Landesarchiv in Opava, die slowakischen Staatlichen Archive in Bytča, Košice, Levoča und Prešov, das slowakische Institut für Nationales Gedenken, das Oberösterreichische Landesarchiv in Linz sowie das Steiermärkische Landesarchiv Graz. Ergänzende Informationen konnten ferner auf demselben Weg zum Beispiel auch von deutschen Standesämtern erlangt werden.
Aus dieser Übersicht geht deutlich hervor, dass umfangreiches Material zur Einsatzgruppe H vorliegt und dass dieses an vielen Orten aufbewahrt wird. Im Folgenden werden einige der wichtigsten Bestände für die vorliegende Arbeit erwähnt und kurz beschrieben. Für die Untersuchung der Tätigkeit der Einsatzgruppe H erwies sich als zentrale Quelle der Bestand R 70/Slowakei im Bundesarchiv in Berlin, der aus beinahe 400 Bänden besteht und das Schriftgut deutscher Stellen zu sämtlichen Vorgängen in der Slowakei in der Zeit von 1938 bis 1945 beinhaltet. Rund die Hälfte dieser Bände erschien relevant für das hier behandelte Thema und wurde aus diesem Grunde gesichtet. Aufschlussreiche Erkenntnisse waren insbesondere aus den regelmäßigen Tätigkeits- und Lageberichten der einzelnen Kommandos sowie aus den Berichten der Einsatzgruppe H an das RSHA oder aus den komplett erhaltenen Wochenbefehlsblättern zu gewinnen. Im Berliner Bundesarchiv gehörten zu den ergiebigsten Quellen des Weiteren die personenbezogenen Unterlagen des ehemaligen Berlin Document Center. Zu den einzelnen Angehörigen der Einsatzgruppe H wurden Akten auf mehr als 300 Mikrofilmen ausgewertet. Die wichtigsten Angaben waren hauptsächlich den selbstverfassten, handgeschriebenen Lebensläufen zu entnehmen sowie weiteren Dokumenten zu Beförderungen, Auszeichnungen oder Versetzungen der jeweiligen Person. Der Zugriff auf diese Akten war ausschließlich über die Namen und Geburtsdaten möglich. Auf Grund des Fehlens eines einschlägigen Verzeichnisses mussten die Angehörigen der Einsatzgruppe H zunächst anhand anderer Quellen identifiziert werden.
Eine weitere aussagekräftige Quelle für das Forschungsziel stellten erwartungsgemäß die Ermittlungsakten der Zentralen Stelle in Ludwigsburg dar, die an die dortige eigens errichtete Außenstelle des Bundesarchivs übergeben wurden. Auch hier musste bei der Recherche mittels der Namen der einzelnen Angehörigen der Einsatzgruppe H vorgegangen werden. Als hilfreich erwiesen sich hierbei die von der Zentralen Stelle angelegten Karteien, noch mehr aber die am Institut für Zeitgeschichte entstandene Datenbank aller seit 1945 von deutschen Staatsanwälten und Gerichten durchgeführten Verfahren zu NS-Verbrechen. Anhand dieser Datenbank konnten einerseits solche Verfahren verzeichnet werden, die die Tätigkeit der Einsatzgruppe H zum Gegenstand hatten, aber andererseits auch jene, in denen die Angehörigen der Einsatzgruppe wegen anderer NS-Verbrechen in der Bundesrepublik rechtskräftig verurteilt worden sind. Die zugehörigen Akten wurden anschließend in Ludwigsburg eingesehen, wobei aufschlussreiche Informationen insbesondere aus den Vernehmungsniederschriften, den Einstellungsverfügungen sowie gegebenenfalls aus den Anklage- und Urteilsschriften gewonnen werden konnten. Dieses Material brachte neben den Daten zu den betreffenden Personen auch gewichtige Auskünfte zur Tätigkeit der Einsatzgruppe H sowie zum Komplex der strafrechtlichen Verfolgung ihrer Angehörigen.
Bei ausgewählten Verfahren zur Einsatzgruppe H wurden zudem die Originalakten der Staatsanwaltschaften in den zuständigen Staatsarchiven gesichtet. Komplette Ermittlungsakten standen so im Verfahren gegen Pape (Staatsarchiv Oldenburg), gegen Jaskulsky (Staatsarchiv Freiburg), gegen Rabe u.a. sowie im Verfahren gegen Hersmann und das z.b.V.-Kommando 15 (beide Staatsarchiv Hamburg) zur Verfügung. Nach der Durchsicht dieser Unterlagen wurde darauf verzichtet, Originalakten anderer Staatsanwaltschaften zu weiteren Verfahren heranzuziehen, da sich das in Ludwigsburg aufbewahrte Material für den hier verfolgten Zweck als vollkommen ausreichend erwies. Wichtige Informationen konnten noch in weiteren deutschen Archiven gewonnen werden, wie zum Beispiel aus Entnazifizierungsakten im Landesarchiv Berlin, aus der Korrespondenz des Deutschen Gesandten in der Slowakei im Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes sowie aus Rechtshilfeersuchen der Tschechoslowakei im Archiv des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR.
Außer in Deutschland wurde Material zur Einsatzgruppe H in Archiven in vier weiteren Ländern gesichtet. Am ergiebigsten erwiesen sich hierbei die Quellen in tschechischen Archiven. Aufschlussreiche Informationen boten insbesondere verschiedene Unterlagen der tschechoslowakischen Ermittlungsorgane, die mit der Aufklärung der in der Kriegszeit begangenen Verbrechen betraut waren. Im Nationalarchiv in Prag konnten in den Beständen 1075/5 und 850/0/10 umfangreiche Aufstellungen gefunden werden, welche, gegliedert nach den einzelnen slowakischen Bezirken und Orten, die nach dem Ausbruch des Aufstands verübten Verbrechen dokumentieren. Ermittlungsakten zur Einsatzgruppe H finden sich auch bei der „Tschechoslowakischen Regierungskommission zur Verfolgung von nationalsozialistischen Kriegsverbrechern“ und der tschechoslowakischen „Generalprokuratur“. Obwohl diese Bestände noch nicht archivarisch aufbereitet sind, wurde der Verfasserin Einsicht gewährt. Darüber hinaus wurden im Nationalarchiv in mehreren Fonds zahlreiche Dokumente aus der Kriegszeit gesichtet, von denen insbesondere die Berichte des BdS Prag sowie die des Staatsministers im Protektorat Böhmen und Mähren hinsichtlich der Entwicklung in der Slowakei hervorzuheben sind.
Ermittlungsakten tschechoslowakischer Behörden sowie Dokumente aus der Zeit vor 1945 finden sich in Prag des Weiteren im Archiv der Sicherheitsorgane. Dort wurden mehr als 350 Bände ausgewertet, die in der Personenkartei anhand der Namen des Führungspersonals der Einsatzgruppe H ermittelt werden konnten. Besonders wertvolle Informationen wurden zum Beispiel in den Beständen 52 (Aussagen von Gestapo- und SD-Angehörigen) und 135 (Verschiedene deutsche Sicherheitsorgane) gefunden. Es handelte sich unter anderem um umfassende Vernehmungsprotokolle von Angehörigen der Einsatzgruppe H in tschechoslowakischer Haft. Im Militärhistorischen Archiv wurde wiederum der Bestand „Slowakische Armee“ durchgesehen, während im Archiv der Kanzlei des Präsidenten der Republik verschiedene Unterlagen bezüglich der Strafverfolgung von NS-Verbrechen ausgewertet wurden. In fünf Staatlichen Gebietsarchiven und zwei Landesarchiven wurden darüber hinaus in den Beständen der zuständigen Volksgerichte Recherchen zu den 100 in der vorliegenden Arbeit untersuchten SS-Führern durchgeführt.
In der Slowakei wurde einschlägiges Material im Archiv des Museums des Slowakischen Nationalaufstands in Banská Bystrica gesichtet, wobei wichtige Informationen in der Sammlung „Die Deutschen in der Slowakei 1939–1945“ gewonnen werden konnten. Im Slowakischen Nationalarchiv wiederum wurde unter anderem auf Akten des Innenministeriums zurückgegriffen, in erster Linie aber auf den Bestand „Nationalgericht“. Die umfangreichen Ermittlungsakten aus den Prozessen in den ersten Nachkriegsjahren gegen den Deutschen Befehlshaber und den Deutschen Gesandten in der Slowakei sowie gegen die slowakische Staatsführung, darunter den Staatspräsidenten, erwiesen sich als ergiebige Quelle. Des Weiteren wurden die Unterlagen einzelner slowakischer Volksgerichte aus der Zeit von 1945 bis 1948 herangezogen, die heute in sechs slowakischen Staatlichen Archiven aufbewahrt werden. In den Staatlichen Archiven in Bratislava und Banská Bystrica konnte eine größere Anzahl von Verfahren vor Ort ausgewertet werden, wobei neben denen gegen die Angehörigen der Einsatzgruppe H in vielen Fällen auch jene interessante Erkenntnisse brachten, die gegen Kollaborateure aus den Reihen von Slowaken und Volksdeutschen geführt wurden. In den übrigen vier slowakischen Staatlichen Archiven hingegen blieb die Recherche nach den 100 hier untersuchten SS-Führern nach Auskunft der Mitarbeiter des jeweiligen Archivs ergebnislos.
Unterlagen aus strafrechtlichen Verfahren zur Einsatzgruppe H wurden ferner in österreichischen Archiven bearbeitet. In der bei der Forschungsstelle Nachkriegsjustiz in Wien entstehenden Datenbank, in der zukünftig sämtliche von österreichischen Volksgerichten durchgeführten Verfahren erfasst werden sollen, konnten wichtige Hinweise zu einzelnen Beschuldigten ermittelt werden. Die einschlägigen Akten waren anschließend entweder in der Forschungsstelle selbst oder im Wiener Stadt- und Landesarchiv zugänglich. Darüber hinaus wurden der Verfasserin Dokumente – Todesurteile gegen einzelne Kommandoführer – aus französischen, polnischen und slowenischen Archiven zur Verfügung gestellt.
Abschließend sei an dieser Stelle noch darauf hingewiesen, dass bei allen hier herangezogenen Unterlagen ein äußerst quellenkritischer Umgang geboten war. Dokumente aus der NS-Zeit als auch Strafermittlungsakten der Nachkriegszeit sind unbedingt vor dem Hintergrund ihrer Entstehung und ihrer Intention zu lesen und zu interpretieren.45
1 Tönsmeyer, Tatjana: Die Einsatzgruppe H in der Slowakei, in: Hösler, Joachim/Kessler, Wolfgang (Hrsg.): Finis Mundi – Endzeiten und Weltenden im östlichen Europa. Festschrift für Hans Lemberg zum 65. Geburtstag, Stuttgart 1998, S. 167–188.
2 Kwiet, Konrad: Der Mord an Juden, Zigeunern und Partisanen. Zum Einsatz des Einsatzkommandos 14 der Sicherheitspolizei und des SD in der Slowakei 1944/45, in: Jahrbuch für Antisemitismusforschung 7 (1998), S. 71–81.
3 Fatran, Gila: Die Deportation der Juden aus der Slowakei 1944–1945, in: Bohemia 37 (1996), S. 98–119.
4 Matthäus, Jürgen: Georg Heuser – Routinier des sicherheitspolizeilichen Osteinsatzes, in: Mallmann, Klaus-Michael/Paul, Gerhard (Hrsg.): Karrieren der Gewalt. Nationalsozialistische Täterbiographien, Darmstadt 2004, S. 115–125; Matthäus, Jürgen: „No ordinary Criminal“. Georg Heuser, Other Mass Murders, and West German Justice, in: Heberer, Patricia/Matthäus, Jürgen (Hrsg.): Atrocities on Trial. Historical Perspectives on the Politics of Prosecuting War Crimes, London 2008, S. 187–209.
5 Ullrich, Christina: „Ich fühl’ mich nicht als Mörder“. Die Integration von NS-Tätern in die Nachkriegsgesellschaft, Darmstadt 2011.
6 Pollack, Martin: Der Tote im Bunker. Bericht über meinen Vater, Wien 2004.
7 Dreßen, Willi: Der Holocaust in der Slowakei und die deutsche Justiz, in: Jahrbuch für Antisemitismusforschung 7 (1998), S. 93–102.
8 Škorvánek, Stanislav: Nacistický okupační systém na Slovensku v období od vypuknutí SNP [Das nationalsozialistische Besatzungssystem in der Slowakei in der Zeit nach dem Ausbruch des Slowakischen Nationalaufstands], in: Zborník Múzea Slovenského národného povstania [Sammelband des Museums des Slowakischen Nationalaufstands] 13 (1988), S. 53–70.
9 Halaj, Dušan (Hrsg.): Fašistické represálie na Slovensku [Faschistische Repressalien in der Slowakei], Bratislava 1990.
10 Prehl’ad masových hrobov a vrážd, ktoré boli prevedené pohotovostnými Einsatzkommandami SIPO a SD na území Slovenska [Übersicht über Massengräber und Morde, die in der Slowakei durch die Einsatzkommandos der Sipo und des SD verübt wurden] (o.D.). AM SNP Banská Bystrica, IX, S 25/78.
11 Stanislav, Ján/Mičev, Stanislav: Protižidovské represálie na Slovensku od septembra 1944 do apríla 1945 [Antijüdische Repressalien in der Slowakei von September 1944 bis April 1945], in: Tóth, Dezider (Hrsg.): Tragédia slovenských židov. Materiály z medzinárodného sympózia, Banská Bystrica 25.–27. marca 1992 [Die Tragödie der slowakischen Juden. Materialien des internationalen Symposiums, Banská Bystrica 25.–27. März 1992], Banská Bystrica 1992, S. 195–233; Stanislav, Ján: Represálie v zime 1944–1945 [Repressalien im Winter 1944–1945], in: SNP v pamäti národa, Materiály z vedeckej konferencie k 50. výrociu SNP, Donovaly 26.–28. apríla 1994 [Der Slowakische Nationalaufstand im Gedenken der Nation, Materialien der wissenschaftlichen Konferenz zum 50. Jahrestag des Slowakischen Nationalaufstands, Donovaly 26.–28. April 1994], Bratislava-Banská Bystrica 1994, S. 197–216; Tóth, Dezider: Represálie nacistov a příslušníkov POHG proti židovskému obyvatel’stvu na Slovensku v rokoch 1944–1945 [Repressalien von Nationalsozialisten und Angehörigen der POHG gegen die jüdische Bevölkerung in der Slowakei in den Jahren 1944–1945], in: Zudová-Leškova, Zlatica (Hrsg.): Židé v boji a odboji. Rezistence ceskoslovenských Židů v letech druhé světové války [Juden in Kampf und Widerstand. Der Widerstand tschechoslowakischer Juden in den Jahren des Zweiten Weltkriegs], Praha 2007, S. 105–120.
12 Schvarc, Michal: Z anonymity k oficialite – organizácia Sicherheitsdienstu na Slovensku v rámci Pohotovostnej skupiny H Sipo a SD [Aus der Anonymität zur Offizialität – die Organisation des Sicherheitsdienstes in der Slowakei im Rahmen der Einsatzgruppe H der Sipo und des SD], in: Slovenská republika 1939–1945 očami mladých historikov V. [Die Slowakische Republik 1939–1945 in den Augen junger Historiker V.], Banská Bystrica 2006, S. 83–95 [zit. Schvarc 2006a]; Schvarc, Michal (Hrsg.): Sicherheitsdienst a Slovensko v rokoch 1938–1944. Slovenský štát vo vybraných správach SD od jesene 1943 do septembra 1944 [Der Sicherheitsdienst und die Slowakei in den Jahren 1938–1944. Der slowakische Staat in ausgewählten Berichten des SD von Herbst 1943 bis September 1944], Bratislava 2006 [zit. Schvarc 2006c].
13 Schvarc, Michal: Heimatschutz – medzi realitou a ilúziou. Organizácia a formovanie nemeckej domobrany [Heimatschutz – zwischen Realität und Illusion. Organisation und Aufbau des deutschen Heimatschutzes], in: Slovenská republika 1939–1945 očami mladých historikov III. [Die Slowakische Republik 1939–1945 in den Augen junger Historiker III.], Trnava 2004, S. 301–326; Schvarc, Michal: Masová exekúcia v Sklenom 21. septembra 1944 v širšom dejinnom kontexte [Die Massenexekution in Sklené am 21. September 1944 im weiteren historischen Kontext], in: Pamät’ národa [Gedächtnis der Nation] 3 (2007), S. 4–13.
14 Schvarc, Michal/Hlavinka, Ján: Masová vražda na poli Krtičná pri Brezne. Jeden zo zločinov Einsatzkommanda 14 koncom roku 1944 [Der Massenmord auf dem Krtičná-Feld bei Brezno. Eines der Verbrechen des Einsatzkommandos 14 Ende 1944], in: Pamät’ náro-da [Gedächtnis der Nation] 2 (2006), S. 84–88 [zit. Schvarc 2006b].
15 Hlavinka, Ján/Nižňanský, Eduard: Pracovný a koncentračný tábor v Seredi 1941–1945 [Das Arbeits- und Konzentrationslager in Sered 1941–1945], o. O. 2009.
16 Mičev, Stanislav: Druhá vlna deportacií rasovo prenasledovaných obcanov Slovenska september 1944 až april 1945 [Die zweite Deportationswelle rassisch verfolgter Bürger der Slowakei, September 1944 bis April 1945], in: Büchler, Róbert/Fatranová, Gila/Mičev, Stanislav (Hrsg.): Slovenskí Židia [Die slowakischen Juden], Banská Bystrica 1991, S. 53–57.
17 Kamenec, Ivan: Slovenský stát 1939–1945 [Der Slowakische Staat 1939–1945], Praha 1992 [zit. Kamenec 1992a]; Korček, Ján: Slovenská republika 1943–1945 [Die Slowakische Republik 1943–1945], Bratislava 1999; Lacko, Martin: Slovenská republika 1939–1945 [Die Slowakische Republik 1939–1945], Bratislava 2008.
18 Kamenec, Ivan: Po stopách tragédie [Auf den Spuren der Tragödie], Bratislava 1991; Lipscher, Ladislav: Židia v slovenskom štáte 1939–1945 [Die Juden im slowakischen Staat 1939–1945], Bratislava 1992.
19 Tóth, Dezider (Hrsg.): Tragédia slovenských židov. Materiály z medzinárodného sympózia, Banská Bystrica 25.–27. marca 1992 [Die Tragödie der slowakischen Juden. Materialien des internationalen Symposiums, Banská Bystrica 25.–27. März 1992], Banská Bystrica 1992; SNP v pamäti národa, Materiály z vedeckej konferencie k 50. výrociu SNP, Donovaly 26.–28. apríla 1994 [Der Slowakische Nationalaufstand im Gedenken der Nation, Materialien der wissenschaftlichen Konferenz zum 50. Jahrestag des Slowakischen Nationalaufstands, Donovaly 26.–28. April 1994], Bratislava-Banská Bystrica 1994.
20 Prečan, Vilém (Hrsg.): Slovenské národné povstanie. Dokumenty [Der Slowakische Nationalaufstand. Dokumente], Bratislava 1965; Prečan, Vilém (Hrsg.): Slovenské národné povstanie, Nemci a Slovensko 1944. Dokumenty [Der Slowakische Nationalaufstand, die Deutschen und die Slowakei 1944. Dokumente], Bratislava 1971.
21 Vgl. vor allem Nižňanský, Eduard (Hrsg.): Holokaust na Slovensku 6. Deportácie v roku 1942, Dokumenty [Der Holocaust in der Slowakei 6. Die Deportationen im Jahre 1942, Dokumente], Bratislava 2005 [zit. Nižňanský 2005a]; Nižňanský, Eduard (Hrsg.): Holokaust na Slovensku 7. Vzt’ah slovenskej majority a židovskej minority (náčrt problému), Dokumenty [Der Holocaust in der Slowakei 7. Die Beziehung der slowakischen Mehrheit zu der jüdischen Minderheit (Problemskizze), Dokumente], Bratislava 2005 [zit. Nižňanský 2005b]; Hradská, Katarína (Hrsg.): Holokaust na Slovensku 8. Ústredna Židov (1940–1944), dokumenty [Der Holocaust in der Slowakei 8. Die Judenzentrale (1940–1944), Dokumente], Bratislava 2008.
22 Hrbek, Jaroslav u.a.: Draze zaplacená svoboda. Osvobození Československa 1944–1945 [Die teuer erkaufte Freiheit. Die Befreiung der Tschechoslowakei 1944–1945] (Bd. I), Praha 2009.
23 Schönherr, Klaus: Die Niederschlagung des Slowakischen Aufstandes im Kontext der deutschen militärischen Operationen, in: Bohemia 42 (2001), S. 39–61.
24 Venohr, Wolfgang: Aufstand für die Tschechoslowakei. Der slowakische Freiheitskampf von 1944, Hamburg 1969.
25 Tönsmeyer 1998, S. 168, Anm. 4.
26 Hoensch, Jörg K.: Die Slowakei und Hitlers Ostpolitik. Hlinkas Slowakische Volkspartei zwischen Autonomie und Separation 1938/1939, Köln 1965; Kaiser, Johann: Die Politik des Dritten Reiches gegenüber der Slowakei 1939–1945. Ein Beitrag zur Erforschung der nationalsozialistischen Satellitenpolitik in Südosteuropa, Dissertation Bochum 1969; Tönsmeyer, Tatjana: Das Dritte Reich und die Slowakei 1939–1945. Politischer Alltag zwischen Kooperation und Eigensinn, Paderborn 2003.
27 Zur kurzen Darstellung der deutschen Slowakeipolitik ab Spätsommer 1944 vgl. Prečan, Vilém: Die nationalsozialistische Slowakeipolitik und das Tiso-Regime nach dem Ausbruch des Aufstandes 1944, in: Schulin, Ernst (Hrsg.): Gedenkschrift Martin Göhring. Studien zur europäischen Geschichte, Wiesbaden 1968, S. 369–386.
28 Hilberg, Raul: Die Vernichtung der europäischen Juden, Frankfurt/Main 1994.
29 Jäckel, Eberhard/Longerich, Peter/Schoeps, Julius H. (Hrsg.): Enzyklopädie des Holocaust. Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden, München 1998 (Slowakei, S. 1322–1327 und Slowakischer Nationalaufstand, S. 1327–1329).
30 Browning, Christopher R.: Die Entfesselung der „Endlösung“. Nationalsozialistische Judenpolitik 1939–1942, München 2003; Longerich, Peter: Politik der Vernichtung. Eine Gesamtdarstellung der nationalsozialistischen Judenverfolgung, München 1998.
31 Krausnick, Helmut: Hitlers Einsatzgruppen. Die Truppe des Weltanschauungskrieges 1938–1942, Frankfurt/Main 1993; Ogorreck, Ralf: Die Einsatzgruppen und die „Genesis der Endlösung“, Berlin 1996; Rhodes, Richard: Die deutschen Mörder. Die SS-Einsatzgruppen und der Holocaust, Bergisch Gladbach 2004; Langerbein, Helmut: Hitler’s death squads: the logic of mass murder, o. O. 2004.
32 Wilhelm, Hans-Heinrich: Die Einsatzgruppe A der Sicherheitspolizei und des SD 1941/42, Frankfurt/Main 1996; Angrick, Andrej: Besatzungspolitik und Massenmord. Die Einsatzgruppe D in der südlichen Sowjetunion 1941–1943, Hamburg 2003.
33 Gerlach, Christian: Die Einsatzgruppe B 1941/42, in: Klein, Peter (Hrsg.): Die Einsatzgruppen in der besetzten Sowjetunion 1941/42. Die Tätigkeits- und Lageberichte des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD, Berlin 1997, S. 52–70; Pohl, Dieter: Die Einsatzgruppe C 1941/42, in: Ebd., S. 71–87.
34 Mallmann, Klaus-Michael/Böhler, Jochen/Matthäus, Jürgen: Einsatzgruppen in Polen. Darstellung und Dokumentation, Darmstadt 2008; Mallmann, Klaus-Michael/Cüppers, Martin: Halbmond und Hakenkreuz. Das „Dritte Reich“, die Araber und Palästina, Darmstadt 2006; Silvennoinen, Oula: Geheime Waffenbrüderschaft. Die sicherheitspolizeiliche Zusammenarbeit zwischen Finnland und Deutschland 1933–1944, Darmstadt 2010.
35 Mallmann, Klaus-Michael: Menschenjagd und Massenmord. Das neue Instrument der Einsatzgruppen und -kommandos 1938–1945, in: Paul, Gerhard/Mallmann, Klaus-Michael (Hrsg.): Die Gestapo im Zweiten Weltkrieg. „Heimatfront“ und besetztes Europa, Darmstadt 2000, S. 291–316.
36 Paul, Gerhard: Von Psychopathen, Technokraten des Terrors und „ganz gewöhnlichen“ Deutschen. Die Täter der Shoah im Spiegel der Forschung, in: Paul, Gerhard (Hrsg.): Die Täter der Shoah. Fanatische Nationalsozialisten oder ganz normale Deutsche? Göttingen 2002, S. 13–90 [zit. Paul 2002b]; Paul, Gerhard/Mallmann, Klaus-Michael: Sozialisation, Milieu und Gewalt. Fortschritte und Probleme der neueren Täterforschung, in: Mallmann, Klaus-Michael/Paul, Gerhard (Hrsg.): Karrieren der Gewalt. Nationalsozialistische Täterbiographien, Darmstadt 2004, S. 1–32; Mallmann, Klaus-Michael: Dr. Jekyll & Mr. Hyde. Der Täterdiskurs in Wissenschaft und Gesellschaft, in: Mallmann, Klaus-Michael/Angrick, Andrej (Hrsg.): Die Gestapo nach 1945. Karrieren, Konflikte, Konstruktionen, Darmstadt 2009, S. 292–318 [zit. Mallmann 2009b].
37 Browning, Christopher R.: Ganz normale Männer. Das Reserve-Polizeibataillon 101 und die Endlösung in Polen, Reinbek bei Hamburg 2009; Goldhagen, Daniel Jonah: Hitlers willige Vollstrecker. Ganz gewöhnliche Deutsche und der Holocaust, Berlin 1996.
38 Gerlach, Christian (Hrsg.): Durchschnittstäter. Handeln und Motivation, Berlin 2000; Paul, Gerhard (Hrsg.): Die Täter der Shoah. Fanatische Nationalsozialisten oder ganz normale Deutsche? Göttingen 2002 [zit. Paul 2002a]; Perels, Joachim/Pohl, Rolf (Hrsg.): NS-Täter in der deutschen Gesellschaft, Hannover 2002; Mallmann, Klaus-Michael/Paul, Gerhard (Hrsg.): Karrieren der Gewalt. Nationalsozialistische Täterbiographien, Darmstadt 2004; Mallmann, Klaus-Michael/Angrick, Andrej (Hrsg.): Die Gestapo nach 1945. Karrieren, Konflikte, Konstruktionen, Darmstadt 2009 [zit. Mallmann 2009a].
39 Herbert, Ulrich: Best. Biographische Studien über Radikalismus, Weltanschauung und Vernunft, 1903–1989, Bonn 1996; Banach, Jens: Heydrichs Elite. Das Führerkorps der Sicherheitspolizei und des SD 1936–1945, Paderborn 1998; Wildt, Michael: Generation des Unbedingten. Das Führungskorps des Reichssicherheitshauptamtes, Hamburg 2008.
40 MacLean, French: The Field Men. The SS Officers Who Led the Einsatzkommandos – the Nazi Mobile Killing Units, Atglen 1999; Ullrich 2011.
41 Rückerl, Adalbert: NS-Verbrechen vor Gericht. Versuch einer Vergangenheitsbewältigung, Heidelberg 1984; Frei, Norbert: Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit, München 1997; Greve, Michael: Der justitielle Umgang mit den NS-Gewaltverbrechen in den sechziger Jahren, Frankfurt/Main u.a. 2001; Freudiger, Kerstin: Die juristische Aufarbeitung von NS-Verbrechen, Tübingen 2002.
42 Eichmüller, Andreas: Die Strafverfolgung von NS-Verbrechen durch westdeutsche Justizbehörden seit 1945 – Eine Zahlenbilanz, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 56 (2008), S. 621–640.
43 Earl, Hilary Camille: The Nuremberg SS-Einsatzgruppen trial, 1945–1958. Atrocity, law, and history, Cambridge 2009; Nehmer, Bettina: Die Täter als Gehilfen? Zur Ahndung von Einsatzgruppenverbrechen, in: Blanke, Thomas (Hrsg.): Die juristische Aufarbeitung des Unrechts-Staats, Baden-Baden 1998, S. 635–668.
44 Kuretsidis-Haider, Claudia/Garscha, Winfried R. (Hrsg.): Keine „Abrechnung“. NS-Verbrechen, Justiz und Gesellschaft in Europa nach 1945, Leipzig-Wien 1998; Frei, Norbert (Hrsg.): Transnationale Vergangenheitspolitik. Der Umgang mit deutschen Kriegsverbrechern in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, Göttingen 2006; Halbrainer, Heimo/Kuretsidis-Haider, Claudia (Hrsg.): Kriegsverbrechen, NS-Gewaltverbrechen und die europäische Strafjustiz von Nürnberg bis Den Haag, Graz 2007.
45 Zur Aussagekraft von Berichten aus der NS-Zeit siehe zum Beispiel Longerich, Peter: „Davon haben wir nichts gewusst!“. Die Deutschen und die Judenverfolgung 1933–1945, München 2006. Zu Akten aus strafrechtlichen Ermittlungen gegen NS-Täter siehe Finger, Jürgen/Keller, Sven/Wirsching, Andreas (Hrsg.): Vom Recht zur Geschichte. Akten aus NS-Prozessen als Quellen der Zeitgeschichte, Göttingen 2009.