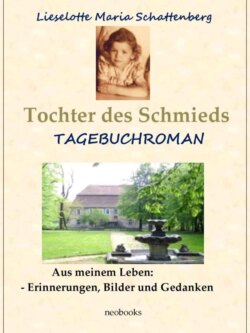Читать книгу Tochter des Schmieds - Lieselotte Maria Schattenberg - Страница 5
2. Brody im Juni 1906
ОглавлениеUnser Großvater Wilhelm erzählte uns Enkeln manchmal aus seiner Jugend. Wir saßen still auf der Erde und hörten ihm gebannt zu.
Schwere Ladung haben die beiden Arbeitspferde zu ziehen. Großvater Wilhelm ruft ho ho und hü, schnalzt mit der Zunge und lässt die Peitsche knallen. Der Weg ist steinig und führt aus dem kleinen polnischen Heimatort bei Stary Tomischel an der alten Mühle Kuschlin entlang, die auch heute in Betrieb ist. Es war abgemacht, dass Großmutter Marie noch einen Besuch bei ihrem Onkel Fritz, der hier als Müller tätig war, abstattete. Er und seine Frau Herta wünschten dem jungen Paar viel Glück in ihrem neuen Heim und eine gute Arbeit auf dem Gut Brody. Man hörte ja, dass es auf dem Gutshof einige Veränderungen geben sollte. Ein Herr von Oppen hatte den Besitz an die Familie von Pflug verkauft.
Der neue Herr stellte Landarbeiter aus der Gegend und in der Saison auch aus Russland ein. Der Onkel übergab dem jungen Paar feierlich in einem weißen Umschlag ein verspätetes Hochzeitsgeschenk. An der Feier vor wenigen Wochen hatte er nicht teilnehmen können. Durch seine Staublunge, die er vom Mehlstaub bekommen hatte, war ihm das Reisen nicht mehr möglich. Das Sprechen fiel ihm schwer, weil er sehr kurzatmig war und keine körperliche Anstrengung mehr vertrug; so hatte Maries Cousin die Mühle übernommen. Über die unerwartete finanzielle Zuwendung waren die beiden Besucher sehr froh und bedankten sich artig, ehe sie ihre Reise fortsetzten.
Die Landstraße war staubig, an manchen Stellen fehlte das Kopfsteinpflaster. Dann gab es Sandlöcher, in denen das Fahrzeug drohte, steckenzubleiben. Die Räder ächzten, der Wagen ruckelte und Marie kontrollierte ständig ihre Ladung, während ihr Mann die Zügel straff hielt.
In Gedanken saß sie noch bei den Eltern, von denen ihr der Abschied besonders schwergefallen war. Sie dachte an die Familie und an ihre Vermählung.
Die Hochzeit hatte vor Ostern in der evangelischen Kirche Neutomischel stattgefunden. Die in Kreuzform errichtete und mit doppelten hölzernen Emporen ausgestattete Kirche konnte mehr als 1000 Besucher aufnehmen. Als sie im Jahr 1780 eingeweiht wurde, gab es die Ortschaft noch gar nicht.
In der Kirchenchronik wurde berichtet, dass sich um die neuerbaute Kirche herum an Sonn- und Feiertagen durch das Zusammenströmen vieler Menschen ein lebhafter Verkehr entwickelte und so die Stadt entstand:
Wilhelm und Marie hatten sich auf dem Weihnachtsball kennengelernt. Sie war in der Kreisstadt bei einer Beamtenfamilie in Stellung und hatte Hauswirtschaft gelernt, er ist seinen Eltern schon einige Jahre als Bauer auf dem großen Hof im Nachbardorf zur Hand gegangen. Ihnen blieb nicht viel Zeit, denn der Wochentag war ausgefüllt mit Landarbeit. So blieb nur der Sonnabend in der Stadt, wenn die jungen Leute ausgingen und sich in Gruppen versammelten, um gemeinsam mit dem Fuhrwerk auszufahren. Dann machten sie sich fein, wuschen sich den Staub aus den Haaren und waren wie die Kinder, fröhlich und kurze Zeit unbeschwert.
Schnell stand fest, die beiden wollten ihr Leben miteinander teilen. Die Hochzeit wurde beschlossen und ein Ort gesucht, wo beide gemeinsam Arbeit hatten. „Weit und breit gab es dafür nur einen Ort, das Gut Brody.“
Hier hatte Großvater seinen Vortrag für diesen Tag unterbrochen, nahm nachdenklich seinen Tabak, griff die alte Mütze und verschwand für eine lange Zeit im Garten. Erst auf unsere neugierigen Fragen nach dem Schloss nahm er den Faden wieder auf:
Schloss Brody
„In der Provinz Posen hatte die Herrschaft auf dem Gut Brody um 1900 ihre Blüte erreicht. Einen großen Teil seines Landes baute der Besitzer Freiherr von Pflug mit Hopfen an und hatte guten Erfolg damit. Der Roggen konnte auf dem Moorboden gut gedeihen, während die Gerste und der Hafer oft der Fritfliege zum Opfer fielen, die feuchte Lebensräume bevorzugte und ihre Eier besonders in die Herzen des langhalmigen Getreides legte. Auch die Zwergzikaden, diese winzigen punktäugigen Insekten, die mit Hilfe ihrer Hinterbeine gut springen können, zogen mit ihren stechend-saugenden Mundwerkzeugen an ihren Wirtspflanzen wichtige Aufbaustoffe heraus. Letztendlich kamen die Zuckerrüben in die Fabriken, wenn sie durch ihr schnelles Wachstum den Engerlingen oder Drahtwürmern entgangen waren. Es gab wenig Weideland in diesem Landstrich, deshalb arbeitete der Betrieb nutzviehlos. Dieser Boden war einer der nährstoffreichsten in der ganzen Provinz Posen. Dazu gab es Wald mit Kiefern und Birken, der jährlich abgeholzt und mit einer neuen Hopfenanlage versehen einen doppelten Ertrag brachte. Einige Hundert Bäume säumten die Straßen, Gärten und Alleen ringsum und trugen mit ihren Früchten zum Wohl der Menschen bei.
Die Äpfel, Birnen, Pflaumen und Kirschen dienten zum Verkauf in den Städten Pinne und Neustadt. Von Wichtigkeit waren die großen Höfe, weil sie das Zentrum der großen Wirtschaft darstellten. Das Zugvieh und die Feldfrüchte mussten in Gebäuden untergebracht werden, um bei dem wechselnden Klima keinen Schaden zu nehmen. So hatte der Hof in Brody mit dem 1892 erbauten Schloss und der evangelischen Kirche die Ausmaße eines gewaltigen Rechtecks.
Außer der Scheune, einem Hof mit Brennerei, Stallungen für Dutzende Arbeitspferde, aber auch eine Handvoll Luxuspferde sowie Mastschweine gab es auch einen Hühnerstall und den Taubenschlag für den Aufenthalt des nötigen Geflügels.
Der Hopfenanbau brachte dem Gut viel Geld ein. Durch das Vermischen von Wasser, Gerstenmalz und Hopfen und dem durch Hefe ausgelösten Gärprozess, in dessen Verlauf mehr oder weniger Alkohol frei wurde, entstand das Bier, das den Menschen des Gutes als Nahrungsmittel und dem Herrn als Ware diente. Es gab dafür schon seit dem vorigen Jahrhundert sowohl Bierverordnungen als auch eine Preisbindung beim Verkauf in der Stadt.
Der Speicherraum für einige Tausend Zentner Getreide lässt erahnen, wie viel Arbeiter nötig waren, um diesen Betrieb aufrecht zu erhalten.
So hatte der Gutsbesitzer Paul von Pflug auch außerhalb des Hofes entlang der Landstraße in östlicher Richtung zehn Arbeitshäuser zur Aufnahme von Arbeiterfamilien sowie eine Unterkunft für einige Dutzend Sommerarbeiter bauen lassen.“
Es war kein Wunder, wenn der Großvater so von seinem Schloss schwärmte, denn dieser riesige landwirtschaftliche Betrieb suchte Seinesgleichen. Schließlich konnte er mit seiner Marie in eines dieser Häuser ziehen.
Seine blauen Augen leuchteten und er zwirbelte den Schnurrbart, während er träumend wieder zum jungen Mann wurde.
Als sich das Fuhrwerk an diesem Tag dem Gutshof näherte, stoppte Wilhelm die Pferde, machte die Leine am Wagen fest und näherte sich zu Fuß dem großen eisernen Tor, während Marie auf die Tiere achtgab. Er war dabei, eine lange besprochene Entscheidung in die Tat umzusetzen. An der Einfahrt von der Landstraße in den Hof befanden sich das Rentamt und große Wohnungen für das höhere Aufsichtspersonal. Er stolperte vor Aufregung über die Schienen, die vom Bahnhof direkt in den Hof verliefen, und über die sämtliche Handelsgüter transportiert wurden.
In dem kleinen Wachhäuschen saß ein untersetzter Mann mittleren Alters und maß ihn mit strengem Blick. „Was wünschen Sie?“, fragte er mit knarrender Stimme. „Ja, guten Tach auch, wissen Sie, meine Frau da draußen auf dem Fuhrwerk und ich sind die neuen Arbeiter. Wir kommen aus Neustadt.
Seit Ostern sind wir angemeldet. Wir wollen bleiben, also für immer, wenn es sich einrichten ließe bei der Herrschaft. Könnten Sie nich so freundlich sein, Herr Amtmann und uns sagen, wo wir nu hin sollen? Wir sind gerade angekommen, die Landstraße immer runter müssen Sie wissen“, teilte ihm Wilhelm in einer langen Rede eifrig von seinen Strapazen mit und drehte vor Verlegenheit seine Mütze in den Händen. Der Vogt des Gutes las in seinen Papieren, fand die richtigen Unterlagen und kam mit seinem gesattelten Pferd bis zur Ausfahrt, wo er Marie höflich zunickte. Dann wies er mit ausgestrecktem Arm nach links um eine kleine Kurve:
„Da herum geht es, noch einen Kilometer. Das dritte Haus. Die Huben Numero 3“, beschrieb er knapp. „Folgen Sie mir bitte hier entlang.“ Er ritt voran, während der Leiterwagen mit dem Hab und Gut der beiden Jungvermählten hinterher zuckelte.
So zogen Wilhelm und Marie in die Huben Numero 3 ein.
Die Huben oder Hufen bedeuteten ein Stück eigene Fläche, das ausreichend Acker- und Weide beinhaltete, um eine Familie ernähren zu können. Natürlich konnten sie es nur in ihrer Freizeit bearbeiten. Ihr zugewiesenes Land lag gleich hinter dem Haus.
Sie nahmen außerdem in dem massiven Haus eine große Stube, zwei kleinere Kammern und einen darüber liegenden Bodenraum in Besitz.
Auf dem Hof stand ein Stall zur Aufnahme von Schweinen, Federvieh, Holz und sonstigen Vorräten. Ihre beiden Pferde nahm man als Arbeitspferde im Gutsstall auf. Sie selbst waren Gutsarbeiter geworden.
Wilhelm wurde unentbehrlich als Pferdeknecht und Kutscher, während Marie sich im Sommer an den Hack- und Erntearbeiten betätigte. Im Winter lernte sie, mit der Schrotmühle das Getreide zu mahlen und die Masttiere und Milchkühe mit Wasser, Rüben, Heu und Schlempe zu versorgen, dem alkoholfreien Rückstand bei der Branntweinherstellung, der ein sehr gutes Futtermittel war. So ging das erste Jahr zur Neige, als sich Marie im warmen Monat August plötzlich vor dem morgendlichen Kamillentee und Wilhelms abendlichem Bier ekelte und Heißhunger auf Heringe hatte, die sie sonst gar nicht mochte. In ihrer ersten Schwangerschaft brachte sie im Februar 1908 in ihrem Haus auf den Huben 3 in Schanzfeld, polnisch Niewiercz, einen gesunden Jungen zur Welt.
Sie tauften ihn in der evangelischen Kirche Duschnik auf den Namen Paul und er wurde mein Vater.
Als ältester Sohn von neun Kindern, sechs Jungen und drei Mädchen, wuchs er auf dem Hof seiner Eltern auf und hatte, wie alle Kinder, in die zwölf Kilometer entfernte Schule in seinen Holzpantoffeln zu gehen.
Über Stock und Stein. Im Sommer barfuß, im Winter mit Fußlappen. Vorhandene Schuhe wurden immer weitervererbt und regelmäßig neu besohlt oder benagelt. Manchmal trugen die Kinder Schuhe, die viel zu klein waren. Asphalt gab es noch nicht. Seine Mutter hatte mit den vielen Kindern ihre Not, alle der Jahreszeit entsprechend zu kleiden. Sie selbst trug ständig über ihrem Kleid eine Schürze. Es gab zu Hause noch viel ältere Schürzen, die sie nur für die Feldarbeit trug, weil sie löchrig und abgewetzt waren.
Die Frauen im Dorf waren geschickt in Handarbeiten. Sie konnten die Kleidung flicken, Strümpfe, Pullover und Pullunder stricken, Decken, Schals und Handschuhe anfertigen. Es wurde nichts weggeworfen, alles noch einmal umgeändert oder etwas Neues aus dem ausrangierten Stoff genäht. Da es damals viele kinderreiche Familien gab, wurde die Kleidung immer wieder an die Nächstkleineren weitergegeben. Eine Hose konnte auch schon mal ein paar Jahre mitwachsen, wurde immer kürzer und mit Hosenträgern gehalten. Für Sonntage, Feste oder Beerdigungen gab es nach Möglichkeit eine extra Garnitur Kleidung für jeden. Es war durchaus nicht selbstverständlich, die Unterwäsche täglich zu wechseln, weil das Waschen der Kleidung eine aufwändige Angelegenheit war, die manchmal nur einmal im Monat stattfinden konnte und im Winter noch seltener.
Für die Kinder der armen Bevölkerung bestand der Alltag aus Arbeit. Sie mussten in Haushalt und Hof helfen und Geld verdienen, um die Familie über Wasser zu halten.
In der wenigen Freizeit vergnügten sie sich mit den einfachsten Dingen, bastelten sich aus Kastanien, Eicheln und Tannenzapfen kleine Männchen oder erschufen sich aus Sand, Steinen, Ästen und Erde eine Traumwelt.
Die Spielzeuge der gehobenen Schichten, beispielsweise fein ausstaffierte Puppen, Steckenpferde, Windmühlen, große Holzreifen, Glasmurmeln, silberne Babyrasseln oder Ritterfiguren, waren für sie unerreichbar.
Als Zerstreuung hatten die Kinder der Familie einfache Spielkarten, mit denen sie „Schummel-Lieschen“ oder „Doppelkopf“ spielten. Es gab auch ein selbst hergestelltes „Mensch-ärgere-dich-nicht“-Spiel, das sie zu gern mochten. Wenn es jemanden in der Nachbarschaft gab, der Akkordeon oder Mundharmonika spielen konnte, wurde auch gesungen und sogar getanzt.
Die Schulpflicht haben wir der Kaiserin Maria Theresia zu verdanken. Damals gab es aber noch kein Zeugnis und keine Beurteilung. Vorrangige Sorge der Verantwortlichen war nicht der Schulerfolg, sondern der regelmäßige Unterrichtsbesuch der Kinder. Die Eltern schickten ihre Kinder allgemein sehr ungern zur Schule, weil sie diese zu Hause brauchten.
Die Nachtruhe war sehr kurz. Morgens mussten alle sehr früh aufstehen, denn auf dem Land bestimmte der Sonnenaufgang den Zeitpunkt, um das Vieh zu melken und zu füttern. Abends wurde es dann sehr spät, bis man das Vieh im Stall hatte und es versorgt war. Mit Sonnenuntergang endete dann meist der Arbeitstag, denn elektrisches Licht gab es nicht überall.
In den Klassenzimmern waren meist weit über 50 Schüler versammelt, die nicht nach dem Alter, sondern nach dem Wissenstand in drei „Classen“ gegliedert wurden: erst-classige, zweit-classige, dritt-classige Schüler. Auf dem Dorf gingen meistens ältere und jüngere Schüler gemeinsam in eine Klasse.
Die Eltern Wilhelm und Marie konnten keine neuen Bücher kaufen. Ein Buch, meist geborgt aus der Schule, ging durch viele Geschwisterhände, bis es verschlissen war. Auch mit den Heften mussten die Kinder sparsam umgehen, wenn sie überhaupt welche besaßen. Die Aufgaben wurden zuerst mit einem weißen Griffel auf eine schwarze Schiefertafel geschrieben. Mit einem Fetzen Stoff konnte man es wieder weglöschen und die nächste Aufgabe darüberschreiben.
Die Kinder saßen auf engen harten Holzbänken, und wenn sie nicht folgsam waren, mussten sie sich in die Ecke stellen oder der Lehrer griff zu seinem Rohrstöckchen und es gab Schläge.
Im Winter lag oft hoher Schnee auf den Straßen, dann war das Kopfsteinpflaster glatt und rutschig. In der Kälte und oft noch in der Dunkelheit marschierten sie länger als zwei Stunden bis zur Schule. Die Geschwister liefen manchmal den kürzeren Weg auf den Feldwegen entlang, versanken mit ihren Holzpantoffeln im Schnee und riskierten nasse Füße, denen Fieber und Erkältungen folgten.
Die meisten Menschen auf dem Land kamen kaum je mit einem Arzt in Berührung, geschweige denn mit einem Krankenhaus. Krankheiten wurden zum größten Teil nicht mit Medikamenten, die es auch kaum gab, sondern mit überlieferten Hausmitteln behandelt.
Manchmal fuhr ein Pferdeschlitten, dann konnten die Kinder im Gänsemarsch in den Spuren der Kufen laufen. Paul war als Ältester oft längere Zeit wegen der Arbeit zu Hause nicht abkömmlich, sodass er oft wochenlang den Unterricht verpasste. Dadurch fiel ihm der Anschluss stets schwer und er hatte Mühe, aufzupassen und den Stift mit seinen kräftigen Händen zu halten. Seine acht Geschwister hatten es ein wenig leichter, denn meist fiel die Schule bei ihnen nur im Winter bei hohem Schnee aus oder wegen einer ihrer vielen Krankheiten. Jungen und Mädchen saßen getrennt. Sie fingen morgens an, wenn der Lehrer kam, mit einem Gruß: Guten Morgen, Herr Lehrer. Und dann sagte er: Guten Morgen Kinder. Es folgte das Schulgebet und dann wurde ein Choral gesungen, ein Kirchenlied. Schließlich durften sich die Kinder setzen. Dann begann die erste Stunde: Religion, die zweite meist Deutsch. Die anderen Fächer wie Rechnen, Raumlehre oder Geometrie, Musik, Turnen und
Malen folgten, täglich zwischen vier bis sechs Stunden insgesamt. Die drei Mädchen hatten zusätzlich Handarbeit und in den letzten beiden Jahren der Volksschule lernten sie in der Küche kochen.
Als Schulspeisung gab es für jedes Kind von der Mutter ein Butterbrot mit, das in ein Stück Zeitung eingewickelt war. Nach dem Ersten Weltkrieg rationierte eine Brotkarte das Brot. Auch Milch, Fett, Eier und andere Nahrungsmittel konnten nur auf einen Bezugsschein erworben werden. Für die Kinder war vielleicht nicht so von Belang die Seifenkarte, denn Körperpflege war nur ein sehr kleiner Bestandteil des Alltags der zwanziger und dreißiger Jahre. Sauberkeit und Hygiene hatten damals nicht so einen hohen Stellenwert wie heute. Üblich war es, sich morgens flüchtig zu waschen, zumeist mit kaltem Wasser, zusätzlich wurde Kernseife benutzt. Sie besaßen im Haus Waschschüsseln und Waschkrüge, die direkt in den Schlafzimmern auf Kommoden standen und meist nur morgens benutzt wurden. Das Wasser dafür musste erst draußen von der Pumpe geholt werden. Oft befand sich im Winter in den unbeheizten Zimmern eine dünne Eisschicht auf dem Wasser.
In trockenen Sommern wurde das Wasser so knapp, dass es kaum zur Flüssigkeitsversorgung der Menschen und zur Viehtränkung reichte, so dass niemand auf die Idee gekommen wäre, das Wasser zum Waschen zu verschwenden.
Bei den Bauern und Arbeitern war Dreck keine Schande und auf schmutzige Fingernägel wurde die Woche über nicht geachtet. Einmal oder alle 14 Tage wurde gebadet, zumeist stand eine Zinkbadewanne in der Waschküche, das Wasser wurde in zeitaufreibender Arbeit erhitzt. Die Wanne wurde langsam mit heißem Wasser gefüllt und die Familie stieg nacheinander ins Wasser; die Kinder zuletzt. Zum Waschen und Haarwaschen benutzten alle meist Kernseife. Für sonntags und den traditionellen Kirchgang waren dann alle sauber geschrubbt.
Hautcremes oder Parfüms fanden in der einfachen Bevölkerung keinen Gebrauch. Diese waren der höheren Klasse vorbehalten. Während auf dem Land noch langes Haar und Zöpfe getragen wurden, ging der Trend von jungen Frauen im städtischen Bürgertum zur neuen Mode hin. Die Haare wurden kinnlang getragen. Der Bob kam auf, gerade oder in Wellen gelegt. Auf dem Land konnten sich nur Wenige einen Friseurbesuch erlauben. So wurden die Haare der kinderreichen Familie von der Mutter geschnitten.
Auch um das Zähneputzen war es schlecht bestellt, denn Zahnbürsten mit Kunststoffborsten wurden erst ab den vierziger Jahren hergestellt und setzten sich nur langsam durch. In Notzeiten konnte sich kaum jemand so etwas wie Zahnputzpulver leisten, daher wurde die Zahnpflege vernachlässigt. Die Zahnmedizin steckte noch in den Kinderschuhen. So wurden kranke Zähne zumeist sofort gezogen. Es kam deshalb oft vor, dass auch schon Menschen in mittleren Jahren fast zahnlos waren. Die einfachste und kostengünstigste Form war später die Klammerprothese, in einem Stück gegossen und anschließend mit Kunststoff ummantelt. Die Befestigung an den Nachbarzähnen erfolgte mit Metallklammern. Diese Prothesen ließen sich einfach reinigen, unproblematisch herausnehmen und wieder einsetzen. Nicht einfach hatten es die Kinder, die jeden Abend im Bad die Zähne ihrer Eltern in einem Wasserglas vorfanden.
Die Männer rasierten sich fast täglich mit Rasierseife und einem Rasiermesser, das am eigenen Ledergürtel geschärft wurde. Zur Beruhigung und Pflege der Haut gab es damals schon Puder oder Wollfettsalben, was erschwinglich war. Kosmetik und Schminke waren nur ein Privileg der Reichen. Für die armen Klassen waren diese aber nicht nur unerschwinglich, vor allem das Schminken wurde grundsätzlich abgelehnt, da sich nach allgemeiner Meinung nur moralisch zweifelhafte Frauen anmalten.
Frühstück und Abendessen gab es erst nach dem Füttern und Melken des Viehs.
Ärmere und kinderreiche Familien besaßen nicht einmal Essgeschirr, so dass sie direkt aus der Pfanne aßen. Nach dem Tischgebet erfolgte die Verteilung der Speise nach der familiären Rangordnung. Der Vater erhielt als erstes die größte Portion, danach die Kinder entsprechend ihrem Alter. Die ältesten Kinder, wenn sie schon Lohn mit nach Hause brachten, bekamen manchmal auch eine zweite Portion. Als Paul seinen schweren Beruf erlernte, war er stets sehr hungrig. Was auf den Tisch kam, musste gegessen werden. Es sollte nichts auf dem Teller bleiben. Nicht einmal Krümel durften auf dem Tisch oder auf dem Boden hinterlassen werden, denn das war eine Sünde.
Ab dem 1. März 1915 verhängte Großbritannien eine Seeblockade vor der gesamten Küste Deutsch-Ostafrikas. Deutschland sollte von den Rohstofflieferungen über das Meer abgeschnitten werden. So wurden Rationierungen aller Lebensmittel notwendig, weil durch diese Blockade kaum noch Lebensmittel importiert wurden. Bereits nach wenigen Monaten zeigte sie ihre Wirkung. Gleichzeitig ging aber die Produktion zurück, weil viele Bauern in den Krieg eingezogen waren. Rohstoffe wie Metalle, Erdöl, Gummi, Leder und Baumwolle wie auch Nahrungsmittel wurden knapp. Die Menschen litten an Hunger. Gleichzeitig benötigte aber die Front immer mehr Nachschub an Waffen, Munition und Nahrungsmitteln. Weil die Männer an der Front waren, mussten verstärkt Kriegsgefangene, Frauen und Jugendliche die Arbeitsplätze in den Fabriken und auf dem Land besetzen.
Einen Höhepunkt erreichte der Hunger im "Kohlrübenwinter" 1916. An den Folgen von Unterernährung und Hunger starben in Deutschland rund 700 000 Menschen und die Kindersterblichkeit stieg um die Hälfte. Krankheiten wie Erschöpfung, Abgeschlagenheit, Gereiztheit bis zur Aggressivität - der Krieg im Kopf- sowie Erkältungen und Grippe waren alltäglich. Mit Hohn und stummem Protest reagierte die notleidende Bevölkerung auf absurd anmutende Ratschläge des Kriegsernährungsamts und seiner Behörden, die Hungernden sollten durch 2 500 Kauakte für 30 Bissen in 30 Minuten selbst für eine bessere Nahrungsverwertung sorgen. Der Vater hatte auch als Erwachsener eine besondere Beziehung zu Kohlrüben oder Wrucken, wie er sie nannte, entwickelt. Sie halfen ihm, den „Kohldampf“ als Kind zu ertragen.
Weil es nur einen Steinwurf von dem Gutshof der Rittergutsbesitzer von Pflug war, lernte und arbeitete Paul dort als Hufbeschlagsschmied, eine besondere Spezialisierung des Schmiedes, der ein alter Beruf in der Menschheitsgeschichte ist. Vater erlernte also ein Handwerk und wurde kein Bauer, obwohl er von einem Bauernhof stammte. Im ländlichen Raum war der Schmied noch im späten 20. Jahrhundert ein unverzichtbarer Handwerker. Paul arbeitete als Beschlagschmied für Wagen und Ackergeräte, als Hufschmied, Kunstschmied, Schlosser und Werkzeughersteller.
In den Städten etablierten sich Spezialisten wie Waffenschmiede, Messerschmiede, Nagelschmiede, Harnischmacher und Kupferschmiede. Daraus entwickelten sich Manufakturen, aber Vater blieb auf dem Land.
Seine Finger waren hornhäutig, weil er das heiße Eisen bearbeitete. Für die teuren Pferde des Gutsbesitzers hatte er auch die Anpassung von Hufschuhen vorzunehmen, die dem Reittier wie ein Schuh für jeden Ausritt angezogen wurden.
Mit einem Blasebalg aus Tierhäuten erzeugte er einen Luftstrom, um die Glut im Schmiedefeuer auf die richtige Temperatur zu bringen. Seine Nase lag zwischen den mohrrübenroten Wangen, er schnaufte und rieb sich zwischendurch den Schweiß von der Stirn. Es war heiß und stickig, roch stark nach Metall oder Qualm. Wenn er ein Eisenstück im Wassereimer ablöschte, war eine Zeitlang alles in zischenden Nebelschwaden verschwunden. Er trug stets eine Mütze, deren Schild ihm die Augen verdeckte. Manchmal nahm am Schmiedefeuer auch die kräftige Nase die rote Farbe seiner Wangen an. Wenn er wütend wurde, konnte man es an den Augen erkennen, denn kurz stachen die Pupillen nach außen, das Weiße der Augen wurde sichtbar, und er konnte in dem Moment des Jähzorns unberechenbar sein. Man ging ihm lieber schnell aus dem Weg, sonst warf er den Kühllappen oder den Hammer. Man muss ihm zugutehalten, dass er niemanden verletzt hatte.
Mit seinen Brüdern, die als Müller, Bäcker, Stellmacher und Bauer auf dem Gut zu tun hatten, gab es oft Streit. Die Mädels hielten sich zurück, denn sie waren den rauen Kräften der Jungen nicht gewachsen. Natürlich arbeiteten sie auch für den Gutsherrn als Weißnäherin, Köchin und im Haushalt.
Vater war inzwischen als Hufschmied ein Spezialist für das Ausschneiden und das Beschlagen von Hufen mit Hufeisen oder anderen Materialien. Die Hufeisen und Hufnägel stellte er traditionell auch selbst im Schmiedeprozess her oder passte sie der Form des jeweiligen Hufes an. Manchmal hatte er auch bei Rindern mit einem Eisen die Klauen zu verschneiden. Das war dann nötig, wenn sie für den Transport von Feldfrüchten eingesetzt wurden und deshalb ihre Klauen starkem Verschleiß unterlagen.
Die Bewohner der kleinen Huben-Siedlung bekamen im Jahr 1930 elektrisches Licht. Inzwischen hatten Wilhelm und Marie noch einige Kinder mehr bekommen und die Familienplanung galt als abgeschlossen. Die drei dunkelhaarigen Mädchen hießen Elisabeth, Frieda und Hildegard. Sie hatten große Ähnlichkeit miteinander, waren dunkelhaarig, braunäugig und temperamentvoll. Nach dem Ältesten Paul kamen noch die beiden schwarzhaarigen Söhne Adolf und Alfred, danach der rothaarige, sommersprossige Emil, dann Otto, dem nur ein kurzes Leben beschieden war und Willi, das Nesthäkchen mit den Segelohren.
Während der Große schon volljährig war und seinen Beruf gelernt hatte, kam der Jüngste gerade in die Schule. Alle in der Familie waren bisher mit der kleinen Petroleumlampe ausgekommen. Im Sommer war es draußen lange hell und die Kinder hielten sich vorwiegend an der frischen Luft auf. Im Winter gingen sie früh zu Bett und konnten sich ein hell erleuchtetes Zimmer am Abend nicht vorstellen.
Eines Tages erschienen in der Gegend einige Männer mit einem Lastwagen, darauf mächtige Masten, die vor den staunenden Augen der Siedlungskinder am Straßenrand aufgestellt wurden. Sie spannten Kabel von einem Mast zum anderen, die in einem kleinen Häuschen endeten. Es hieß, dass sie den Strom und helles Licht ins Haus bringen würden. Die Kinder hatten sich an die Petroleumlampe gewöhnt und konnten sich nicht ausmalen, wie aus solch großen Masten das Licht in ihre Stube gelangen sollte. Deshalb fragten sie argwöhnisch, als der Vater es erklärte: „Wie soll denn das Licht von dem kleinen Haus in die Wohnhäuser kommen?“ Sie glaubten ihm nicht und lachten. Schließlich führten die Monteure lange Leitungen zu den Häusern und befestigten sie an den Wänden. Es gab auch Leute, die sich den Anschluss nicht legen ließen, weil er zu teuer war und sie ihre Petroleumlampe behalten wollten. Die Bauarbeiter zogen nun Leitungen durch Löcher in die Wände, es wurde gebohrt und geklopft. Die Kabel führten an der Decke der einzelnen Zimmer entlang und endeten in der Mitte. Die Kinder suchten, guckten und fanden das Licht nicht in den Kabeln oder an der Decke. Sie hatten es ja gewusst, es kam kein Licht aus den Drähten. Aber die Eltern gaben dafür ihr schwer verdientes Geld aus, da mussten sie den Kabelleuten also doch glauben. Der Vater brachte nun so eigenartige Dinger mit und nannte sie „Lampe“. Dabei hatten sie mit der Petroleumlampe kaum eine Ähnlichkeit. Vor allem fehlte der Docht, den man hätte anzünden können. In jedes Zimmer hängte er solch eine Lampe an das Drahtende der Kabel. Die kleine Hildegard sagte enttäuscht: „Ich hab es ja gewusst, das geht nicht“. Der Vater tröstete sie: „Warte ab, Hilde, es fehlt doch noch die Glühbirne“. Da musste sie aber lachen. Birnen und Äpfel hatte sie auf dem Gutsgelände genügend kennengelernt. „Hier, das ist sie, eine Glühbirne“, hob er eine Kugel in die Höhe. Dann schraubte er sie alle in die Lampen, aber ohne Erfolg. „Hilde, dreh nun mal da an der Tür den Schalter.“ Sie sah ihn skeptisch an, denn aus dieser Entfernung konnte das nichts werden. Sie drehte den Schalter und war verzaubert, denn nun erstrahlte das Zimmer in hellem Licht und die Birne glühte. Alles war hell, nicht nur ganz dicht im Umkreis wie bei der Petroleumlampe. Nun konnte man in jeder Ecke lesen oder stopfen. Die Freude der Familie war groß. Das elektrische Licht war eine große Errungenschaft für sie und später auch für die zögernden Leute.