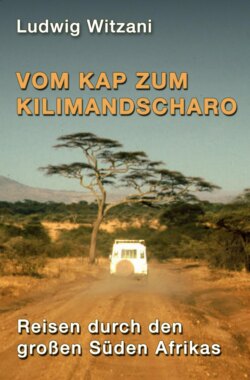Читать книгу Vom Kap zum Kilimandscharo - Ludwig Witzani - Страница 10
Оглавление„Stolz, ein Mensch zu sein“
Auf Robben Island
Niemand kann über Südafrika reden, ohne den Namen Nelson Mandela zu erwähnen. Ich selbst wuchs auf mit diesem Namen als einem Symbol für den Kampf um Freiheit und Gerechtigkeit. Ich entsinne mich noch genau an die Ehrfurcht, mit der unser Politiklehrer uns Bilder eines schwarzafrikanischen Mannes mit Bart präsentierte, der völlig unschuldig in einem Staatsgefängnis saß, weil er Freiheit für sein Volk gefordert hatte. Es war übrigens eine Zeit gewesen, in der es jede Menge Helden gegeben hatte, die weit weg von Europa für die Menschenrechte kämpften. Manche sahen gut aus wie Che Guevara, manche waren wütend wie Patrick Lumumba oder klein und hunzelig wie Onkel Ho. Nelson Mandela war der einzige gewesen, der auf seinem Bild einen Anzug mit Krawatte trug. Es war der Anzug, den er getragen hatte, als er im Jahre 1964 von einem Gericht in Südafrika zu lebenslanger Haft wegen Terrorismus verurteilt worden war. Viele dieser Helden starben jung wie Che Guevara, das war noch das Beste, was ihnen passieren konnte, dachte ich, weil sie auf diese Weise stark und schön im Gedächtnis blieben. Andere kamen an die Macht und entpuppten sich als ebensolche Schlächter wie ihre Gegner. Die Geschichte Nelson Mandelas aber war anders. Er starb weder, noch kam er an die Macht. In einer sich rasend verändernden Welt saß er scheinbar für die Ewigkeit auf der Gefängnisinsel Robben Island vor den Toren von Kapstadt hinter Gittern.
Doch die Zeit seiner Gefangenschaft verging nicht umsonst. Sie entpuppte sich als eine Kraft, die den Gefangenen von Robben Island in den Augen seiner Anhänger jedes Jahr ein wenig heiliger machte – und das Erstaunlichste war, dass er sich, als er endlich aus der Gefangenschaft entlassen wurde, wirklich als Heiliger erwies und allein mit der Macht seiner Persönlichkeit den großen Machtwechsel am Kap ohne Bürgerkrieg über die Bühne brachte. Während der andere große Verbannte seiner Zeit, Ayatollah Chomeini nach seiner Rückkehr in den Iran seine Heimat in einem Meer von Blut ertränkte, entpuppte sich Nelson Mandela nach seiner siebenundzwanzigjährigen Haft als ein Genie der Versöhnung, als die wahrscheinlich moralisch herausragende Gestalt des Jahrhunderts.
Über ein Menschenalter war vergangen, seitdem Nelson Mandela Robben Island verlassen hatte. Flach und unscheinbar lag die kleine Insel in der blauen See, als hätten nicht jahrzehntelang die Augen der Welt auf ihr geruht. Die Insel befand sich nur sieben Kilometer vom afrikanischen Festland entfernt und war gerade mal fünf Quadratkilometer groß, der ideale Ort für eine Sträflingsinsel, weil die starken und eiskalten Strömungen in der Bucht jede Flucht unmöglich machten. Während der Überfahrt hielt ich die Hand in das Wasser. Es stimmte: Robbentemperatur, nichts für Menschen. Zwei Dutzend Touristen, Franzosen, Briten, Deutsche, Niederländer befanden sich an Bord einer kleinen Fähre, die die Besucher in einer knappen halben Stunde zur Insel brachte.
Das erste, das wir bei unserer Ankunft auf Robben Island erblickten, war eine watschelnde Schar von Brillenpinguinen, die sich wie ein Begrüßungskommittee unterhalb des Kais versammelt hatte. Brillenpinguine waren die einzigen Pinguine Afrikas. Sie waren klein und kompakt, gerade mal 65 Zentimeter hoch, besaßen die charakteristischen Ralleystreifen an den Seiten und gehörten zu den schnittigsten Varianten ihrer Art. Leider hatten sie das Pech, so gut zu schmecken, so dass sie beinahe ausgerottet worden wären, ehe man sie unter Artenschutz gestellt und für sichere Nistplätze gesorgt hatte. Die Brillenpinguine von Robben Island waren darüber nicht informiert, sie wussten noch nichts von der Schlechtigkeit der Welt, waren zutraulich und liefen eine Zeitlang um uns herum, ehe sie wieder im Unterholz verschwanden.
Gleich am Ufer warteten zwei Bedienstete des Nationalparks mit ihren Kleinbussen. Sie fuhren uns über die Insel, zuerst vorbei am Friedhof und den Überresten einer alten Leprakolonie, dann vorüber an der Grundschule, die für die Kinder der Inselbewohner eingerichtet worden war.
Unser Fahrer, ein junger Mann mit großem Mund und Riesenzähnen, ratterte derweil die Eckdaten der Inselgeschichte wie auswendig gelernt herunter, nannte die Namen tapferer Zulukrieger, die im kalten Wasser ertrunken waren und bedauernswerter Leprakranker, die auf der Insel den Tod gefunden hatten. Er war einer von einhundertachtzig Inselbewohnern, die samt und sonders im Dienst des Robben Island Museums und des Naturschutzes standen - und er war stolz darauf, aus der Transkei zu stammen, ebenso wie „Tata“, „der Vater“, womit Präsident Mandela gemeint war.
Im Gefängnis angekommen wurden wir einem zweiten Guide übergeben, der uns am Tor erwartete. Er stellte sich als „Mr. John“ vor, trug eine Uniform, die ihm um den schmalen Körper schlotterte, hatte schlohweißes Haar und einen Gesichtsausdruck, der zwischen Melancholie und Warmherzigkeit schwankte. Als ehemaliger Insasse von Robben Island, so begann er, freue er sich über unser Interesse. Er sprach langsam und akzentuiert und führte uns in den Innenhof des Gefängnisses.
Wer denn den Namen Nelson Mandela schon einmal gehört habe, fragte er. Alle hoben die Hand. Und wer kannte seinen Geburtsort? Niemand meldete sich. „Nelson Mandela wurde am 18. Juli 1918 in Mvenzo im Distrikt Umtata geboren“, erklärte Mr. John mit erhobener Stimme. „Er entstammte einem königlichen Xhosa-Geschlecht, er war also ein vornehmer Mann. Später wurde er ein Anwalt, der die Interessen des Volkes vertrat.“ Als die Weißen im Jahre 1948 mit dem Aufbau der „großen Apartheid“ begannen, war Mandela dreißig Jahre alt und bereits ein Mitleid des ANC, des African National Congress´, der sich für die Gleichberechtigung der „Blacks“ und auch der „Coloured“, d.h. der Inder und Malaien, einsetze. „He did it always peaceful“ (Er machte es immer friedlich“) behauptete Mr. John, was so nicht ganz stimmte, denn Mandela hatte sich in den frühen Sechziger Jahren, als die Unterdrückung der schwarzafrikanischen Bevölkerungsmehrheit immer unerträglicher geworden war, für den bewaffneten Widerstand ausgesprochen. Er war einer der Führergestalten der Umkhonto we Swiw gewesen, des bewaffneten Arms des ANC, der ab 1961 mit Anschlägen auf Frachtzüge und Polizeistationen begonnen hatte, wobei aber darauf geachtet wurde, dass keine Menschen zu Schaden kamen. Ich überlegte, ob ich danach fragen sollte, ließ es aber, denn immerhin befand ich mich an einem Ort, in dem Nelson Mandela der Gewalt abgeschworen und zu dem gewaltlosen „Satyagraha“ Mahatma Gandhis gefunden hatte.
Mr. John hatte seinen Kurzvortrag über den Werdegang Nelson Mandelas beendet und war bei seiner Verurteilung im Jahre 1964 angekommen. Wegen angeblichen Terrors sei Mandela zu lebenslänglicher Haft auf Robben Island verurteilt worden, was unter den damaligen Umständen eine der härtesten Strafen gewesen sei. Denn die Gefängnisleitung und die Wärter waren knallharte Vertreter der Apartheid gewesen, und sie schikanierten die Gefangenen, wo immer es ihnen möglich war. Besonders schlimm sei das Verbot gewesen, mit Mitgefangenen zu reden, Bücher zu lesen oder etwas zu schreiben. Nur bei bestimmten Zusammenkünften, etwa beim Gottesdienst oder bei der Arbeit konnten sich die Gefangenen austauschen. Und auf den Toiletten, weil ihnen die Wärter dorthin nicht folgten, fügte Mr. John hinzu und schmunzelte. Arbeiten mussten die Häftlinge im Steinbruch, was eine unglaubliche Tortur gewesen sei, nicht nur wegen der Schwere der Arbeit, sondern auch, weil der Staub die Lungen und das grelle Licht die Sehkraft zerstörte.
Mr. John drehte sich um und führte uns in das Gefängnisgebäude, in dem sich ein langer Gang mit kleinen Gefängniszellen links und rechts befand. „Wer von Ihnen trägt Socken?“ fragte er. Erstaunen auf den Gesichtern der Umstehenden. „Natürlich jeder“, antwortete Mr. John sich selbst und berichtete, dass die Gefangenen selbst mit Socken und Hosen schikaniert worden waren. Denn die Häftlinge von Robben Island waren in vier Klassen eingeteilt – von A bis D – und wer ein „black politican“, ein „schwarzer Politischer“, war, gehörte zur Klasse „D“ und hatte kein Anrecht auf Socken und lange Hosen. Er musste in kurzen Hosen und ohne Strümpfe in alten rissigen Schuhen herumlaufen, während ein indischer Insasse immerhin Anspruch auf lange Hosen und Socken hatte. Ein Gefangener der Kategorie D durfte auch nur einen einzigen Brief pro Halbjahr schreiben, der selbstverständlich zensiert wurde. Manchmal wurden auch Briefe gefälscht, das hieß, ein Häftling bekam Post, in der die Ehefrau dem Gefangenen mitteilte, dass sie sich scheiden lassen wollte, oder man erhielt fingierte Nachrichten über den Tod eines Familienangehörigen. „Bad, bad times“, schloss Mr. John und führte uns den Gang entlang zur Zelle von Nelson Mandela. Sechs Quadratmeter groß, eine Pritsche, eine Decke, ein schmales Fenster, ein Gitter zum Gang, das war’s.
Ob er, Mr. John, Nelson Mandela persönlich in Robben Island erlebt habe, fragte ein Franzose.
Nein, gab Mr. John zu. Als er in den Achtziger Jahren nach Robben Island kam, war Mandela bereits in ein Gefängnis auf dem Festland verlegt worden. Mandela war aber auch nach seinem Abschied von Robben lsland noch über sieben Jahre lang gefangen gehalten worden, ehe man ihn 1990 frei ließ.
Ob er zufrieden sei mit der Entwicklung Südafrikas, fragte eine weibliche Touristin.
„Um ehrlich zu sein: nein“, gab Mr. John unumwunden zu. Zu viele der Wenigen seien noch immer zu reich und zu viele der Vielen noch immer zu arm.
Und woran das seiner Ansicht nach liege, wollte ein anderer wissen.
„Korruption“, antwortete Mr. John sofort. Korruption „All over“.
„Auch beim ANC?“ fragte ich.
„Gerade beim ANC“, erwiderte Mr. John. Er sei alt und brauche kein Blatt mehr vor den Mund zu nehmen. Der ANC, die große nationale Partei, die den Befreiungskampf geführt und gewonnen habe, sei korrupt geworden. Unser Präsident, Mr. Zuma, lebt in einem Palast, und die armen Leute in den Cap Flats schnüffeln an Klebstoff und Amphetaminen, um ihre Not zu betäuben. Zumas vier Frauen erhielten Luxuskarossen auf Staatskosten, aber die Busse und Eisenbahnen seien alt und verrottet.
War denn alles umsonst gewesen? dachte ich, sagte aber nichts. Immerhin wurden die Schwarzafrikaner heute von ihrer eigenen Elite schlecht regiert und nicht mehr von Weißen. Aber war das wirklich ein Fortschritt?
Als keine Fragen mehr gestellt wurden, verabschiedete sich Mr. John und empfahl uns die Kantine, wo wir einen Kaffee trinken könnten. Alle klatschten. Einige Besucher traten an den alten Mann heran und wollten ihm ein Trinkgeld geben. Er lehnte freundlich ab.
Beim abschließenden Rundgang betrachtete ich in einem Ausstellungsraum Kopien von Briefen hinter Glas, aus denen ganze Passagen von den Zensoren herausgeschnitten worden waren. Auf großen Fotowänden waren Bilder von Mandela und seinen Gefährten nach dem Ende ihrer Gefangenschaft ausgestellt, dazu eine Abbildung von Mandelas Autobiografie „Long Walk to Freedom“, deren erster Teil in Robben Island entstanden war. Ein halbes Dutzend Fotos zeigte Aufnahmen von einem Besuch des amerikanischen Präsidenten Bill Clinton, wie er mit dem alten Mandela im Hof des Gefängnisses stand und einem Kinderchor lauschte. Ganz am Ende war eine Zeittafel angebracht, der zu entnehmen war, dass die Abteilung für politische Gefangene auf Robben Island im Jahr 1991 aufgelöst worden war. 1996 war auch das normale Gefängnis von Robben Island geschlossen worden. Seit 1997 war Robben Island ein Museum und Naturschutzgebiet. Das größte Bild an der Wand aber war ein Portraitfoto des alten Nelson Mandela, einer gütig dreinblickenden Vatergestalt, die zur Überraschung der Welt nach seiner Freilassung ganz anders aussah als auf seinen 27 Jahre alten Jugendbildern. Sah man ihm seine Güte an? Gab es Erkennungszeichen des Guten im Gesicht eines Menschen? Ich wusste es nicht, auch wenn mich der warme Glanz seiner Augen berührte. Nelson Mandela war als Persönlichkeit ein beispielloser Glücksfall der Geschichte gewesen, der menschliche Gegenentwurf zu Monstern wie Stalin, Hitler oder Mao, eine Lichtgestalt, wie es sie wahrscheinlich nur alle paar hundert Jahre einmal gab. Oder in den Worten Colombe Prongles: „Er ist ein Mensch, der es möglich macht, mit Stolz ein Mensch zu sein.“