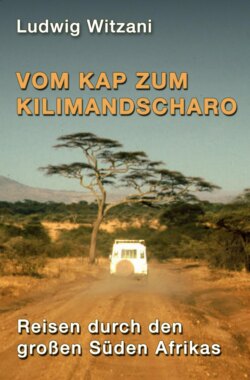Читать книгу Vom Kap zum Kilimandscharo - Ludwig Witzani - Страница 14
Die schönste Straße
der Welt Auf der Gartenroute
ОглавлениеDer schöne Mann, die schöne Frau, das schöne Pferd, alles wurde schon prämiert, wie aber steht es mit der schönen Straße? Und was bedeutet überhaupt das Prädikat „schön“ im Zusammenhang mit einer Straße? Ist es eine vage Sammelbezeichnung für eine Gemengelage aus Attraktivität, Abenteuerlichkeit oder anderen Eigenschaften? Dass die schöne Straße abwechslungsreich sein sollte, versteht sich natürlich von selbst. Auch was es links und rechts der Straße zu sehen gibt, sollte grandios sein – ein Ozean dessen Brecher gegen die Felsen knallen (Highway 1 zwischen Los Angeles und Pismo Beach), mächtige Sanddünen, die sich bis zum Horizont erstrecken (Die Straße der Palmen am Rande des Grand Ergs Occidental in Algerien) oder Eisriesen, zwischen denen sich eine Straße über atemberaubende Pässe windet (Der Karakorum Highway zwischen Abottobad und dem Khunjerab Pass in Pakistan) sollten es schon sein. Und seien wir ehrlich: Auch der Gedanke, alle diese Augenöffner bequem rollend und im Sessel sitzend genießen zu können, spielen bei der Frage nach der schönen Straße ein wichtige Rolle.
Fasste man all diese Prädikate zusammen, dann gehörte die sogenannte „Gartenroute“ zwischen Kapstadt und Port Elisabeth sicher zu den schönsten Straßen der Erde. Sie ist so abwechslungsreich wie keine andere Straße in Afrika, führt vorüber an Palmen und Buschland, Wiesen und Weiden, vom Wind abgefrästen Bergrücken und üppigen Primärwäldern. Mit einigen der ältesten und geschichtsträchtigsten Orten Südafrikas ist sie so kulturrelevant wie keine andere Region des afrikanischen Südens. Swellendam, Mossel Bay, Plettenberg – die Aufzählung dieser Ortsnamen gleicht einem who´s who der südafrikanischen Geschichte. Last not least besteht die Gartenroute nicht ausschließlich, aber über weite Passagen aus einer gut ausgebauten Panoramastraße am Rande des Ozeans. Nur einen Malus muss man vermerken. Dass man nahezu überall auf der Gartenroute für ein gutes Essen oder ein Picknick anhalten kann, macht die Passage dieser Straße so bequem, dass sie fast einen Abzug für mangelnde Abenteuerlichkeit erhalten müsste.
Ich begann meine Reise über die Gartenroute nach meiner Rückkehr aus der Weinprovinz in Sommerset West. Da war sie wieder, die schöne „False Bay“, an der das einzig Hässliche ihr Name war. Die Luft war so frisch und rein, dass es eine Freude war, tief einzuatmen, das Meer mit seiner vom Wind gekräuselten Gischt glich einem Spiegel aus unzähligen Splittern. Hinter Gordons Bay schoben sich die Hottentotten-Holland Mountains bis an das Meer heran, und nur eine kleine eng an den Fels gewundene Straße führte wie ein Saum nach Osten. An der Pringle Bay, ganz im Süden der Hottentotten-Holland Mountains, überblickte ich die False Bay zum letzten Mal und sah das Kap der Guten Hoffnung weit entfernt auf der anderen, der westlichen Seite der Bucht. Ein langgestreckter Wolkensaum, vom Wind getrieben, lag wie eine waagerechte Wetterfahne über dem Kap.
Jenseits der Pringle Bay führte die Nationalstraße 2 nach Caledon, einem Ort, der für seine Heilquellen und seinen Wild Flower Garden berühmt ist. Wer wollte, konnte sich hier die Marsh Rose ansehen, einen Pyrophyten, dessen Keimdauer dreimal so lange war wie seine Lebenszeit. Wie bei vielen Imperien, die in Jahrhunderten wuchsen und dann in Jahrzehnten vergingen. Ich ließ die Marsh Rose aber links liegen und bog in Caledon nach Südosten ab, um das Kap Agulhas zu besuchen. Irgendwie glaubte ich, das dem Kap schuldig zu sein, denn kein Ort der Welt von vergleichbarer Lage wird derart übersehen wie dieses Kap, das besser den Namen „el cabo despreciado“, das missachtete Kap, tragen sollte. Der Augenschein erklärte warum. Eine flach und unspektakulär auslaufende Landzunge markierte genau am 20. Breitengrad das wirkliche südliche Ende des afrikanischen Kontinents. Vor einem schmucklosen viereckigen Steinblock am Ufer befanden sich zwei Schilder mit der Aufschrift „Indischer Ozean“ (links) und „Atlantischer Ozean“ (rechts), eine Einladung für alle Besucher ihr linkes und ihr rechtes Bein vor dem Steinblock so zu positionieren, dass sie wenigstens virtuell in ihrem Körper beide Ozeanregionen miteinander verbanden. Soweit so albern, auch wenn der Wind keinen Zweifel daran ließ, dass ich mich an einem Kreuzweg der Welten befand. Der Zusammenfluss des warmen Agulhas Stroms aus dem Indischen Ozean und der kalten Benguela Gewässer aus dem Atlantik erzeugte einen so orkanartigen Wind, dass ich mich schon nach wenigen Minuten zurück ins Auto flüchtete und weiterfuhr.
Zwischen Cap Agulhas und Swellendam führte die Straße gut einhundert Kilometer lang über baumlose Hügel, die mit ihrer Moosbewachsung grünen Glatzen glichen, die aus der Erde wuchsen. Kurz vor Swellendam passierte ich eine Reihe von Farmen, die wie kleine Burgen auf den Anhöhen lagen. Weites, verlockendes Land, das seit dem 18. Jahrhundert die Siedler aus dem Kap nach Osten gelockt hatte. Die Khoisan, die hier ansässig waren, wurden schnell vertrieben, auf die kampfstarken Bantuvölker sollte man erst weiter östlich am Fisch River stoßen.
Swellendam selbst, die drittälteste Stadt Südafrikas, lag gut fünfzig Kilometer vom Indischen Ozean entfernt und in leichter Schräge an sanft auslaufenden Bergen. Ihre Hauptsehenswürdigkeit war das sogenannte „Drostdy Museum“, in dem das Leben der burischen Ortsvorsteher in einer Art Freilichtmuseum dargestellt wurde. Bei den Drostdys handelte es sich um drei wuchtige Hollandhäuser mit steil abfallenden Dächern, massiven Wänden und Nutzgärten. Angefüllt waren die Drostdys mit unbequemen Stühlen aus dem 18. Jahrhundert, auf denen ein Elefant hätte sitzen können, alten Töpfen und Küchengeräten aller Art. An den Wänden hingen Bilder knallharter Patriarchen, die für das Überleben des weißen Menschenschlages in diesem Wetterwinkel Südafrikas gesorgt hatten. Wie eigensinnig die Buren von Swellendam gewesen waren, hatte sich im Jahre 1795 erwiesen, als sich die örtlichen Bürger der britischen Okkupation der Kapprovinz widersetzt und die kurzlebige „Republik Swellendam“ ins Leben gerufen hatten.
Etwas von dieser Widerborstigkeit war in der alten Dame erhalten geblieben, bei der ich am späten Nachmittag meine Bed-and-Breakfast Unterkunft anmietete. Normalerweise ist die Kombination von „Bed-and-Breakfast“ und „alter Dame“ recht vielversprechend, nicht jedoch in Swellendam bei Madame Marie, wie sie genannt werden wollte. Sie war groß und knochig, mit schmalem Mund und abweisendem Gebaren. Misstrauisch beäugte sie mich, als ich mich in den Aufenthaltsraum setzte und schrieb. Ich hätte gerne mit ihr einen Tee getrunken, ein wenig geplaudert und einiges über ihre Herkunft erfahren, aber alle Versuche ein Gespräch anzufangen, scheiterten entweder an ihrem Desinteresse oder an ihrer Schwerhörigkeit.
*
Am nächsten Morgen brach ich früh auf und fuhr weiter nach Osten. Ich durchfuhr kleine Ortschaften mit so illustren Namen wie Heidelberg, Riversdale und Albertina, die sich glichen wie ein Hollandei dem nächsten. Kurz vor Mittag stieß ich auf der schnurgeraden Nationalstraße wieder auf das Meer und die Stadt Mossel Bay. Die Hafenfront wurde durch eine Raffinerie verunstaltet, und in der Innenstadt sah es noch gesichtsloser aus als in Swellendam. Eine wahre Wohltat dagegen war der Anblick des Meeres, das sich ruhig und blau bis zum Horizont erstreckte. Der Wind hatte nachgelassen, der Zone der Stürme war ich entronnen.
Trotz der ansprechenden Küste würde sich allerdings kein Tourist nach Mossel Bay verirren, wäre nicht das Scheinwerferlicht der Weltgeschichte vor fünfhundert Jahren völlig unplanmäßig auf den Ort gefallen. Die örtlichen Khoisan, die in der Mossel Bay ihr Vieh weideten, werden nicht schlecht gestaunt haben, als am 3. Februar 1488 fremdartige Gestalten auf einem kaum noch seetüchtigen Schiff in der Bucht landeten. Die abgerissenen Figuren, die ihnen über den Strand entgegenkamen, waren Portugiesen, denen nach einer lebensbedrohlichen Sturmfahrt endlich die Kap Umrundung geglückt war. Auch bei den Portugiesen dauerte es eine Weile, ehe sie sich orientieren konnten. Dann aber gab es keinen Zweifel mehr. Die Südspitze Afrikas war endlich umrundet, und der Weg nach Indien war frei. Der portugiesische Kapitän Bartholomeo Diaz, der dieses nautische Meisterstück vollbracht hatte, war gerade Ende Dreißig Jahre alt, ihm winkten Weltruhm und Reichtum ohnegleichen, ganz abgesehen davon, dass sich die Weltgeschichte möglicherweise ganz anders entwickelt hätte, wenn Diaz von der Mossel Bay nach Indien weitergesegelt wäre. Denn hätte Diaz 1488 Indien erreicht, und wäre er noch vor 1492 mit den Schätzen des Orients beladen nach Portugal zurückgekehrt, hätten die spanischen Könige Kolumbus möglicherweise gar nicht mehr nach Westen geschickt.
Doch die Reise wurde nicht fortgesetzt. Die portugiesischen Seeleute weigerten sich, weiter nach Osten zu segeln und drohten mit offener Meuterei. Warum Diaz sich diesen Drohungen beugte, ist bis heute nicht geklärt. Auch Kolumbus, da Gama und Magellan hatten sich Meutereien gegenübergesehen, doch sie hatten sich durchgesetzt und ihre Fahrten fortgesetzt. Diaz jedoch gab nach und kehrte im Frühjahr 1488 unverrichteter Dinge nach Lissabon zurück. Vielleicht war das der Grund gewesen, dass er sofort nach seiner Rückkehr aus der ersten Reihe der portugiesischen Entdecker verschwand. Die nächste und entscheidende Expedition, die Indien tatsächlich erreichte, stand unter dem Kommando Vasco da Gamas, und selbst an der großen Cabral Expedition des Jahres 1500, die Brasilien entdeckte, durfte Diaz nur noch als Unterführer teilnehmen. Bei dieser Expedition fand Bartholomeo Diaz noch im gleichen Jahr während eines Sturmes am Kap der guten Hoffnung den Tod.
Erst die Nachwelt hatte den unglückliche Seefahrer wieder rehabilitiert und ihm seinen Platz unter den großen Entdeckern zugewiesen. Aus Anlass der 500 jährigen Wiederkehr seiner epochalen Kap-Umrundung war im Jahre 1986/7 eine Jubiläumsfahrt organisiert worden. So genau nachgebaut, wie es nach der Quellenlage überhaupt möglich war, allerdings ausgestattet mit den neusten navigatorischen Instrumenten, war die Karavelle „Bartholomeo Diaz“ am 8.11. 1987 unter dem Kommando von Kapitän Emilio de Sousa und 17 Mann Besatzung in See gestochen. Ohne besondere Vorkommnisse und ohne die heftigen Stürme, über die der Entdecker so geklagt hatte, hatte die kleine Fregatte den Ozean durchsegelt, um pünktlich am 3.2.1988 die Mossel Bay zu erreichen. Kurz darauf war rund um die Karavelle ein Bartholomeo Diaz Maritim Museum errichtet worden, das die Geschichte der portugiesischen Afrikareisen dokumentierte.
Dieses Bartholomeo Diaz Maritime Museum befand sich neben einem einladenden Sandstrand an der Uferstraße von Mossel Bay. Als hätte er einen Besen verschluckt, stand der Entdecker höchst selbst als steinerne Skulptur aufrecht auf einer Empore und blickte mit überraschter Miene geradeaus, als könne er es immer noch nicht glauben, dass er damals nicht nach Indien weiter gesegelt war.
Betrat man das Museum, begegnete man zuerst den Helden der portugiesischen Entdeckungsreisen des 15. Jahrhunderts. Heinrich der Seefahrer, der wackere Prinz, der nie wirklich zur See gefahren, aber die portugiesischen Afrikaexpeditionen in Gang gebracht hatte, war ebenso mit von der Partie wie Gil de Eanes, der Mitte des 15. Jahrhunderts die Kongomündung erkundete - und last not least Diego Cao, der zehn Jahre vor Diaz 1477 Cape Cross in Namibia erreicht hatte. Das alles gehörte zur Vorgeschichte der Diaz-Expedition, deren Leistung man nur richtig würdigen konnte, wenn man sich die besonderen Windverhältnisse im afrikanischen Süden vergegenwärtigte. Denn die gesamte Südwestküste Afrikas wird vom kalten Benguela Strom beherrscht, der mit großer Kraft nach Norden fließt. so dass alle Schiffe, die nach Süden steuerten, einen hohen Bogen um Afrika herum segeln mussten, wobei sie leicht im Nirgendwo enden konnten. Unter diesen Umständen war der Anblick der Karavelle „Bartolomeo Diaz“ im Innenraum des Museums wahrlich frappierend – und zwar im Hinblick auf ihre Winzigkeit. Welch ein Missverhältnis zwischen der geringen Ausdehnung des Schiffes und der weltumspannenden Reiseroute, die sie zurücklegen mussten, und welch ein Stress, in dieser Enge monatelang unter Lebensgefahr unterwegs zu sein.
So winzig die Karavelle auch war, so beachtlich war der Besucherandrang, der an diesem Tag über das Schiff hinwegbrauste. Mitglieder einer chinesischen Reisegruppe hatten das Schiff praktisch in Beschlag genommen, standen an der Reling, als blickten sie über die Weiten des Ozeans, krochen durch alle Kombüsen und konnten sich vor lauter Fotografierwut gar nicht fassen. Der chinesische Reiseleiter, der dem Treiben seiner Landsleute mit milder Nachsicht von der Brüstung aus zusah, sprach ein ausgezeichnetes Englisch und erzählte mir, dass sich chinesische Seefahrer schon drei Generationen vor Bartholomeo Diaz von Osten her der Südspitze Afrikas genähert hätten. Ob ich das wüsste? Ein in China allseits bekannter und hochgerühmter Admiral namens Cheng-ho hätte auf seiner letzten Expedition im Jahre 1432 (nach der europäischen Zeitrechnung) mit einer großen Flotte sogar die Küste von Mosambik erreicht. Dann aber hatten die Kaiser der Ming Dynastie der Hochseeschifffahrt abgeschworen und alle Häfen verfallen lassen. Sehr schade, schloss der Reiseleiter, denn sonst hätten vielleicht nicht die Europäer China sondern die Chinesen Europa „entdeckt“.
Inzwischen hatten die Chinesen die Besichtigung der Bartholomeo Diaz abgeschlossen und sammelten sich wieder um ihren Reiseleiter. Dieser wies auf mich, sagte einige Worte auf Chinesisch, wobei ein allgemeines Kopfnicken einsetzte, ehe die Reisegruppe wieder verschwand. Ich blieb noch etwas im Museum, studierte die Exponate über die schmackhaften Muscheln, denen die Bucht ihren Namen verdankte, betrachtete den Postbaum vor dem Museum, an dem die Seefahrer ihre Nachrichten hinterlassen hatten und legte mich anschließend auf die Museumswiese aufs Ohr.
***
Die Stadt Oudtshoorn lag eine gute Fahrtstunde nördlich von Mossel Bay und befand sich in einer Klimazone, die etwas missverständlich als „kleine Karoo“ bezeichnet wurde. Missverständlich war diese Kennzeichnung, weil „Karoo“ an sich „Trockenzone“ bedeutete, was für die „große Karoo“ zwischen Worchester und Johannesburg auch ganzjährig zutraf. In der kleinen Karoo von Oudtshoorn, einer von Bergen umschlossenen Ebene, aber gab es reichlich Regen, vor allem im Winter, so dass Gemüse- Obst und Weinanbau betrieben werden konnte. Landesweit bekannt aber war die Eben von Oudtshoorn als Zentrum der südafrikanischen Straußenzucht.
Schon lange vor der Stadt passierte ich Farmen, deren Weidflächen mit unzähligen Straußen bevölkert waren, die so gravitätisch über die Wiesen spazieren, als sei die ganze Welt nur zu ihrer Freude erschaffen worden. Kein Zweifel, ich befand mich im Reich des Vogel Strauß, dessen Schmackhaftigkeit im ganzen Land ebenso gepriesen wie seine Dummheit verspottet wurde. Vor den Fahrzeugen, so hieß es, rannte der Strauß immer nur geradeaus davon, weil einen Haken zu schlagen und in die Büsche zu fliehen seine geistigen Möglichkeiten überstiege. Und dass er als Vogel wegen eines stattlichen Gewichtes von bis zu vierzig Kilogramm nicht mehr fliegen konnte, sei eine Gnade der Natur, denn mit den navigatorischen Fähigkeiten seines Miniaturgehirns wäre es nur eine Frage von Sekunden, bis er mit irgendeinem Baum kollidieren würde.
Doch den Vogel Strauß fasste das alles nicht an, zumindest nicht in Oudtshoorn. Wie ein selbstzufriedener König blickte er aus seiner stattlichen Kopfhöhe von mehr als zwei Metern auf die Menschen herab, die aus allen Teilen der Welt anreisten, nur um ihn zu besuchen. An den Straßenecken wurden Straußenwedel angeboten, in den Restaurants aß man Straußensteaks, und in den Buchhandlungen lagen Straußenbücher aus. Während man andernorts an den zentralen Plätzen einer Stadt gerne an berühmte Männer und Frauen erinnerte, befand sich an eben dieser Stelle mitten in Oudtshoorn ein überdimensionales Straußenei. Als der beliebteste lokale Wettbewerb galt das Straußeneier-Wettessen, und das mit Abstand bekannteste Museum der Stadt war natürlich das Straußenmuseum.
Dass einem Geschöpf mit einem solch winzigen Gehirn ein ganzes Museum gewidmet wurde, war allerdings nur die eine Hälfte der Wahrheit. Denn mindestens genauso intensiv wie mit dem Vogel beschäftigte sich das Straußenmuseum von Oudtshoorn mit dem Menschen und seiner Eitelkeit, von der Kant behauptet hat, sie sei nur eine Variante der menschlichen Dummheit. So trafen sich im Straußenmuseum von Oudtshoorn gewissermaßen der dumme Vogel und der dumme Mensch – und zwar am Detail des Federschmucks. Diese Kulturgeschichte des Federschmucks war in zwei Abteilungen eingeteilt, in eine allgemein-kulturgeschichtliche und eine regionale Darstellung. Gleich im Eingangsbereich des Straußenmuseums befand sich eine Nachbildung der berühmten Straußenfedern aztekischer Kriegsgefangener, die am Hofe Karls V. dereinst so großes Erstaunen hervorgerufen hatten. Aus dem Erstaunen der Höflinge erwuchs die Nachahmung, und bald schmückten Straußenfedern die Köpfe so bedeutender Damen wie Maria de' Medici, Mary Stuart und Marie Antoinette. Da wollte das aufstrebende Bürgertum natürlich nicht zurückstehen. Boas, Stolen und überdimensionale Federhüte kamen in Mode, lauter Accessoires, die im Fin de Siècle zur Standardkostümierung der gepflegten Frau gehörten, ohne die sie sich nicht auf die Straße traute.
Die Brücke zum weltweiten Straußenfederexport der Stadt Oudtshoorn aber schlug erst der Farmer und Tüftler Arthur Wingfield Douglas, der um 1860 seine Zeitgenossen mit einer epochalen Erfindung überraschte: dem Straußeneier-Inkubator. Dieser Apparat, ein mit Schubladen versehenes und beheizbares Möbelstück, dessen Urmodell einem altertümlichen Sideboard glich, ermöglichte eine bis dahin ungeahnte Ausweitung der Straußenzucht und den Aufstieg Oudtshoorns zur wohlhabendsten Stadt am Kap. Eine Kaste der so genannter „Federbarone“ entstand, deren Angehörige sich herrschaftliche Villen errichten und mit jedem nur denkbaren Komfort ausstatten ließen. Wer wollte, konnte einige dieser Häuser in Oudtshoorn besuchen und im Angesicht von holzbeschlagenen Bibeln, kostbarem Porzellan und einer deprimierenden Menge von Kitsch und Nippes darüber nachgrübeln, wie aus den Federn eines dummen Vogels und der Eitelkeit der Menschen eine reiche Stadt entstehen konnte.
Doch nichts ist von Dauer in der Welt, schon gar nicht im unberechenbaren Reich der Mode. Ein Überangebot
qualitativ minderwertiger Straußenfedern ließ schon vor dem ersten Weltkrieg die Weltmarktpreise einbrechen. Mit dem Siegeszug des Automobils kam dann auch das praktische Aus für den raumgreifenden Federschmuck. Denn in den anfangs noch recht kleinen Fahrzeugkabinen waren überdimensionale Straußenfederhüte, meterlange Boas und voluminöse Stolen einfach fehl am Platz. Sie zerknautschen jämmerlich, und wenn man das Verdeck lüftete und im Cabrio durch die Gegend brauste, flogen sie einfach davon. Eine Zeitlang experimentierte man noch mit miniaturisierten Hüten und Boas, doch die Weltwirtschaftskrise Ende der zwanziger Jahre und der weltweite Zollprotektionismus machten dem Straußenfederngeschäft von Oudtshoorn endgültig den Garaus.
Doch die Stadt hatte Glück, denn der Strauß erlebte nach dem Zweiten Weltkrieg eine wundersame Renaissance - diesmal nicht als Feder-, sondern als Fleischlieferant. Das Straußensteak avancierte zum festen Bestandteil einer nahrhaften und mitunter sogar raffinierten Küche, die sich zuerst im Süden Afrikas und schließlich auch in Übersee durchsetzte. Mit diesem Wandel vom Federschmuck zum Steak war das Verwertungspotenzial des Vogels aber immer noch nicht ausgereizt. Fast alle Farmen rund um Oudtshoorn boten inzwischen Führungen an, die wissensdurstige Besucher über die Feinheiten der Straußenzucht informierten.
Ein agiler Schwarzafrikaner, der im Blaumann auftrat und sich als Bill vorstellte, führte unsere Gruppe über eine Straußenfarm, erläuterte Größe, Bewirtschaftung und Klimaverhältnisse und zeigte uns die großen Inkubatoren, in deren Fächern Hunderte von Straußeneiern bebrütet wurden. Nach nur sechs Wochen Bebrütung sei es dann soweit, die Straußenbabys krochen aus dem Ei, und wuchsen in separaten Gehegen auf. Allgemeines Erstaunen machte sich breit, als wir zu einem solchen Gehege geführt wurden und wenige Tage alte Straußenbabys erblickten, an denen noch nichts auf ihre spätere Größe hindeutete. Ich notierte: Der Baby-Strauß gleicht einer Ente. Sein Hals wächst erst später. War der Hals erst mal gewachsen und hatten die Strauße ihre stattliche Normalgröße erreicht, war ihr Leben aber auch schon zu Ende, berichtete Bill, denn schon im Alter von vierzehn Monaten würden die Tiere geschlachtet. Für die Straußensteak-Herstellung käme nur der unter den Federn verborgene Oberschenkel in Frage, fügte er hinzu. Die Haut wiederum werde zu Leder für Schuhe und Jacken gegerbt, von denen man sich einige im Souvenirshop der Farm ansehe könne.
Ein längeres Leben war den Tieren auf den Straußenfarmen nur vergönnt, wenn sie sich zur touristischen Präsentation eigneten, etwa als pittoreskes Fotomodell, das zur Freude der Gäste unter einem malerischen Sonnenschutz Eier ausbrütete - oder als besonders angepasstes Exemplar, das seinen Hals herumschwenken ließ, als wäre er ein Gartenschlauch. Besonders zahme Vögel wurden dazu ausersehen, jubelnde Touristen ein wenig durch die Gegend zu tragen, was in Wahrheit eine Gaudi für die Zuschauer war, weil die Reiter/innen immer wieder vom runden Rücken des Tieres mit großem Karacho herunterfielen.
Konnte man solche Darbietungen noch unter Selbstironie abbuchen, wurde es beim finalen Straußenderby ein wenig schräg. Begleitet vom Gejohle der Touristen rannten einige Straußenvögel im Rahmen eins sogenannten „Straußenrennens“ mitsamt ihren "Jockeys" auf den Rücken, einen Imaginären Parcours entlang, während ihre „Reiter“ alle Hände voll zu tun hatten, sich auf dem abschüssigen Rücken der Tiere festzuhalten. Dieses Erlebnis war weder besonders spannend noch lustig, sondern allenfalls lehrreich: Der Strauß mochte zu den dümmsten Tieren des Planeten gehören. Der Mensch aber entpuppte sich in solchen Augenblicken als das Wesen, das im Reich des Lebens zweifellos zur größten Peinlichkeit befähigt war.
***
Die Natur ist der genialste Künstler, welcher Liebhaber der Welt wüsste das nicht? Doch sie benötigt Zeit, jede Menge Zeit, für einen winzigen Kubikzentimeter Form einige Jahrhunderte Witterung und Wind. Wie lange hatte es gedauert, ehe die Swartberg-Höhen und die Outeniqua-Berge entstanden waren, die die kleine Karoo von der Gartenroute trennten? Millionen Jahre war unterirdisches Wasser durch den Fels gedrungen und hatte im Zusammenspiel mit tektonischem Druck und Gesteinshärte die riesigen Cango Caves in der Nähe von Oudtshoorn geschaffen, ein System großer unterirdischer Höhlen mit jahrhunderttausende Jahre alten Stalagmiten und Stalagtiten. Mit 2,7 Millionen Jahren war die sogenannte „Trauerweide“, die älteste Steinstruktur der Cango Caves, älter als die gesamte menschliche Gattung.
Eine Stimmung der Zeitlosigkeit lag über den Outeniqua Mountains, die ich auf meinem Rückweg zur Küste durchfuhr. Die Erde brachte ihre Früchte und Formen hervor und schien sich nicht um das Gewusel auf ihrer Oberfläche zu kümmern. Ein kurzer Regenguss auf der Passhöhe, dann hatte ich wieder die Küstenebene erreicht. George, die nächste Stadt auf der Gartenroute, war ein aufgeräumer Ort, den man durchfuhr wie eine Freiluftausstellung properer Häuser und Straßen. Ein Ort wie ein makelloses Gesicht, von dem nichts mehr in Erinnerung blieb.
Ebenso makellos war der weite, prachtvolle Sandstrand von Wilderness, eine sichelartige Bucht mit sanft auslaufender Dünung – und vollkommen leer. Vielleicht bestand darin eine der Attraktionen Afrikas für den Europäer: in dem ungewohnten Nebeneinander von Schönheit und Menschenleere, auf die die Bewohner urbaner Gesellschaften meist verzichten müssen. Aber die Schönheit ist auch wie ein Gewicht, das alleine nicht leicht zu tragen ist. Manchmal erzeugt sie sogar ein Gefühl der Vereinzelung - gerade so, als könne man die Welt ab einer gewissen Verzauberung nur noch zu zweit ertragen. Aber gottlob besaß ich noch eine zweite Flasche Chardonnay aus Stellenbosch.
Zwei Felsen bewachten den Eingang zur Lagune von Knysa, Die Brandung des Ozeans krachte gegen die Klippen, ein alter Leuchtturm diente als Aussichtspunkt auf die Küste. Zwischen Meer und Land befand sich ein Binnensee, der seine Größe nach dem Rhythmus von Ebbe und Flut veränderte. Kaffernadler zogen ihre Kreise und hielten Ausschau nach Beute. Am Ende des George Rex Drive, der direkt zur Lagune von Knysa führte, hatten Läden, Cafés und Restaurants geöffnet, in denen eine so entspannte Stimmung herrschte, als sei die ganze Küste eine Region des ewigen Friedens. Ich notierte: Die Gartenroute – ein verschönertes Europa auf dem Silbertablett.
Der Ort Plettenberg, die „Perle der Gartenroute“, trug seinen Namen nach Gouverneur Joachim von Plettenberg, der ab 1779 hier eine Verladestation für Holz eingerichtet hatte. Ein Euphemismus dafür, dass die Kolonisten über Swellendam hinaus vorgedrungen waren und damit begonnen hatten, die Küsten abzuholzen. Dann wurde man im 19. Jahrhundert auf die herrliche Lage der Bucht aufmerksam, und wohlhabende Südafrikaner begannen damit, den Ort zu einer mondänen Ferienenklave umzubauen. Villengelände mit üppigen Gärten, breiten Zufahrten und fantastischen Ausblicken auf Küste und Meer entstanden und prägten das neue Bild der der Stadt. Das einzige Handicap, das Plettenberg aus dieser Gründerphase mitnahm, ging auf eine Bausünde zurück, die die Stadtväter begingen, als sie den Neubau eines klobigen Hotelkomplexes direkt am Strand gestattet hatten. Dieser Hotelkomplex, dessen Anblick von den Höhen der Berge aus noch heute störte, teilte den Strandbezirk von Plettenberg in zwei Teile, die sich in nichts voneinander unterschieden und an denen eines unbekannt zu sein scheint: Überfüllung und Bedürftigkeit. Sanft rollte die flache Dünung am über den goldgelben Sand, der Xhosa-Eismann und der Zulu-Getränkeverkäufer staksten heran, ansonsten waren Schwarzafrikaner nirgendwo zu sehen.
Ich fand ein kleines Apartment hoch über der Bucht von Plettenberg gleich neben einem Palmengarten mit einer unverstellten Aussicht auf die gesamte Bucht. Das Meer lag vor mir wie ein tiefblauer Samtbelag, und die Umrisse der Bucht verloren sich im Dunst der östlichen Tsitsikammaberge. Konnte es einen besseren Ort geben, der Bucht von Plettenberg teilhaftig zu werden, als dieser Adlerhorst hoch über der Stadt? Schönheit ist nicht immer nur eine Frage der Form und Stimmung sondern auch der Distanz.
Als ich mit einem Kaffee auf der Veranda saß und dem Zug einer Schönwetterwolke beobachtete, bemerkte ich auf dem Nebenbalkon ein Paar. Der Mann trug Shorts und Unterhemd, hatte die Beine auf die Brüstung der Veranda gelegt und las ein Buch. Auf seiner Stirn befand sich eine steile Falte, die auszudrücken schien: Stör mich nicht. Die Frau, die ihm am Tisch gegenüber saß, war etwas jünger, trug einen knapp sitzenden Badeanzug und lackierte ihre Fußnägel. Die Aussicht auf die Bucht war Nebensache. Ich machte mich bemerkbar. Ein kurzer Gruß, ein Kopfnicken, das reichte offenbar. Dann ging es weiter mit Buch und Zehennägeln.
Am Abend aß ich in „The Plettenberg“, dem besten Hotel der Stadt. Das Lamm war ebenso gut wie der Personalaufwand unglaublich. Man zuckte nur mit irgendeinem Körperteil und schon stand ein Bediensteter am Tisch. Natürlich waren alle Kellner Schwarzafrikaner, und die Gäste waren Weiße, dazu aßen an diesem Abend auch einige Inder und Ostasiaten im Restaurant. Ich dachte daran, was geschehen würde, wenn ich jetzt alleine in einem guten Lokal in Russland oder Thailand säße. In Russland würde ich eine Karte auf dem Tisch finden, auf der mir eine Ludmilla ihre Dienste anbieten würde. In Thailand würde mich die Bardame möglicherweise direkt ansprechen. In „The Plettenberg“ trat der Kellner, nachdem ich zu Ende gegessen hatte, an meinen Tisch und fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, mich in den Garten zu setzen. Als ich bejahte, ergriff er mein Glas und die Weinflasche wie eine Trophäe und führte mich in den Garten, wo ich an einem extra herangeschafften Tisch unter einem prachtvollen Sternenhimmel meinen Wein weiter trinken konnte. Auch das war Afrika, aber nur, wenn man über das nötige Kleingeld verfügte.
In einer anderen Ecke des Gartens saßen meine Apartmentnachbarn, sie bemerkten mich und grüßten kurz und verhalten. Die junge Frau war sündhaft schön, sie hatte ihre Haare kunstvoll hochgesteckt und trug eine Perlenkette um den Hals. Ob ihre Zehennägel inzwischen in Schuss waren, konnte ich aus der Entfernung nicht erkennen, aber unverkennbar war, dass sie ihren Mann mit Missfallen betrachtete. Er ignorierte die unfreundliche Inaugenscheinnahme, der er unterzogen wurde, stellte ein Gesicht wie ein Pokerspieler zur Schau und trank ein Glas Wein nach dem nächsten. Eine Sentenz von Henri de Montherlant viel mir ein. „Immer wenn ich einen durchschnittlichen Kerl mit einem schönen Weib sehe, frage ich mich, was dieser Kerl zu ertragen hat.“ Manchmal bin ich so neidisch, dass ich das nur durch Zitate kaschieren kann.
***
Von Plettenberg aus führte die Straße weiter nach Osten. Kurz vor dem Tsitsikamma Nationalpark stoppte ich an der Bloukran Brücke, der mit 216 Metern höchsten Brücke Südafrikas. Die mächtige Bogenkonstruktion, die dem Reisenden hoch über dem Meer freie Fahrt gestattete, war landesweit bekannt als Absprungrampe für einen der höchsten Bungee-Jumps der Welt. Wenn man den Plakaten glauben durfte, dann rangierte der Sprung von der Bloukran Brücke mit ihrer Höhe von 216 Metern nach der Royal George Bridge in Colorado (321 Meter) als zweithöchster Absprungplatz der Welt. Bezog man Fernsehtürme und Staudämme als Absprungorte mit ein, dann belegte die Bloukran-Brücke immerhin weltweit auch noch den vierten Rang. Dementsprechend war der Andrang. Die Wartezeit von der Buchung eines Sprungs bis zum Sprung betrug zur Zeit etwa zwei Stunden. Obwohl Klienten über sechzig umsonst springen durften, waren es ausschließlich junge Leute, die ein Ticket kauften, und bezeichnenderweise waren in den wartenden Gruppen immer diejenigen ganz gut zu identifizieren, die einen solchen Sprung wagen wollte und jetzt nicht mehr zurückkonnten.
Aus Sicherheitsgründen war der Absprungort in der Brückenmitte abgesperrt, nur die Springer und einige Begleiter durften zur Rampe, die anderen mussten das Ereignis vom Rand der Schlucht aus beobachten. Soweit ich erkennen konnte, dauerte die ganze Prozedur pro Sprung etwa zwanzig Minuten. Der Springer wurde von zwei Betreuern begrüßt und eingewiesen. Dann wurden ihm die Beine reißfest zusammengebunden und mit dem elastischen Bungee-Seil verbunden. Solchermaßen gesichert hoppelte der Klient wie ein Sackhüpfer auf die Rampe und sprang. Manche breiteten die Arme auf und sprangen in dramatischer Pose in die Tiefe, manche ließen sich einfach fallen, und wenn ich mich nicht versehen habe, wurde ein besonders Zögerlicher mit einem kurzen Body Check auf die Reise befördert.
Der Sturz selbst war eine Sekundensache. Der Springer fiel wie ein Stein, das Seil spannte sich, und schon schnellte der Bungee-Jumper bereits wieder in die Höhe und schwang dann am Seil aus. Ein Mitarbeiter des Bungee Teams wurde von oben heruntergeseilt, um dem Klienten beim Hochziehen zu assistieren. Oben wurde der Springer dann von seinen Begleitern mit Klatschen und Händeschütteln empfangen, und schon kam der Nächste an die Reihe.
Wenige Kilometer hinter der Bloukran-Brücke führte ein Stichstraße zum Eingang des Tstitsikamma Nationalparks. Der etwa achtzig Kilometer lange Park war eine wildromantische Küstenlandschaft, deren Berge sich Hunderte von Metern unmittelbar aus dem Ozean erhoben.
Schon bei der Fahrt vom Parkeingang zum Besucherzentrum an der Küste verblüffte der undurchdringliche Bewuchs einer der ältesten Primärwälder Afrikas. So sehr die Portugiesen, Buren, Engländer und Eingeborenen auch das Holz an der Küste geschlagen hatten, in die bis vor einigen Jahrzehnten völlig abgelegenen Bezirke der Tsitsikamma-Küste hatten sie es nicht geschafft - ein Stück Urzeit war erhalten geblieben, und erst mit der Gründung es Tsitsikamma Nationalparks im Jahre 1964 war diese Region der Öffentlichkeit erschlossen worden.
Eine der Hauptattraktionen des Parks war der sogenannte „Big Tree“, dem mit einer Höhe von 37 Metern und einem Umfang von neun Metern größten Yellowood Baum an der Tsitsikamma-Küste. Er konnte zwar weder mit dem Tane Mahua, dem „Herrn des Waldes“ in Neuseeland mithalten und schon gar nicht mit den riesigen Sequoia Tannen und Redwoodbäumen Nordamerikas, aber sympathisch an ihm war, dass als riesige Steineibe der größte Bruder all der kleinen Topfpflanzen war, die unsere Wohnzimmer schmücken. Ich umschritt ihn dreimal, legte meine Hand an seine Rinde und spürte, wie feucht sie war. Für ein Alter von 800 Jahren stand der Big Tree noch ganz schön im Saft.
Das Zentrum des Tsitsikammaparks befand sich an der Mündung des Storms Rivers. Mit ungeheurer Kraft krachten hier die mächtigen Brecher des Indischen Ozeans auf die Klippen. Feuchte Nebelgischt stieg vom Meer auf und umwaberte die dichten Wälder der aufsteigenden Berge. Ich ging so nahe wie möglich an den Rand des Ozeans heran und versuchte, die Elemente der Imposanz zu verstehen: Es war eine Felsenküste, die der Kraft des Ozeans widerstand, und deren Unverrückbarkeit das Meer zu erzürnen schien. Welle auf Welle brach sich am Stein, fraß sich ins Land und würde am Ende obsiegen. Denn die Zeit war immer auf Seiten des Ozeans, wenngleich in unvorstellbaren Intervallen, in denen er das Land hob und senkte, formte und verschlang. In dem Wimpernschlag der Erdgeschichte, in dem ich mich gerade an dieser Küste aufhielt, hatte die Küste die Gestalt eines Dschungels angenommen, durch die sich die Besucher bewegten, als seien sie nur Gäste in einem Park aus vormenschlichen Zeiten. Tatsächlich existierte am Ufer des Storms-River eine sogenannte Strandloiper Grotte in denen Überreste der Khoisan gefunden worden waren, die die Küste lange vor der Ankunft der Weißen und der Bantus besucht hatten.
Je tiefer ich in den Wald eindrang, desto bemooster wurden die Baumrinden. Bartflechten hingen von den Zweigen herab, rund um die Stämme vermoderten Gräser und Blätter. Die Kronen der Yellowwood Bäume mit ihren meterdicken Stämmen verloren sich im Dunkel des Waldes. Mitunter schlossen sich die Baumkronen wie Dächer über den Wegen, dann wurde es dunkel, und nur das Glucksen des allgegenwärtigen Wassers war zu hören.
Eine beachtlich schwankende Hängebrücke führte über den Storms River auf die andere Seite des Flusses zu einem Aussichtspunkt. Im Angesicht der stürmischen Küste, so nahe am Tosen des Ozeans, benetzt von der salzigen Gischt, die als Nebel die Küste emporstieg und bedrängt vom überbordenden Wald in meinem Rücken empfand ich die Unmittelbarkeit der Elemente wie einen Schock. Es kam mir so vor, als würde ich über einen Abgrund gehalten, als erlebe ich in der engen Verklammerung von Ozean, Dschungel und Berg eine Art Urszene mit all ihren archetypischen Ängsten vor einer übermächtigen Natur.
***
Langsam näherte sich meine Reise über die Gartenroute ihrem Ende. Mein letzter Stopp vor Port Elisabeth war Jeffreys Bay, ein Ort an einer flachen Dünenküste, die unter Surfern für ihre Wellen berühmt war. Ich notierte: die höchste Brücke, der dickste Baum, die längste Welle, die Gartenroute ist eine Region der Superlative.
Meine Unterkunft in Strandnähe war einfach und überteuert, denn es war Surferzeit, und die ganze Stadt war voller junger Leute, die nichts anderes im Sinn hatten, als den lieben langen Tag auf möglichst hohen Wellen zu reiten. Beim Frühstück in einem schmucklosen Kantinenraum mit Fensterblick zum Strand lauschte ich den Fachgesprächen an den Nebentischen, locker dahingeworfenen Bemerkungen über Sweel, Bottom Turn, Line in und Interlupe und bewunderte die heldische Aura von Kraft und Gesundheit, die von den jungen Männern und Frauen ausging. Viele „ Locals“ (so nennt man die Surfer, die an ihrem Heimatstrand surfen) waren anwesend, aber auch viele Surfer aus den USA und Europa, unter ihnen einige Farbige und Ostasiaten.
Jack, ein junger Südafrikaner aus Durban setzte sich an meinen Tisch und erzählte dass ihm sein Surfbrett gestohlen worden sei. Das sei ein Jammer, weil gerade jetzt die Wellen besonders gut seien. Dem stimmten zwei Kalifornier zu, die sich zu uns an den Tisch gesellten. Sie stammten aus Huntington Beach zwischen Los Angeles und San Diego, einem Ort, der für jeden Surfer offenbar als allererste Adresse galt.
„Was hast du denn für ein Surfbrett?“ fragte mich einer der Kalifornier.
„Ich besitze kein Surfbrett. Ich surfe nicht.“
„Ja, was machst du denn in Südafrika?“ fragte Jack
„Reisen“
„Reisen, wohin?“
„Einfach weiter“, gab ich zurück
„Einfach weiter“, lachte einer der beiden Kalifornier, „bis die Welle bricht.“
Gutmütiges Schmunzeln allenthalben. Ein nichtsurfendes Unikum hatte es nach Jeffreys Bay verschlagen wie einen Hasen in einen Fuchsbau. Ein solcher Mensch war zwar zu bedauern, verdiente aber Nachsicht. Und vielleicht die eine oder andere Erklärung, was das Surfen betraf.
Als ich am Nachmittag mit Jack am Strand saß, fragte ich: „Warum sind denn die Wellen von Jeffreys Bay so berühmt? So windig ist es hier doch gar nicht.“
Jack lag auf seine Ellbogen gestützt im Sand, beobachtete die Wellenreiter und kniff die Augen zusammen. Ob ihn meine Frage ob ihrer Naivität quälte, erkannte ich nicht, denn er antwortete sofort: „Die Höhe und die Form der Wellen haben weniger mit dem Wind als mit der Dünung (Swells) zu tun.“ Es sei die Bodengestalt des Strandes, die die Höhe und die Länge der Wellen in der auslaufenden Brandung beeinflusse. An manchen Strandabschnitten von Jeffreys Bay gäbe es drei bis vier Meter hohe Wellen, an denen nicht nur ihre Höhe sondern auch ihre Länge bemerkenswert sei, ebenso wie die Art ihrer Links- und Rechtsbrechung, die dem erfahrenen Surfer die gewagtesten Manöver erlaubten. Wenn ich ehrlich bin, dann erzählte er noch viel mehr über das Surfen, über Weltmeister und ihre Tricks, von guten und schlechten Brettern und von der Traumwelle, dem Interlupe, der man hier in Jeffreys Bay begegnen könne. Ich hörte zu so gut ich konnte, verstand aber nicht alles und versuchte, das, was ich von Jack hörte mit dem, was ich am Strand sah, in Einklang zu bringen. Das wollte mir aber nicht recht gelingen, denn praktisch sah ich immer nur das gleiche: stattliche Wellen, die von morgens bis abends herangebrandet kamen und Surfer aus aller Herren Länder, die sich bemühten, auf den Wellen zu reiten. Wenn ihnen das gelang, ließen sie sich von der Welle tragen, erhoben sich, als sei es die einfachste Sache der Welt, um ihren möglichst spektakulären Wellentanz auf dem Wasser zu beginnen. Immerhin erkannte ich, dass die langen Wellen einen Brechungspunkt besaßen, der sich entweder links oder rechts befand und dass die Surfer optimalerweise immer haarscharf vor diesem Brechungspunkt auf der noch intakten Welle surften. Die Körperbeherrschung, die dabei zu beobachten war, grenzte ans Wunderbare, manchmal, wenn ein Surfer mit seinem Brett einen Loop schlug, kam es mir vor, als sei die Schwerkraft aufgehoben, ganz zu schweigen von der beachtlichen Ästhetik, die ein minutenlanger Ride auf einem Wellenkamm selbst für einen Ahnungslosen wie mich beinhaltete.
Am nächsten Morgen traf Jacks neues Surfbrett ein. Er war ganz aus dem Häuschen vor Freude und konnte es kaum erwarten, ans Meer zu kommen.
„Gibt es irgendeinen Rat, den du mir für Durban mitgeben kannst?“, fragte ich zum Abschied.
„Ja, schnell weiterreisen.“