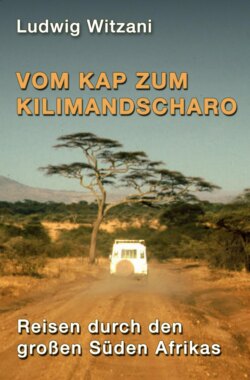Читать книгу Vom Kap zum Kilimandscharo - Ludwig Witzani - Страница 9
Stadt mit doppeltem Boden Tage in Kapstadt
ОглавлениеDie 747 flog eine Schleife und leitete den Landeanflug ein. Unter uns erstreckte sich eine grüne Hügellandschaft wie ein verdoppeltes Europa am anderen Ende der Welt. Ineinander verkeilte Wolkentürme markierten den Schnittpunkt zweier Ozeane, die Ausläufer ihrer stürmischen Winde versetzten die Maschine in leichte Vibration. Gebirgszüge umrahmten weite Anbauflächen, die von oben einer Strichzeichnung glichen, als wolle sich die Fruchtbarkeit des Südens als abstrakte Skizze in den Himmel projizieren. Willkommen in einer der schönsten Landschaften der Erde.
Noch beeindruckender war die Anreise über Land. Nach der langen Wüstenfahrt durch die lebensfeindliche Leere der Namib und die nördliche Kapprovinz wurde die Bucht von Kapstadt sichtbar. Zunächst war es nur der Tafelberg, der wie ein Monolith am Horizont emporwuchs. Dann differenzierte sich das Bild. Vom Bloubergstrand aus waren die weißen Gebäude der Stadt wie eine zweite Dünung zu erkennen. Weit und menschenleer zog sich die Bucht nach Süden, vorüber an Sandstränden, Pinguinkolonien und der ehemaligen Sträflingsinsel Robben Island, vorbei an Restaurants und Strandhäusern, bis die Straße das unmittelbare Einzugsgebiet Kapstadts erreichte, wo der gigantische Tafelberg alles überwölbte.
Was ist die schönste Stadt der Welt? An Nominierungen für diesen Ehrentitel besteht kein Mangel. Alexander von Humboldt hatte Salzburg in die engere Wahl gezogen. Für André Malraux war es Venedig, für den brasilianischen Romancier Jorge Amado Salvador de Bahia, und für Woody Allen stand New York ganz oben auf dem Treppchen. Meine Favoriten waren Rio de Janeiro und Istanbul, aber Kapstadt gehörte zweifellos mit in die engere Wahl. Aber was waren die Elemente dieses Rankings? Historisches Flair? Die Landschaft, in die die Stadt eingebettet war? Ihre Bausubstanz, ihr kulturelles Leben? Oder ihre Peripherie - dann allerdings müsste Kapstadt als Kandidat sofort von dieser Liste verschwinden,
Denn wenn man sich der Stadt von Osten näherte, vorbei an den Squattersiedlungen und Townships im Umkreis des Flughafens, dann verschwanden Schönheit und Wohlgestalt wie weggeblasen. „Er ist nicht einmal drei Monate fortgewesen“, ließ der südafrikanische Nobelpreisträger J.M. Coetze dseinen Protagonisten David Lurie in dem Roman „Schande“ sinnieren, „doch während diese Zeit waren die Elendsviertel über die Autostraße hinweg gewachsen und hatten sich östlich vom Flughafen ausgebreitet.“ Das war nun auch schon einige Jahre her, und längst hatten sich die Townships noch näher an Flughafen und Peripherie herangearbeitet Überall an den Straßenrändern standen Männer, Frauen, Jugendliche und suchten nach einer Mitfahrgelegenheit in die Stadt, weil der öffentliche Nahverkehr nicht funktionierte. Zigtausende fuhren aus den Cap Flats alltäglich in die Stadt zur Arbeit, hinein in das Zentrum der glänzenden Metropole, um sie am Abend wieder zu verlassen, um in die Tristesse ihrer Blechhütten zurückzukehren.
Eine Generation nach dem großen Wandel am Kap hatte sich die Situation der schwarzafrikanischen Mehrheitsbevölkerung nicht entschieden verbessert. All die Mittel, die für Elektrifizierung der Townships und Vorstädte, für Abwasserkanäle, Schulen, Krankenhäuser und Verkehrsverbindungen ausgegeben worden waren, hatten den Lebensstandard nicht angehoben. Mit dem explosionsartigen Wachstum der schwarzafrikanischen Bevölkerung hielt die Ausweitung des öffentlichen Wohlfahrts- und Infrastruktursektors einfach nicht mit. Das Land stöhnte unter überbordender Kriminalität, exzessivem Alkoholismus und Drogenmissbrauch - nicht überall sichtbar, aber an den Rändern der großen Städte schmerzhaft präsent. Die Zeitungen waren voll von Berichten über „Tik“, eine leicht herzustellende Massendroge auf Amphetaminbasis, die persönlichkeitsverändernd wirkte und die sozialen Beziehungen zerstörte. Längst war der ANC, der African National Congress, der vor einer Generation den Wandel am Kap erkämpft hatte, in Inkompetenz und Korruption erstarrt. Auf Nelson Mandela, die Lichtgestalt des späten 20. Jahrhunderts, war Präsident Zuma gefolgt, ein Vergewaltiger und Schieber, der nur durch die noch leidlich funktionierenden Institutionen der Gewaltenteilung an der Aufrichtung einer Diktatur gehindert wurde.
Dann wieder ganz andere Bilder im Zentrum von Kapstadt, so krass und unvermittelt, als hätte man das Fernsehprogramm gewechselt. Die bunten Straßenszenen an der St. Georges Mall, die einladenden Restaurants an der Waterfront und die herausgeputzten Fassaden des Bo-Kaap-Viertels befanden sich ein Universum entfernt von den überfüllten Townships, die ich gerade erst passiert hatte. Kapstadts urbanes Zentrum präsentierte sich wie eine Prosperitätszone aus einem anderen Kontinent, eine Region der Reichen und Etablieren, die in ihren Premium-Limousinen vor Markengeschäften parkten, in denen die gleiche Mode verkauft wurde wie in London oder New York. Große Bürokomplexe beherbergten die Firmenzentralen internationaler Konzerne, die die immensen Bodenschätze vermarkteten, die Südafrika noch immer zum wirtschaftlich stärksten Land Afrikas machten.
Erst auf den zweiten Blick wurde eine Doppelbödigkeit sichtbar, die mir auf meiner Reise durch Südafrika noch oft begegnen sollte. In einem Hauseingang lag ein schwarzafrikanischer Obdachloser, betrunken oder vom Rauschgift benebelt. Bettler saßen vor den Eingängen der Kaufhäuser, und in den Seitenstraßen türmten sich die ersten Müllhaufen - wohlgemerkt, alles nicht so aufdringlich und bildfüllend wie in Daressalam oder Lusaka, aber unverkennbar gegenwärtig als Indiz dafür, dass auch diese Stadt der Ersten Welt von den Armeen der Armut bedroht wurde. Noch fuhren die Weißen in stattlichen Limousinen durch die Stadt, während ihnen die schwarzen Dienstleister die Parkplätze freihielten, aber die Zahl der bettelnden Kinder, die wie ausgemergelte kleine Trolle vorbeihuschten, nahm zu. So schnell konnte die Polizei sie gar nicht wegschaffen, dass die Touristen ihre Auftritte nicht bemerken würden.
Beim Abendessen im Hotelrestaurant hoch über der Stadt saßen zwei Touristen aus England am Nebentisch, beide waren leger gekleidet, einer trug eine Kappe auf dem Kopf. Ein Kellner trat an den Gast heran und bat ihn, die Kappe abzunehmen, was den Gast offenbar erstaunte, ehe er nach kurzem Zögern dem Wunsch nachkam. Die Pointe dieser Szene bestand darin, dass der Restaurantangestellte, der den Gast aufgefordert hatte, seine Kappe abzunehmen, ein Schwarzer war und der Gast weiß. Ich blickte mich um und sah, dass alle Kellner schwarz waren und die Gäste weiß. Nur eine indische Familie, Mutter Vater, zwei Töchter, saßen an einem Fenstertisch, alle akkurat gekleidet und ersichtlich darauf bedacht, die Formen zu wahren.
Eine Metapher von Peter L. Berger fiel mir ein, der in der globalisierten Welt zwei Kategorien von Menschen unterschied: die „Wahlschweden“ und die „Wahlperser“. Die „Wahlschweden“ lebten in der belle Etage, ihr Alltag und ihre Fortbewegung vollzogen sich einfach und unkompliziert, weil in der Parterre die „Wahlperser“ die Dienstleistungen und Kärrnerarbeiten ausführten
In der Nacht fielen Schüsse. Dann hörte ich Geschrei auf den Straßen, schließlich die Sirene eines Polizeiwagens. Am Morgen wurde berichtet, dass sich vor dem Hotel ein Überfall ereignet hatte. Ein japanisches Paar war von einem Jugendlichen mit einer Pistole bedroht worden. Als die Angegriffenen fliehen wollten, hatte der Räuber geschossen, sein Ziel aber verfehlt. Dann war er verschwunden, die Polizei fahndete nach ihm.
„Ist das normal hier in der Innenstadt?“ fragte ich den Rezeptionisten. Sein Name war William, er war ein junger Schwarzafrikaner, der seinen Dienst mit großer Zuverlässigkeit versah und den Touristen Taxifahrer für Stadtrundfahrten vermittelte. Williams Hemd war faltenlos gebügelt, die Krawatte saß wie angeschweißt, seine langen, schlanken Hände waren gepflegt. „Manchmal geschieht so etwas nach Anbruch der Dunkelheit“, antwortete er mit einer sonoren Stimme. „Meistens handelt es sich um Drogensüchtige, die Geld für ihre tägliche Ration benötigen“, fügte er hinzu. „Tik?“ fragte ich. „Ja, Tik und alles Mögliche“, antwortete er. „Aber die Polizei hat die Lage im Griff.“
Da hatte ich meine Zweifel, denn bekanntermaßen war die Polizei chronisch unterbezahlt und für Mauscheleien und Schiebungen anfällig, Kaum ein Tag verging, in dem nicht ein entsprechender Fall im Fernsehen oder in den Tageszeitungen veröffentlicht wurde. Was sollten sich die Polizisten denn auch an Recht und Gesetz halten, wenn selbst der Präsident korrupt war? Als ich den Wagen aus der Tiefgarage fuhr, wartete ich an einer Kreuzung. Die Ampelanlage war ausgefallen, ein Polizist versuchte, den Verkehr zu regeln, doch niemand achtete auf seine Signale.
***
„Das Wetter ist das Einzige, was sich in den letzten Jahren nicht verschlechtert hat“, hieß es in Kapstadt. Wenigstens das schien zu stimmen. Ein strahlender Himmel wölbte sich über der Stadt, keinerlei Schwüle war zu spüren, denn die Wärme des Indischen Ozeans wurde durch die kühlen Winde des kalten atlantischen Benguela-Stroms gemildert. Gemeinsam erzeugten sie eine Atmosphäre der Mediterranität, für die Kapstadt berühmt war. Auch von den Smogproblemen, unter denen andere afrikanische Großstädte litten, blieb Kapstadt verschont, denn der "Cape-Doctor", wie die Einheimischen den Wind von Kapstadt nannten, zog wie eine immerwährende Frischluftzufuhr durch die Stadt. Allerdings erzeugte der Cap Doktor zugleich eine nahezu notorische Wolke über dem Wahrzeichen Kapstadts, dem Tafelberg. „Tischtuch des Teufels“ nannten die Capetonians die schwarzdunkle Wolkenfront, die tatsächlich wie eine zu lang geratene Tischdecke über die Ränder des Tafelberges schwappte und fast bis an die Dächer der Wohnviertel reichte.
Aber nicht heute. Der Berg war frei, keine Wolke nirgends. Ich fuhr zur Talstation der großen Tafelberg-Seilbahn, reihte mich in eine lange Menschenschlange ein, die sich aber schnell auflöste, weil die Gondeln riesig waren. Die Kabinen der Tafelberg-Seilbahn waren komplett verglast und drehten sich langsam um ihre eigene Achse, eine Vorsichtsmaßnahme, die verhindern sollte, dass Schieflagen während der Fahrt entstanden, wenn alle Insassen immer zu den besten Aussichtspunkten strebten.
Der Rundblick von den Höhen des Tafelberges auf das Südende des afrikanischen Kontinents gehört zu den großen Panoramen der Erde. Wie der Fantasie von Renaissancemalern entsprungen, erhoben sich die Berge an den Rändern des Bildes und rückten an die Stadt heran. Es sah so aus, als griffe die afrikanische Topografie aus dem Norden nach Afrikas südlicher Stadt. Dann ein ganz anderer Anblick in südlicher Richtung. Von Wolken wie von Lametta umgeben, verloren sich die Ausläufer der Kap Halbinsel im Dunst, während sich tief unter mir die große Stadt wie ein weichgezeichnetes Fresko aus Straßen, Plätzen und Fassaden präsentierte. Und doch war es der Ozean, der mit seiner Unendlichkeit die Szenerie beherrschte. Seine undimensionierte Weite besaß eine fast bestürzende Präsenz, gerade so, als sei es möglich, mit bloßen Händen den Horizont zu berühren.
Aber was war mit der Stadt zu meinen Füßen? Eine besondere Kontur konnte ich nicht erkennen, außer dem Signal Hill, der die Waterfront und das Hafenbecken von den Wohnvierteln am Atlantik trennte. Sonst erstreckte sich die Stadt in ganz leichter Schräge vom Tafelberg dem Meer entgegen, wurde immer flacher, je mehr der Blick in die Peripherie schweifte.
Die ersten Europäer, die von der Spitze des 1085 Meter hohen Tafelbergs auf das südliche Afrika herabgeblickt hatten, waren die Portugiesen gewesen. Fast ein ganzes Jahrhundert lang hatten sie die Küsten Afrikas erkundet, um einen Seeweg nach Indien zu finden, immer weiter hatte sie der Drang nach Süden geführt, vorüber an Wüsten, Riffen und Urwäldern, bis der Portugiese Bartholomeo Diaz im Jahre 1487 das Kap erreichte. Hier war er in einen lebensgefährlichen Sturm geraten, den er nur mit Glück überstanden hatte, weswegen er dem Kap den Namen „Kap der Stürme“ gab. Bekanntlich hatte König Manuel I von Portugal diesen Namen später in „Kap der Guten Hoffnung“ geändert, seine Seefahrer aber trotzdem angewiesen, ihre Versorgungstationen etwas weiter östlich, in der Mossel Bay, einzurichten. Erst im Jahre 1503 - der unglückliche Bartholomeo Diaz war auf einer zweiten Kap-Reise bereits mit Mann und Maus ertrunken – hatte eine portugiesische Expedition den Tafelberg etwas genauer erkundet. Außer Heidekraut und Klippschiefern fanden sie nichts und rückten wieder ab.
So gingen weitere anderthalb Jahrhunderte ins Land, ehe sich die Holländische Ostindiengesellschaft dazu entschloss, in der Tafelbucht einen Stützpunkt einzurichten. Längst hatte das portugiesische Kolonialreich den Zenit seiner Macht überschritten. Holländische Handelsschiffe beherrschten den Welthandel auf der langen Route zwischen Amsterdam und den Gewürzinseln östlich von Java. Gesagt, getan, mit drei Schiffen und neunzig Mann Besatzung landete der niederländische Expeditionsleiter Jan van Riebeeck am 6. April 1652 in der Bucht von Kapstadt. Allerdings traf er dort auf kein leeres Land. Schon seit vielen Jahrtausenden war der Süden Afrikas von dem kleinwüchsigen Volk der Khoisan bewohnt, die, aufgeteilt in zahllose Stämme, als Nomaden und Viehzüchter zwischen Sambesi und Kap lebten. Jan van Riebeeck hatte übrigens ausdrücklich nicht den Auftrag erhalten, eine Kolonie zu gründen. Seine Mission sollte sich auf die Sicherstellung der Versorgung holländischer Schiffe beschränken. Da kamen die Khoisan als Handelspartner und Fleischlieferanten ganz recht. Soweit die Pläne der Handelsherren in Amsterdam. Leider gab es bald Krach zwischen Holländern und Khoisan, weil die sich die Khoisan weigerten, ihre elementare Subsistenzwirtschaft auf die Bedürfnisse der Holländer auszurichten. Sie aßen ihr Gemüse lieber selber und hatten keine Lust, ihr Vieh für holländische Matrosenmahlzeiten zu schlachten. So mussten die Holländer selber ran, zuerst als ehemalige Angestellte der Ostindiengesellschaft, die sich in Farmer verwandelten, dann kamen die ersten Freibürger aus Europa. Sie wurden als Viehzüchter und Gemüsefarmer die ersten Buren (=Bauern).
Die holländische Landnahme am Kap ist oft mit anderen europäischen Kolonisationsbewegungen verglichen worden. In den nordamerikanischen Neuenglandstaaten hatten es die Briten von Anfang an auf die Ansiedlung und Inbesitznahme neuer Gebiete durch Massenansiedlung abgesehen. Dieses Projekt führte langfristig zur faktischen Vernichtung der Ureinwohner. In Brasilien hieß das Modell Vermischung – Portugiesen, Spanier, Holländer, Schwarzafrikaner und Indios vermischten sich in einem jahrhundertelangen Prozess im Melting Pot der brasilianischen Nation. In Südafrika war es eine Landnahme per Separation. Die Weißafrikaner und Schwarzafrikaner vermischten sich nicht sondern separierten sich zu einer in zwei große Ethnien gespaltenen Bevölkerung.
Ich setzte mich auf einen Felsvorsprung und blickte über Stadt und Bucht. Es war Nachmittag geworden. und die Konturen des tief unter mir liegenden Kapstadts traten schärfer hervor. Wo war das historische Zentrum der Stadt? Mit dem Fernrohr suchte ich die Straßenzüge ab, identifizierte die City Hall, den Botanischen Garten, das Parlament und schließlich das Castle of Good Hope, den städtebaulichen Ursprung der Stadt. Es waren winzige Reste einer langen Geschichte, die im Betonmeer der neuesten Zeit kaum noch erkennbar waren. *
Auch aus der Nähe betrachtet war das Castle of Good Hope nichts weiter als eine kleine Festung, die anfangs nur die Grenzen der holländischen Niederlassung markiert hatte. Als die Beziehungen zu den Khoisan schlechter geworden, waren, hatte man Mauern und Schießschächte hinzugefügt. Trotzdem war das Fort eine verhältnismäßig kleine Anlage geblieben, eine Art Bonsai-Festung, die niemals einem ernsthaften Angriff standhalten musste. Ohne einen Kanonenschuss war die Festung im Jahre 1795 in die Hand der Briten gefallen, die die Kapkolonie von den Holländern übernahmen. Fast genau zweihundert Jahre später, als Nelson Mandela nach seiner Freilassung im Februar 1990 vor Hunderttausenden Schwarzafrikanern seine erste Rede vom Balkon der benachbarten City Hall hielt, hatten weiße Soldaten auf den begrünten Mauern des Forts gestanden und den Anbruch einer neuen Zeit beobachtet. Vier Jahre später, nach den ersten freien Wahl in Südafrika, war der Machtwechsel am Kap durch die Schlüsselübergabe des Castles of Good Hope an die neue Mandela-Regierung symbolisch vollzogen worden. Damit war die kleine Festung an das Ende ihrer aktiven Geschichte angekommen und verwandelte sich folgerichtig in ein Museum.
Ob man die Gebrauchsgegenstände, Dokumente, Zeichnungen und Karten, die das Museum präsentierte, wirklich gesehen haben musste, wollte ich nicht beurteilen. Beeindruckend aber war die Anlage als solche, der Hof, das Tor, die niedrigen Wälle, auf denen das Gras der Geschichtslosigkeit wuchs - ein Memento mori der Vergänglichkeit, um die eine Millionenstadt herumgewachsen war.
Nur wenige Gehminuten vom Castle of Good Hope entfernt befand sich die zweite Keimzelle der Stadt, "The Company´s Garden". Es handelte sich um jenen Ort, an dem sich die Holländer zuerst mit dem Anbau von Gurken, Tomaten, Karotten und Spinat versucht hatten, um die holländischen Seeleute auf der Durchreise mit einer gesunden Kost zu versorgen. Nur mit dem Weinanbau hatte es in "The Company´s Garden" nicht klappen wollen. Was die Vögel von den Trauben übriggelassen hatten, soll derart nach Essig geschmeckt haben, dass die Matrosen den Kapstädter Fusel in den Indischen Ozean kippten. Erst mit der Ankunft der Hugenotten am Ende des Siebzehnten Jahrhunderts sollte die Etablierung des Weinanbaus in Constantia, Stellenbosch und Franshoek gelingen.
Heute war „The Company´s Garden“ der Botanische Garten der Stadt, ein weiträumiger Erholungspark, in dem sich die Capetonians, ob schwarz oder weiß, an Springbrunnen, schattigen Bänken und einem Querschnitt der südafrikanischen Vegetation erfreuen könnten – wenn sie nur Zeit hätten und darauf achten würden, vor Einbruch der Dunkelheit das Weite zu suchen.
Die Skulpturen, die die Parkwege und kleinen Plätze säumten, wirkten in ihrer Beliebigkeit wie eine Bekräftigung dafür, dass die Entstehungsgeschichte Kapstadts langsam im Halbdunkel der historischen Vergesslichkeit verschwand. Nur für das Standbild des Briten Cecil Rhodes galt das nicht. Stolz, überlebensgroß und gerade stand das Abbild des in Wahrheit kränklichen Mannes auf einem Podest im Botanischen Garten und wies mit dem rechten Arm nach Norden. Vom „Kap bis Kairo“ sollte sich das Britische Empire erstrecken, und zur Verwirklichung dieses Zieles war Cecil Rhodes jedes Mittel recht gewesen. Als zeitweiliger Premierminister der britischen Kapprovinz und Miteigentümer des Diamantenmonopolisten de Beers war er zum Todfeind der freien Burenstaaten geworden, die den Briten durch ihre bloße Existenz am Ende des 19. Jahrhunderts die Ausdehnung nach Norden versperrten. An der Vorbereitung des Großen Burenkrieges und der Unterwerfung der Matabele und Shona im heutigen Simbabwe war er ebenso beteiligt gewesen wie an der Ausbeutung der schwarzafrikanischen Arbeiterschaft in den Diamantenminen. Dass sein Denkmal überhaupt noch im Botanischen Garten von Kapstadt stand, war Nelson Mandela zu verdanken, der verkündet hatte, man müsse auch von den Fehlern großer Männer lernen.
Hundert Jahre nach Cecil Rhodes Tod war die Zeit über ihn hinweggegangen. Die nach ihm benannten Kolonien Nord- und Südrhodesien waren als Sambia und Simbabwe längst eigene Staaten geworden. Und auch in Kapstadt war vom berühmt-berüchtigten Premierministers der Kapprovinz nichts weiter geblieben als eine rege Population graubrauner Eichhörnchen, die Rhodes von Europa nach Kapstadt gebracht hatte und die sich heute von den Touristen in "The Garden" durchfüttern ließen.
Während meiner Spaziergänge durch den Botanischen Garten lag eine eigenartige Leere über dem Park Zeitweise kam es mir so vor, als befände ich mich wie schon im Castle of Good Hope in einem verwunschenen Garten, in einem Stück eigener Wirklichkeit, das mit dem realen Leben der Menschen dieser Stadt nichts mehr zu tun hatte. Ich hörte das Knacken der Zweige, das Rascheln im Gras, Vogelgezwitscher in den Bäumen, vermischt mit dem entfernten Rauschen der Stadt. Dann wurde ich müde, legte mich auf die Wiese und schlief ein.
Ich erwachte, als ein Kind versuchte, mir die meine Kameratasche unter dem Kopf wegzuziehen. Ich hatte mir die Schlaufe vorsichtshalber um den Hals gewunden, so dass der Versuch misslang. Trotzdem dauerte es einige Sekunden, ehe ich begriff, was geschah. Der Junge, ein mageres Bürschchen mit kurzer Hose und zerrissenem Shirt, war genauso erschrocken wie ich, als ich die Augen öffnete. Sofort ließ er den Gurt los und verschwand wie der Blitz im Unterholz. Warum hatte er mich nicht nach etwas Geld gefragt, ich hätte es ihm freiwillig gegeben.
Als ich ins Hotel zurückkam, entnahm ich den Schlagzeilen der ausliegenden Tageszeitungen, dass am Signal Hill zwei Überfälle stattgefunden hatten. Eine Touristengruppe war von einer Horde Jugendlicher umzingelt und gezwungen worden, ihre Wertsachen herauszurücken. In der Nähe des Western Boulevards war ein Anwohner bei einem Einbruch erschossen worden.
Beim Abendessen im Hotelrestaurant trug niemand eine Kappe. Ich kam mit einem deutschen Geschäftsmann ins Gespräch, der sich im Auftrag einer Baufirma in Kapstadt aufhielt. Er stellte ich als Wilfried vor, war leger gekleidet und verfügte über einen gesegneten Appetit. Er aß eine Suppe, ein Straußensteak mit Beilage samt Nachtisch und trank eine ganze Flasche Chardonnay, ehe er die nächste Flasche Wein bestellte und mich zu einem Glas einlud.
Er fragte mich nach meinen Reiseplänen, hörte aber kaum zu und begann seinerseits von seinen Reisen zu erzählen. Wie es aussah, saß ich mit einem Afrikakenner am Tisch, der geschäftlich sehr weit herumgekommen war. Wilfried war ein Freund des „schwarzen Kontinents“, aber mit der Richtung, die dieser Kontinent nahm, nicht einverstanden. Das galt sowohl für die allgemeine Entwicklung, die der afrikanische Süden eingeschlagen hatte, wie auch für die konkreten Missgeschicke die Wilfried widerfahren waren. Der Taxifahrer hatte ihn übers Ohr gehauen, ein herbeigerufener Polizist hatte sich als unkooperativ erwiesen, und außerdem war ihm sein Hotelzimmer viel zu laut.
„Früher war Kapstadt einmal der Himmel auf Erden gewesen“, beschloss er seine anekdotischen Klagen. „Ich habe zeitweise sogar überlegt, nach Südafrika auszuwandern.“
Ich erzählte, dass mein älterer Bruder in den Sechzigern einige Jahre in Südafrika gelebt und immer nur von dem Land geschwärmt habe.
„Ja, in den Sechzigern“, antwortete Wilfried und machte eine wegwerfende Handbewegung. „Da herrschten hier für einen Weißen paradiesische Zustände“. Er machte eine Pause und blickte mich prüfend an, ob ich begriffe, was er sagte. „Aber das ist vorbei. Hier gehen bald die Lichter aus“, fuhr er fort. „Freunde von mir, die im Norden von Kapstadt ein kleines Haus gekauft haben, sind bereits sechsmal ausgeraubt worden. Nun wollen sie es verkaufen und zurück nach Deutschland. Nur, es kauft keiner zu vernünftigen Preisen. Sie werden darauf sitzen bleiben.“
„Und es ist keine Besserung in Sicht?“ fragte ich.
„Nein“, erwiderte Wilfried. „Ganz im Gegenteil. Jetzt ist das Drogenproblem von Johannesburg nach Kapstadt übergeschwappt. Die meisten Jugendlichen sind doch süchtig und machen alles, um an Geld für Drogen zu kommen. Da man aber die eigenen Leute in den Townships nicht mehr ausrauben kann, weil sie einfach nichts haben, unternehmen die Jugendlichen nun Raubzüge in die Innenstadt.“
Ich dachte, an den Kleinen, der meine Fototasche hatte stehlen wollen. Ob der auch schon ein Drogenproblem hatte? fragte ich mich.
„Wollen sie noch etwas Wein?“ fragte Wilfried.
Ich lehnte dankend ab.
***
Die nächsten Tage in Kapstadt ließ ich mich treiben, nicht unbedingt in die Vorstädte, aber durch die Straßen des Zentrums, über die Märkte und Plätze bis hin zur Waterfront. Im Botanischen Garten hielt ich Ausschau nach dem kleinen Dieb, sah ihn aber nicht wieder. Ganz allein stand ich vor der neoklassizistischen Fassade des Parlamentsgebäudes. Kapstadt war eine der beiden Hauptstädte Südafrikas und Sitz des Parlaments. Die andere Hauptstadt Pretoria im Norden war der Sitz der Regierung. Die obersten Gerichte saßen übrigens weder in Kapstadt noch in Pretoria sondern in Bloomfountain und Johannesburg.
Überall in der Innenstadt waren Plakate geklebt worden, auf denen eine Politik der Harmonie propagiert wurde, eine Art Zusammenklang von Erster und Dritter Welt als sogenannte „Regenbogennation“, die mir aber vorkam wie eine schadhafte Tünche, die jeden Tag durch den bloßen Augenschein widerlegt wurde. Ich besuchte den Busbahnhof von Kapstadt und sah fast nur Schwarzafrikaner. Die wenigen Weißen, denen ich auf den Rampen begegnete, wirkten abgerissen und erschöpft. Auf dem Greenmarket Square trank ich einen Kaffee und beobachtete Passanten, die apathisch auf den Bänken saßen und in die Luft starrten. Mehrfach wurde ich angebettelt, aber auch in Ruhe gelassen, wenn ich nichts geben wollte. Einmal gab ich etwas und war sofort von einer ganzen Meute umringt, die auch eine Spende haben wollte. Eine Gruppe farbiger Jugendlicher sang vor der Grote Kerk an der Adderley Street fetzige Gospels, die Kasse klingelte, das Geschäft florierte, doch die Stimmung hatte etwas Maskenhaftes, gerade so, als agiere man
in einer surrealen Performance, die im nächsten Augenblick umschlagen konnte. In einer Seitenstraße rappten die Verkäufer zum Takt der Musik und brachten mit Humor und Geschick ihre Platten und Kassetten für wenige Rand an den Mann. Doch ein flüchtiger Blick unter den Tisch zeigte, dass dort Handfeuerwaffen bereitlagen. Schwarzafrikaner offerierten ihre Waren auf dem Grand Parade Market vor der City Hall, weiße Kundschaft aber war kaum zu sehen, als gehöre das Warenangebot in eine andere Welt.
Stück für Stück enthüllte sich mir die verborgene Semiotik Kapstadts und ich erkannte, dass die Lage viel heikler war, als ich angenommen hatte. In der Nähe von Banken oder Juwelieren standen scheinbar beiläufig Männer in den Hauseingängen. Erst beim zweiten Blick sah man die Schnellfeuerwaffen, die sie dicht an ihren Körper trugen. Es waren Sicherheitskräfte, die zur Stelle wären, wenn sich in ihrer Nähe ein Überfall ereignen würde. Verkehrsschilder warnten im Umkreis des Bahnhofs nicht in erster Linie vor Verkehrsübertretungen, sondern vor der Mitnahme von Speeren, Äxten und Handfeuerwaffen in den öffentlichen Transportmitteln. Und dass ein Parkplatz ein freier Platz ist, an dem man sein Auto abstellen kann, mochte für andere Städte gelten. In Kapstadt waren Parkplätze Pfründen, um die die jugendliche Banden kämpften. Als ich meinen Wagen am Nachmittag in einem Vorort von Kapstadt abstellte, traten zwei Jugendliche an mich heran und stellten sich als Mitglieder einer Parkwächter-Kooperative vor, deren Angehörige für eine kleine Gebühr die geparkten Fahrzeuge bewachten. Ganz gleich, ob die Jugendlichen selbst das Problem waren, vor dem sie mein Fahrzeug schützen wollten, oder ob sie tatsächlich sinnvolle Wachdienste leisteten – ich zögerte keine Sekunde, für diese „Service“ einige Rand herauszurücken.
Schon am späten Nachmittag, wenn sich andere Orte langsam auf ihre vitalste Tageszeit vorbereiteten, rasselten die ersten Ladengitter herab, wurden die Flohmarktstände abgebaut und die Kaufhäuser geschlossen. Kurz nach Einbruch der Dunkelheit wirkte die Innenstadt wie leergefegt. Der Abendwind trieb Blätter und Papierfetzen über menschenleere Plätze. Zwei einsame Passanten an der Heerengracht beschleunigten ihre Schritte und verschwanden in einem bewachten Hoteleingang. Kapstadts Schönheit war nicht nur doppelbödig, sie war auch eine Qualität, die bei Einbruch der Dunkelheit verschwand.