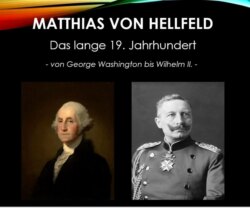Читать книгу Das lange 19. Jahrhundert - Matthias von Hellfeld - Страница 4
2 Die Französische Revolution
Оглавление„Der König befiehlt? Der König hat hier nichts zu befehlen! Wir sind das Volk. Wir werden erst unsere Plätze verlassen, wenn man uns mit Bajonetten dazu zwingt.“ Mit diesen wütend herausgebrüllten Sätzen des eigentlich nicht zum Jähzorn neigenden Grafen Mirabeau begann eine Revolution, die das Gesicht des europäischen Kontinents veränderte wie kein Ereignis vorher.
Was war passiert? Am Ende des 18. Jahrhunderts hatte sich der europäische Kontinent als instabil erwiesen. Als Folge des preußisch-österreichischen Konfliktes um den Einfluss im Deutschen Reich, hatte sich Frankreich auf Seiten Österreichs und England auf Seiten Preußens in den „Siebenjährigen Krieg“ zwischen 1756 und 1763 eingeschaltet. In diesem „Weltkrieg“ wurde sowohl in Europa, als auch in Nordamerika, in Indien und in der Karibik gekämpft. Die Vielzahl der Orte, an denen sich Truppen gegenüberstanden, und die Gleichzeitigkeit der Kämpfe legen die Globalisierung des Konflikts offen. Dieser an verschiedenen Orten ausgetragene Krieg machte deutlich, dass die Kontinente näher zusammengerückt waren. Jene europäischen Großmächte, die auch Kolonialmächte waren, mussten nun ihre Interessen an verschiedenen Stellen der Erde gleichzeitig vertreten können. Für das Deutsche Reich, Preußen und Österreich galten diese Konsequenzen der ersten Globalisierung nicht, denn sie hatten in der Mitte des 18. Jahrhunderts keine Kolonien um deren Erhaltung oder Erweiterung sie kämpfen mussten. Frankreich und England hingegen hatten diese Entwicklung ins politische Kalkül einzubeziehen und die finanziellen Folgen ihrer Kolonialpolitik zu tragen. Besonders Frankreich war nach seinen Teilnahmen am Siebenjährigen Krieg und am amerikanischen Unabhängigkeitskrieg sowie durch die notorische Verschwendungssucht seines Königs Ludwig XVI. in finanzielle Probleme geraten.
Amerikanische Unabhängigkeit
Ludwigs XVI. Engagement im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg sollte sich als schwere Hypothek erweisen. Zwar verhalf Frankreich den Amerikanern zum Sieg über England und ebnete so den Weg zur amerikanischen Unabhängigkeit und zur Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika, aber der Preis für diesen Einsatz war hoch. Einerseits hatten Frankreich und England eigene koloniale Absichten und wirtschaftliche Interessen, die sie in Nordamerika durchsetzen wollten. Deswegen hatten sie zwischen 1756 und 1763 um die Vorherrschaft auf dem amerikanischen Kontinent Krieg geführt. Aber sie waren andererseits auch in Europa Konkurrenten, weswegen der Ausgang des Krieges in Amerika auch auf dem „alten“ Kontinent Auswirkungen haben würde. Der Krieg um die amerikanische Unabhängigkeit begann im April 1775 mit einigen Scharmützeln mit britischen Kolonialtruppen und fand in der am 4. Juli 1776 verkündeten Unabhängigkeitserklärung von 13 amerikanischen Staaten ihren vorläufigen Höhepunkt. Aber die britische Kolonialmacht nahm diese Erklärung nicht ohne Widerspruch zur Kenntnis. England drängte die Aufständischen in die Defensive und eroberte kurz darauf New York. In dieser Situation wandten sich die Amerikaner an den französischen König und baten um militärische Unterstützung. Unter der Führung des Plantagenbesitzers Georg Washington gelang es den Amerikanern durch die sofort einsetzende massive Militärhilfe Frankreichs die britischen Truppen zurückzudrängen. Der amerikanische Unabhängigkeitskrieg dauerte bis zum Oktober 1781, als die britische Armee nach einer verheerenden Niederlage bei Yorktown zur Kapitulation gezwungen war. Am 3. September 1783 wurde der amerikanische Unabhängigkeitskrieg mit dem Frieden von Paris offiziell beendet und die „Vereinigten Staaten von Amerika“ wurden von der britischen Krone anerkannt.
Ludwig XVI. konnte sich brüsten, dem englischen Konkurrenten um die Macht in Europa und in den Kolonien eine empfindliche Niederlage beigebracht zu haben. Die Friedensverhandlungen fanden zudem in Paris statt, was für die Briten eine zusätzliche Schmach bedeutete. Der britische Verhandlungspartner war so verärgert, dass er sich weigerte, für das offizielle Gemälde Modell zu sitzen, das ihn neben den beiden Gründervätern der USA, John Adams und Benjamin Franklin, gezeigt hätte. Aber der Sieg, den Ludwig XVI. in Amerika erreicht hatte, leitete gleichzeitig seine Niederlage in Frankreich ein, denn in der Unabhängigkeitserklärung waren zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit die universellen Menschenrechte verkündet worden. Die französischen Soldaten, die an der Seite ihrer amerikanischen Waffenbrüder kämpften, wurden von ihnen mit den Ideen und den Zielen der Aufständischen infiziert. Die Erklärung beinhaltete neben den unveräußerlichen Menschenrechten auch das Recht des Volkes, sich einer schlechten Regierung zu entledigen. Alle Menschen seien „gleich erschaffen“, stand in der Erklärung und jeder von ihnen habe das Recht „nach Glückseligkeit“ zu streben. Davon konnte in Frankreich keine Rede sein. Der König besaß alles, das Volk nichts. Die Adligen brauchten keine Steuern zu zahlen und frönten einem prunkvollen Leben am Hofe des Königs, die Bauern und Handwerker mussten dafür Abgaben und Steuern aufbringen. Als die französischen Soldaten in ihre Heimat zurückkehrten, waren sie empfänglich für das, was einige Jahre später als „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ durch ihr Land hallte.
Vier Jahre nach dem Ende des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs begannen im Mai 1787 in Philadelphia die Verhandlungen über eine gemeinsame amerikanische Verfassung. Schließlich verabschiedeten die Delegierten eine Verfassung, die neben dem Recht auf Glaubens-, Meinungs- und Pressefreiheit auch den Schutz vor Willkürmaßnahmen des Staates und der Gerichte garantierte. Die amerikanische Verfassung vom 17. September 1787 ist bis heute gültig und stellt durch die Trennung von Exekutive und Legislative und wegen der Einführung des Zweikammer-Systems einen Meilenstein der Menschheitsgeschichte dar. Rund anderthalb Jahre später stand Ludwig XVI. vor dem Staatsbankrott, weil das Kriegsabenteuer in den USA und die kostspielige Hofhaltung in Versailles ein tiefes Loch in die Staatskasse gerissen hatten. Mitte 1789 fasste er deshalb den Entschluss, die „Generalstände“ nach Paris zu laden. Diese Versammlung war seit 1614 nicht mehr einberufen worden, weil sie der Regierungsauffassung der absolutistischen Herrscher Frankreichs im Wege gestanden hatte. Nun sollten die Vertreter der Städte, des Adels, der Bauern und Bürger dem König durch die Genehmigung von Steuererhöhungen aus der Finanzmisere helfen. Aber die mehr als tausend Delegierten, die sich zur ersten Sitzung am 5. Mai 1789 in Paris einfanden, waren von der Eröffnungsrede des Königs enttäuscht, denn Ludwig wollte Frankreich nicht mit dringend notwendigen Reformen verändern, sondern durch Notmaßnahmen lediglich die Symptome der Krise beheben. Am 17. Juni 1789 sprachen sich Vertreter des 3. Standes, die Bauern und Bürger, dafür aus, aus der Versammlung der „Generalstände“ eine Verfassungsgebende Nationalversammlung zu machen, die das feudalistische System der französischen Sonnenkönige beenden sollte. Jahrzehnte lang hatten sie ansehen müssen, wie die Lage auf dem Land, bei den vielen Millionen Bauern immer dramatischer geworden war. Hungersnöte und Missernten, hohe Abgaben und Steuern, von denen der Adel ausgenommen war, hatten das Leben für die meisten Menschen beschwerlich gemacht. Jetzt wollten sie die Gelegenheit beim Schopfe packen und mit diesem sozialen Elend aufräumen. Schnell stellte sich heraus, dass sich auch einige Geistliche und Adlige von der aufrührerischen Stimmung anstecken ließen und die Forderungen des 3. Standes, die Monarchie zu stürzen, die Adelsprivilegien abzuschaffen, das Kircheneigentum zu konfiszieren und schließlich eine Republik auszurufen, unterstützten.
Der König war empört über diese „Anmaßung“ und erteilte den Befehl, die Ständeversammlung aufzulösen. Die Delegierten sollten sich an verschiedene Orte begeben und keinen Kontakt mehr untereinander haben. Der Sitzungssaal wurde geschlossen und verriegelt, gleichzeitig berief er für den 23. Juni 1789 eine „königliche Sitzung“ ein, von der die aufmüpfigen Delegierten aber ausgeschlossen waren. Als ein Königsbote den Delegierten die Entscheidungen Ludwigs XVI. mitteilte, ließ sich der Graf Mirabeau zu seinem Wutausbruch hinreißen. Kaum hatte er sich beruhigt, zogen die Delegierten ins benachbarte Ballhaus und schworen, bis zur Ausarbeitung einer neuen Verfassung nicht mehr auseinander zu gehen. Dieser „Ballhaus-Schwur“ war die Kampfansage an das „Ancien Regime“ und zugleich der Startschuss zur wichtigsten Revolution der europäischen Geschichte. Als der König begann, Truppen in Paris zusammen zu ziehen, breitete sich revolutionäre Unruhe in der Stadt aus. Am 14. Juli 1789 stürmte eine aufgebrachte Menge die Bastille – das Gefängnis im Osten der Stadt - und öffnete die Tore für die Gefangenen. Die Nachricht vom Sturm auf die Bastille verbreitete sich ebenso schnell wie das Gerücht, es stehe ein Militärputsch bevor.
Die Nationalversammlung ließ sich davon nicht beeindrucken und führte in den kommenden Monaten radikale Änderungen in Frankreich durch, die am 26. August 1789 mit der Verkündung der „allgemeinen Menschen- und Bürgerrechte“ einen ersten Höhepunkt erreichten. Die Adelsprivilegien wurden abgeschafft, die „Bürger und Menschenrechte“ erklärt und der Kirchenbesitz verstaatlicht. Ein Jahr nach Beginn der Revolution feierte die Pariser Bevölkerung mit 60.000 Delegierten aus den neu gegründeten Départments auf dem Marsfeld ein Förderationsfest, bei dem Ludwig XVI. einen Schwur auf das Wohl der Nation leisten musste. Aber die Jubelstimmung konnte kaum verdecken, dass die politische Lage zunehmend instabiler geworden war. Radikale Republikaner, deren wichtigste Sprecher Maximilien Robespierre und Georges Jacques Danton waren, und gemäßigte „Girondisten“ standen sich gegenüber. Zum Ort politischer Debatten stiegen die radikalen Jakobinerclubs auf. Sie sollten bald darauf die Keimzelle der Radikalisierung der Revolution werden.
Europa und die Revolution
In den europäischen Königshäusern herrschte angesichts der Revolution in Frankreich blankes Entsetzen. Während Intellektuelle und Schriftsteller anfangs voller Begeisterung die Revolutionsideale „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ über den Kontinent verbreiteten, machte sich in den Palästen der Fürsten Ratlosigkeit breit. Der deutsche Kaiser Leopold II., eines der vielen Kinder der österreichischen Erzherzogin Maria Theresia, war der einzige Potentat, der die Revolution nicht sofort ablehnte. Aber er hatte die innere Dynamik eines revolutionären Prozesses unterschätzt und schwenkte im August 1791 auf die Seite der Gegner der Revolution. Gemeinsam mit seinem preußischen Amtsbruder Friedrich Wilhelm II. setzte er sich nun für die Restauration der französischen Monarchie ein und schloss am 1. März 1792 ein Defensivbündnis mit Preußen gegen Frankreich. Der preußische König Friedrich Wilhelm II. stand der Revolution ebenso ablehnend und feindlich gegenüber wie der spanische König Karl IV. Auch die russische Zarin Katharina II. fand kein gutes Wort für den Umsturz in Paris. Zwar gehörte sie zu der kleinen Schar von „aufgeklärten“ Regenten, die der Aufklärung nahestand. Dennoch rief sie angesichts des Umsturzes in Paris zum Kreuzzug gegen die „französische Pest“ auf, bei dem es unsterblichen Ruhm zu ernten gebe. Unterstützt wurde sie vom schwedischen König, der vorsorglich Truppen ins belgische Spa schickte. Erbost über den Verlust des Kircheneigentums nannte Papst Pius VI. die Vorgänge in Frankreich gottlos und verdammte die Ziele der Revolution. Die unverhohlenen Drohungen der meisten europäischen Königshäuser, dem Spuk mit militärischer Gewalt ein Ende zu bereiten, ließen die revoltierenden Franzosen noch enger zusammenrücken. Von überall strömten die Menschen nach Paris, um „ihre“ Revolution zu verteidigen und brachten damit ihren Willen zum Ausdruck, die Revolution mit allen Mitteln zu verteidigen. Das löste bei den Gegnern des Umsturzes Angst aus. Denn sollten sich die Revolution und die Ideen der Aufklärung durchsetzen, würde in einem „aufgeklärten“ Europa auch ihre eigene Regentschaft in Gefahr geraten.
Kurz nach den Ereignissen in Frankreich kam es auch in den linksrheinischen Gebieten Deutschlands zu revolutionären Erhebungen. Nahe der französischen Grenze waren die Rufe aus Paris deutlich zu vernehmen. In Mainz, Köln oder Trier erhoben sich ebenfalls Bauern, Handwerker oder innerstädtische Gruppierungen, um lokale Missstände zu beheben. Fast überall wurden diese Unruhen durch Vereinbarungen mit den Regierungen der Fürsten behoben, die unter dem Eindruck der Ereignisse in Paris zu Konzessionen bereit waren. Zu einer regelrechten Revolution kam es trotz der vielerorts festgestellten Diskrepanz zwischen den Erwartungen der Bevölkerung und der politischen Realität nicht. Das lag vor allem an der Zersplitterung des deutschen Reichs. Zudem fehlte eine Zentrale wie Paris, von wo der revolutionäre Funke gelenkt werden und auf das Land überspringen konnte. Die deutschen Intellektuellen waren zwar unter den so genannten „Revolutionspilgern“, dennoch sah keiner von ihnen die Notwendigkeit einer politischen Revolution im eigenen Land. Entscheidend aber dürfte die Auffassung der deutschen Fürsten und Könige gewesen sein, dass sie von einer Schwächung der französischen Monarchie profitieren könnten (Demel, 2005), weswegen sie den Ereignissen in Frankreich keineswegs ablehnend gegenüberstanden.
Am 22. Mai 1790 verzichtete die Nationalversammlung in Paris feierlich auf Eroberungskriege. Angesichts der unverhohlen geäußerten Kriegsdrohungen einiger europäischer Fürsten- und Königshäuser entschloss sich die Nationalversammlung am 20. April 1792 aber trotzdem Österreich den Krieg zu erklären. Als die französische Armee eine schwere Niederlage einstecken musste, entstand im Sommer 1792 eine bedrohliche Lage für Frankreich. In den folgenden Wochen überschlugen sich die Ereignisse in der französischen Hauptstadt. Die Residenz Ludwigs XVI. in den Tuilerien wurde besetzt und der König gezwungen mit einer Revolutionsmütze auf dem Kopf auf das Wohl des Umsturzes zu trinken. Am 11. Juli erklärte die Nationalversammlung, „das Vaterland sei in Gefahr“, weil auch Preußen in einen Krieg gegen Frankreich eingetreten war und wenig später ins Land marschierte. Ende Juli erließ der preußische Oberbefehlshaber, Karl Wilhelm Ferdinand, Herzog von Braunschweig, ein Manifest mit der Aufforderung an die französische Bevölkerung, ihrem König Treue und Gehorsam zu erweisen. Als er drohte, Paris in Schutt und Asche zu legen, stürmten am 10. August 1792 aufgebrachte Pariser Bürger das königliche Tuilerienschloss und nahmen Ludwig XVI. nebst Gattin fest. Gleichzeitig wurde die Monarchie aufgehoben und der Nationalversammlung die Regierungsgewalt übertragen. Zwei Tage nach dem Sieg der Revolutionsarmee über ein preußisch-österreichisches Heer am 20. September 1792 bei Valmy erklärte die Nationalversammlung Frankreich zu einer einigen und unteilbaren Republik – der ersten von bislang fünf französischen Republiken.
Wenig später wurde dem in Haft sitzenden König der Prozess wegen Hochverrat gemacht. Das Urteil war vorher schon klar: Tod durch die Guillotine. Als das Haupt Ludwigs XVI. vor einer großen Menge Schaulustiger durch das Beil vom Hals getrennt war, griff der Henker in den Korb und hielt den blutenden Kopf des Königs in die Höhe. Laute „Vive la République!“ - Rufe erschallten, manch einer drängte sich nach vorne und tauchte sein Taschentuch ins königliche Blut. Den Anwesenden war klar, dass sie mit dieser Tat alle Brücken hinter sich abgebrochen hatten. Jetzt waren sie es selbst, die für Fehlentwicklungen oder soziale Ungerechtigkeiten zur Verantwortung gezogen werden würden. Die Menschen ahnten, einem Mord beigewohnt zu haben, der sie unwiderruflich mit der Revolution verstrickte. Im Moment der Hinrichtung des Königs waren die Zuschauer zu Mittätern geworden. Sie hatten die Revolution zu einer Sache des ganzen Volkes gemacht. Im benachbarten Deutschland löste die Hinrichtung Ludwigs aber einen Stimmungsumschwung aus. Die anfängliche Begeisterung für die Abschaffung der feudalen Strukturen und den Übergang zu einer konstitutionellen Monarchie war im Moment der Hinrichtung bei vielen deutschen Intellektuellen einer entsetzten Ablehnung gewichen. Zwar wollten die meisten, dass sich die Revolutionsideale auch weiterhin über den Kontinent verbreiteten, waren aber gleichzeitig über die „blutigen Entartungen“ der Jakobiner erschrocken. Johann Wolfgang von Goethe, der Carl August, den Herzog von Sachsen-Weimar bei der Belagerung von Mainz durch die französische Revolutionsarmee begleitet hatte, hoffte sogar, dass Revolutionen in Deutschland nicht stattfinden würden, wenn „die Regierung ihnen durch zeitgemäße Verbesserungen entgegenkommen und sich nicht so lange sträuben, bis das Notwendige von unten her erzwungen wird.“ Tatsächlich setzte sich bei den Regierungen der deutschen Fürsten die Erkenntnis durch, dass Reformen vielleicht doch besser waren als Revolutionen mit unvorhersehbarem Ausgang.
Die Revolution frisst ihre Kinder
Die Revolution stellte das öffentliche Leben in Frankreich auf den Kopf, nichts war mehr so wie vorher. Anfang 1793 wurde klar, dass die schwerste Bewährungsprobe für das Land noch bevorstand. Neben den immer zahlreicher werdenden Radikalisierern der Revolution, war Frankreich umzingelt von äußeren Gegnern. Unter diesem Druck spitzte sich die Revolution soweit zu, dass sie zeitweise das Gegenteil von dem darstellte, was sie ursprünglich erreichen wollte. Im Nationalkonvent, wo eine neue revolutionäre Verfassung ausgearbeitet werden sollte, prallten Gegner und Befürworter einer verschärften Revolution aufeinander. Es ging um die „Diktatur der Freiheit“, also um die Frage, ob und inwieweit die eigentlich angestrebten Revolutionsideale geopfert werden müssten, um die Revolution insgesamt zu retten. Der Abgeordnete Jean Paul Marat brachte es im April 1793 auf die Formel, dass man einen „vorübergehenden Despotismus der Freiheit errichten muss, um den Despotismus der Könige zu vernichten.“ Als sich eine Mehrheit unter den Delegierten fand, eine zeitlich begrenzte Diktatur zur Durchsetzung der revolutionären Ziele einzurichten, begann in Frankreich eine „Herrschaft des Terrors“, die alle Befürchtungen überstieg.
Kopf und Lenker des Terrors war Maximilien Robespierre, der zunächst die gemäßigten Girondisten aus den Reihen der Revolution ausschloss und ihnen Prozesse machen ließ, die diesen Namen nicht verdienten. Die Gerichte waren von „überflüssigen Formalitäten“ befreit worden, so dass zur Urteilsfindung schon die Aussage der Geschworenen genügte, sie seien ausreichend informiert, um ein Urteil zu sprechen. Die erste Französische Republik war vollständig in Händen der radikalen Jakobiner, die die gerade erst verkündeten Menschenrechte wieder außer Kraft setzten, um sie angeblich zu verteidigen. Die Revolution fraß aber nicht nur ihre Kinder, sondern auch ihre Väter. Als am 5. April 1794 Georges Jacques Danton die letzten Stufen zum Schafott hinauf gehen musste, erreichte die Henkershand einen der klügsten Köpfe der Revolution. Erschrocken über die Ausschreitungen hatte er zur Mäßigung aufgerufen, was ihm vor dem Revolutionstribunal als „zu große Milde“ gegen die Feinde der Revolution ausgelegt worden war. Spätestens mit Dantons Tod, dem der Dramatiker Georg Büchner mit seinem gleichnamigen Werk ein Denkmal gesetzt hat, war es den Zeitgenossen klar, dass sie Zeuge einer blutrünstigen Diktatur geworden waren. Mitte 1794 begann die schlimmste Phase der Schreckensherrschaft. Anstelle von Pfingsten wurde das „Fest des höchsten Wesens“ gefeiert, die Kirche Notre Dame hieß nun „Tempel der Vernunft“ und am 10. Juni 1794 wurde das „Schreckensgesetz“ verkündet, das Hinrichtungen auf dem Verwaltungswege erlaubte. Zwischen 50 und 100 Menschen wurden nun täglich im Namen der Revolution ins Jenseits befördert. Aber gleichzeitig wuchs auch der Unmut gegen den jakobinischen Terror, für den Maximilian Robespierre verantwortlich war. Als Ende Juli 1794 Robespierre und einige seiner Gefolgsleute verhaftet und tags darauf unter großer öffentlicher Anteilnahme guillotiniert wurden, signalisierte das anschließende Volksfest das Ende der Terrorherrschaft.
In Deutschland lösten die Nachrichten von der Terrorherrschaft der Jakobiner blankes Entsetzen aus. Die ursprüngliche Begeisterung für die Revolution, die manchen Intellektuellen nach Paris hatte pilgern lassen, um eine Sitzung des Nationalkonvents zu verfolgen, schlug ins genaue Gegenteil um. Was sollte das für eine Revolution sein, die im Namen der Freiheit die Guillotine auspackte und tausendfach benutzte? Waren nicht alle Tugenden der Aufklärung im Blut der Ermordeten versunken? War nicht das Ideal vom brüderlichen Zusammenleben gleicher und freier Bürger in einer von der Vernunft bestimmten Gesellschaft grundsätzlich verraten worden? Und schließlich: Welche Philosophie sollte sich hinter einer Revolution verbergen, die ganz offensichtlich und ohne den Versuch zu unternehmen, es zu vertuschen, die Menschenrechte mit Füßen trat?
Dennoch besetzt die Revolution von 1789 im französischen Selbstverständnis bis heute einen überragenden Platz. Als zum Schutz der ins Wanken geratenen Revolution Soldaten aus Marseille Ende Juli 1792 in die Hauptstadt einmarschierten, hatten sie ein Lied auf den Lippen. Die Pariser Bürger nannten den Song „Marseillaise“ und erhoben ihn zum Revolutionslied, weil sie damit den Einsatz der Marseiller Soldaten würdigen wollten. Der Sturm auf die Bastille und das Lied der Soldaten aus Marseille sind Kernstücke des französischen Nationalstolzes. Die Erstürmung der Bastille und der Marsch der Soldaten verkörpern den Mut und die Entschlossenheit, die die Zeitgenossen an den Tag gelegt haben, als sie für „ihre“ Sache zu kämpfen begannen. Ohne diese Tugenden, auf die sich die moderne französische Nation heute mit so großem Stolz bezieht, wäre die Revolution des Jahres 1789 vermutlich gescheitert. Denn sie war nicht nur von den Anhängern der absolutistischen Monarchie bedroht, sondern auch von den Auswüchsen der eigenen Scharfrichter, die im Namen von Freiheit und Vernunft die Guillotinen aufstellten, um vermeintliche oder tatsächliche Konterrevolutionäre zu Tausenden umzubringen. Schließlich haben sich die Bürger von Paris auch dagegen gewehrt und dafür gesorgt, dass die Französische Revolution weder am Widerstand der europäischen Mächte noch an den Unzulänglichkeiten der Revolutionäre gescheitert ist. Damit hat Frankreich dem europäischen Kontinent einen für immer prägenden Stempel aufgedrückt.
Eine Revolution mit Folgen
Die revolutionären Ideen aus Frankreich veränderten Europa, selbst wenn sie nicht sofort in politischen Programmen oder Forderungen von Aufständischen Eingang fanden. Die Revolution hat Europa reformiert. Es begann die Zeit der Verfassungen und der an diese Verfassungen gebundenen Monarchien. Die von den Revolutionären in Paris ausgerufenen „Menschen- und Bürgerrechte“ waren nicht mehr revidierbar. Die Menschen Europas hatten die Fanfaren der Freiheit gehört und forderten diese Freiheiten nun für sich ein. Bürgerrechte und vermehrte politische Partizipation läuteten das Ende des Ancien Régime ein. In Preußen, später in den Niederlanden, in Italien, in Griechenland oder in Belgien wird es Verfassungen geben, die durch die Revolution in Frankreich beeinflusst waren. Mit diesem Prozess ging die Säkularisierung Europas einher, die durch den schlechten Ruf des Vatikans als Hort der Reaktion und Unterdrückung noch unterstützt wurde. Die „Entgottung“ der Welt, die von der Revolution in Frankeich propagiert worden war, fand in den kommenden Jahrzehnten überall in Europa ihren Niederschlag. Der direkte Einfluss der Kirche auf die Politik ist seither in Europa immer weiter zurückgegangen.
Die Französische Revolution war der Frontalangriff auf die alte Ordnung. Sie wirkte wie ein Durchbruch in die Moderne – versinnbildlicht durch den wenig spektakulären Untergang des „Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation“, der für Zeitgenossen wie Johann Wolfgang von Goethe bereits weniger interessant war „als der Streit mit dem Postboten“. Immerhin hatte diese Konstruktion ziemlich genau ein Jahrtausend Bestand gehabt und - jedenfalls zeitweise – als Ordnungsfaktor in Europa durchaus funktioniert. Die Territorialfürsten hatten sich darin ebenso eingerichtet wie die jeweiligen Kaiser, die sich als Bewahrer dieser seit Karl dem Großen überkommenen Ordnung einen Namen gemacht haben. Die Französische Revolution propagierte dagegen den Leitspruch „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ und goss diese Ideale in Verfassungen mit Bürger- und Menschenrechten. Dahinter steckte der zuerst in der griechischen Antike formulierte Anspruch, dass der Mensch das Maß aller Dinge sei. Abgesehen von der Zeit der Terrorherrschaft rückten die Revolutionäre das Individuum in den Mittelpunkt des Interesses und der daraus abzuleitenden politischen Handlungen. Der Mensch sollte aus der Umklammerung einer unmenschlichen Politik befreit werden. Arroganz und Menschenfeindlichkeit der französischen Sonnenkönige, das hohe Maß an Ungerechtigkeit, mit der Bauern und Handwerker gezwungen worden waren, den ausufernden Lebensstil einer nutzlosen Adelsclique am Hofe des Königs zu finanzieren – all das waren Auswüchse eines gegen die Menschen gerichteten politischen Systems, das es endgültig zu überwinden galt.
Wie erfolgreich dieser Angriff auf das alte System war, konnte man im Verlauf des 19. Jahrhunderts sehen. Die Revolutionen in Griechenland und Italien, zahlreiche Aufstände und Revolutionen in Frankreich und Umwälzungen in Belgien oder den Niederlanden und nicht zuletzt die deutsche Revolution 1848/49 legten davon Zeugnis ab. Die europäischen Regenten haben sich mehrheitlich gegen die Revolution von 1789 ausgesprochen, nachdem sie die Sprengkraft der Vorgänge in Paris begriffen haben. Als der „Spuk“, wie sie hofften, vorbei war, machten sie sich daran, das alte Europa beim Wiener Kongress wieder zu restaurieren. Aber das alte, korrupte und auf die Herrschaft einiger Potentaten ausgerichtete Europa war nach der Französischen Revolution zerstört. Der Kontinent war mit den restaurativen Mitteln des Wiener Kongresses nur noch mit großem polizeilichem und militärischem Aufwand für einen begrenzten Zeitraum in seinem alten Status Quo zu erhalten.
Napoleon
Für die europäischen Königs- und Fürstenhäuser war ein Erfolg der „gottlosen Revolution“ in Frankreich ein Horrorszenario. Knapp drei Jahre nach Beginn der Revolution hatte der erste Koalitionskrieg begonnen, der nach der Pariser Kriegserklärung an Österreich von 1792 bis 1797 dauerte. Preußen schied nach einem Sonderfrieden 1795 aus den Reihen der Alliierten aus, um den Rücken frei zu haben für die dritte polnische Teilung, mit der dieser Staat für lange Zeit von der europäischen Landkarte verschwand: Zwar gab es Millionen von Polen, ein polnischer Staat aber existierte nicht mehr. Zu dieser Zeit, hielt Johann Wolfgang von Goethe fest, genoss das mittlere und das nördliche Deutschland einen „fieberhaften Frieden“, der aber für zeitgemäße Reformen nicht genutzt wurde.
Umfassende Reformen gab es hingegen in Frankreich. Am 22. August 1795 wurde eine neue Direktoriums-Verfassung in Kraft gesetzt, die eine Trennung der Exekutive, der Legislative und Judikative vorsah. Nachdem eine radikal-
demokratische Verschwörung in Paris ebenso wie eine royale Gegenrevolution niedergeschlagen waren, hatten sich die innenpolitischen Verhältnisse in Frankreich einigermaßen stabilisiert. Außenpolitisch musste sich Frankreich in den folgenden Jahren allerdings gegen viele Gegner zur Wehr setzen. Dabei kam einem jungen Artillerieleutnant aus der korsischen Hafenstadt Ajaccio die bedeutendste Rolle zu. Napoleon Bonaparte hatte sich erste militärische Sporen bei der Niederschlagung eines Aufstandes königstreuer Bürger im Oktober 1795 verdient. Der Nationalkonvent hatte den 26jährigen Korsen fortan für größere militärische Aufgaben im Auge. Dabei profitierte Napoleon davon, dass die französische Armee keiner Söldnerarmee mehr war, sondern junge Franzosen zur Verteidigung der Revolution rekrutiert wurden. Diese Bürgersoldaten kämpften für ihre eigene Sache und verteidigten verbissen ihr Vaterland. Angeführt von waghalsigen, meist jungen Generälen fielen französische Truppen im Westen Deutschlands ein, besetzten und annektieren das Rheinland, die Niederlande, Savoyen und Belgien. Die alte Idee von der durch den Lauf des Rheins „natürlich“ vorgegebenen Ostgrenze Frankreichs lebte wieder auf. Der preußische König Friedrich Wilhelm II. führte zwar das große Wort von der „gottlosen“ Revolution in Frankreich im Mund, trat aber den französischen Soldaten in den preußischen Gebieten an den Ufern des Rheins nicht entgegen.
Von den lautstarken Äußerungen des preußischen Königs ließ sich der inzwischen zum General aufgestiegene Napoleon nicht beeindrucken. Seine nächste Aufgabe war die Beendigung des Krieges gegen Österreich, wobei er eine Kostprobe nicht nur seines militärischen, sondern auch seines diplomatischen Geschicks ablieferte. Denn am 17. Oktober 1797 schloss er den Frieden von Campo Formio, ohne das in Paris wartende Direktorium zu unterrichten. Österreich musste neben der Lombardei auch die Niederlande abtreten und auf seine linksrheinischen Besitzungen verzichten. Damit war der Rhein von den Niederlanden bis zur Schweiz zur französischen Ostgrenze geworden. Alsdann gründete Napoleon mit der Ligurischen Republik um Genua und der Cisalpinischen Republik um Mailand die ersten beiden französischen Satellitenstaaten und unterwarf den Kirchenstaat. Papst Pius VI. leistete noch eine Zeit lang Widerstand, musste nach einer militärischen Besetzung des Kirchenstaats aber schließlich doch aufgeben. Der bereits schwer kranke Papst wurde über Siena und Florenz nach Frankreich verschleppt, wo er starb.
Napoleon war nach diesem Coup in aller Munde. Er war der jugendliche Draufgänger, den Frankreich brauchte, um gegen die Übermacht der Feinde zu bestehen. Aber der junge Korse war auch innenpolitisch zur wichtigsten Figur der französischen Politik aufgestiegen. Nach seiner Rückkehr aus Italien sollte es gegen den letzten ernstzunehmenden Gegner in Europa, gegen England, gehen. Im Oktober 1797 stellt er eine Armee zur Überquerung des Ärmelkanals zusammen, das Unternehmen musste aber wegen der Übermacht der britischen Flotte wieder eingestellt werden. Am 19. Mai 1798 startete Napoleon eine Expedition nach Ägypten mit dem Ziel, den britischen Zugang nach Indien zu blockieren. Eine Niederlage gegen die britische Flotte unter Admiral Nelson machte die Aussichtslosigkeit des Unterfangens schnell klar, dennoch zog der Korse weiter und eroberte Gaza und Jaffa. Aber anders als in Italien wurde er im Nahen Osten nicht als Befreier, sondern als Ungläubiger und Eindringling gesehen. Das Ziel der Expedition – die Unterwerfung von Teilen Ägyptens, um England den Weg nach Indien zu versperren – erreichte er nicht. Während Napoleon im Nahen Osten kämpfte, eroberten die alliierten Gegner im Zweiten Koalitionskrieg die beiden französischen Satellitenstaaten in Oberitalien zurück und stellten dort die alte Ordnung wieder her. Allein die Tatsache, dass die Koalitionäre untereinander zerstritten waren und die Koalition sich 1799 wieder auflöste, verhinderte weitere militärische Attacken gegen Frankreich.
Putsch in Frankreich
Nachdem Napoleon die Aussichtslosigkeit seiner ägyptischen Mission erkannt hatte, verließ er seine Truppen und segelte unter dramatischen Umständen nach Frankreich zurück. Dort war die innenpolitische Situation nach wirtschaftlichen Schwierigkeiten und einer bei den Wahlen im Frühjahr 1799 gestärkten radikal-demokratischen Opposition aus den Fugen geraten. Es schien für einige Wochen, als könnte es zu einer erneuten jakobinischen Herrschaft kommen. In der Nacht des 9. November 1799 schlug Napoleon sich auf die Seite jener, die diesen Umschwung verhindern wollten. In einem Handstreich besetzte er die französische Hauptstadt und zwang die Angehörigen der gesetzgebenden Organe, die geltende Verfassung abzuschaffen und ihn als „Ersten Konsul“ eines Dreierkollegiums einzusetzen. Einen Monat später veröffentlichte er eine republikanische Verfassung, die ihm zunächst für zehn Jahre, später auf Lebenszeit diktatorische Vollmachten übertrug. Am 15. Dezember 1799 proklamierte Napoleon das Ende der Revolution:
„Die Verfassung ist auf den wahren Grundsätzen der repräsentativen Regierung, auf den heiligen Rechten des Eigentums, der Gleichheit und der Freiheit gegründet. Die Gewalten, die sie errichtet, werden stark und fest sein, so wie sie es sein müssen, um die Rechte der Bürger und die Interessen des Staates zu garantieren. Bürger, die Revolution hält an den Grundsätzen fest, die an ihrem Anfang standen. Sie ist beendet.“
Napoleon Bonaparte war auf dem vorläufigen Höhepunkt seiner Macht. Zwar war er einerseits der Totengräber der Revolution, solange er aber andererseits ihre Ziele und Errungenschaften nicht antastete, konnte er sich der Unterstützung der Franzosen sicher sein. Zu seinen ersten Amtshandlungen gehörten Steuersenkungen und die Modernisierung der Verwaltung. Mit dem „Code Napoleon“ - oder auch Code Civil - hatte er das erste Bürgerliche Gesetzbuch verfassen lassen, das bald darauf zum Vorbild für andere europäische Rechtssyste-me wurde. Zudem gelang es dem gerade mal 30Jährigen in den kommenden Monaten sowohl Frieden mit der katholischen Kirche zu schließen, als auch die Streitigkeiten mit Österreich beizulegen. Anarchie und Chaos verschwanden aus dem öffentlichen Leben ebenso wie Guillotine, Willkürherrschaft und Rechtsunsicherheit. Noch nie in seiner Geschichte war Frankreich so mächtig wie zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Napoleon herrschte über das größte Reich, das seit Karl dem Großen zwischen Rhein und Atlantik, zwischen der Nordsee und Italien existiert hat. Ruhm und Wohlstand, den er den Franzosen bescherte, sein offensichtlich unbezwingbares militärisches Genie und sein politisches Geschick im Umgang mit den europäischen Gegnern ließen Vergleiche aufkommen. War nicht Napoleon der wahre Nachfolger Karls des Großen, der vor tausend Jahren das römisch-deutsche Kaiserreich als europäische Supermacht etabliert hatte? Folgte Napoleon nicht in direkter Linie den großen Cäsaren des Imperium Romanum? Nicht die deutschen Kaiser, die sich seit Jahrhunderten bemüht hatten in die Fußstapfen des großen Franken zu treten, waren die legitimen Erben, sondern er - der „Erste Konsul“ des revolutionären Frankreichs. Napoleon umgab sich als Imperator und „Erster Konsul“ mit Senatoren und Präfekten und erweckte tatsächlich so den Eindruck, Frankreich sei das dritte römische Reich. Vom Beginn seiner Regentschaft war der Hang zu Selbstherrlichkeit und Arroganz zu sehen. Beides sollte Napoleon erst in ungeahnte Höhen des Ruhms und der Anerkennung führen, um ihn dann in ebensolche Tiefen stürzen zu lassen.
Kaiserreich
Der nächste Akt fand am 2. Dezember 1804 statt. Mit einer pompösen Feier in der Kathedrale von Notre Dame krönte er sich selbst zum französischen Kaiser und begründete das erbliche Kaisertum der Familie Bonaparte. Papst Pius VII. durfte bei der Inszenierung der kaiserlichen Macht Napoleons nur zuschauen. Waren es früher die Päpste gewesen, die die weltlichen Herrscher gekrönt und damit der gottgewollten Ordnung den geistlichen Segen gegeben hatten, waren sie nun allenfalls noch Zaungäste. Napoleon signalisierte damit die neuen Vorzeichen: Das Sagen in einem säkularisierten Europa hat fortan der französische Kaiser, der Rest musste sich unterordnen. Der Pomp der Selbstinszenierung verfehlte die beabsichtigte Wirkung nicht, denn sie vermittelte den Anschein, als folge den absolutistischen Monarchen des Ancien Régime ein republikanischer Führer, der Frankreich in eine glorreiche Zukunft führen könne. Mit der Kaiserkrone auf dem Kopf und dem Elan einer erfolgreichen Revolution im Rücken machte sich Napoleon nun daran, die bestehende Ordnung zwischen den europäischen Völkern aufzubrechen. Viele Bürger in Europa unterstützten die Ideale der Französischen Revolution. Viele Untertanen der „alten“ Völker Europas erlagen der Magie des Rufes nach „Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“, den sich die Französische Revolution auf die Fahnen geschrieben und auch tatsächlich durchgesetzt hatte. Der französische Kaiser nutzte das aus und ließ sich überall dort als Überbringer der neuen Ordnung huldigen, wo die absolutistischen Monarchien Reformen verschlafen hatten. Das Ziel seiner Politik, die zwischen 1804 und 1814 Europa in Atem halten sollte, war eine europäische Einheit unter französischem Protektorat. Kurz vor seinem Tod, verbannt auf der Insel St. Helena im Südatlantik, offenbarte er die europäischen Ambitionen seiner Politik. Er habe, diktierte er, „alle Völker, die geographisch zu einer Nation gehörten“, wieder zusammenführen wollen. Auch wenn dieser Aspekt nicht die wichtigste Erklärung seiner Politik war, dürfte die europäische Idee vermutlich ein Teil seiner politischen Überzeugungen gewesen sein.
Das Ende des „Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation“
Der Weg zum europäischen Superstaat unter französischer Flagge wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts durch eine Entscheidung erleichtert, die die deutschen Fürsten Ende Februar 1803 in Regensburg bei der letzten Sitzung des „immerwährenden Reichstags“ des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation fällten. Ausgangspunkt des „Reichsdeputationshauptschlusses“ war der Frieden von Lunéville, den am 9. Februar 1801 Frankreich und der römisch-deutsche Kaiser Franz II. unterzeichnet hatten. Darin wurden Frankreich umfangreiche Gebiete am linken Rheinufer zugesprochen. Deutsche Fürsten wurden enteignet und sollten bei späterer Gelegenheit im Rechtsrheinischen entschädigt werden. Beim Reichstag in Regensburg wurden die Bestimmungen des Friedens von Lunéville umgesetzt. Leidtragende war - ähnlich wie in Frankreich - die Kirche. Sie verlor, abgesehen von Mainz sämtliche geistlichen Fürstentümer. Die ehemaligen Reichsstände wurden – mit wenigen Ausnahmen wie etwa Frankfurt, Bremen, Hamburg oder Augsburg – den benachbarten Fürstentümern zugeschlagen. Die erloschenen Kurwürden der Erzbischöfe von Köln, Mainz und Trier gingen auf Württemberg, Baden und Hessen-Kassel über. Von diesem politischen Geschacher, profitierten vor allem Preußen, Bayern, Baden und Württemberg. Sie waren zwar am linksrheinischen Ufer enteignet worden, konnten aber nun sowohl ihre Staatsgebiete erweitern und ihre Einwohnerzahlen steigern.
Wichtiger aber waren die Auswirkungen auf das Zusammenspiel der Mächte innerhalb des Deutschen Reichs. Denn nach der Entscheidung der deutschen Fürsten auf dem Regensburger Reichstag im Februar 1803 war die machtpolitische Konstruktion des „Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation“ auf den Kopf gestellt. Der Zusammenhalt der geistlichen Fürsten und der in aller Regel loyalen Reichsstände ging ebenso verloren wie die das politische System stützende Reichskirche. Der antiklerikale Kurs, den Napoleon auch in Frankreich eingeschlagen hatte, beschleunigte den Untergang der Reichskirche in Deutschland, wodurch obendrein dem Kaiser eine wichtige innenpolitische Stütze genommen war. Im Laufe der kommenden Jahre verloren weitere kleinere Fürstentümer ihre Eigenständigkeit, so dass innerhalb kurzer Zeit aus einigen Hundert kleiner und kleinster Territorien eine überschaubare Zahl von mittelgroßen Staaten wurde. Mit dem „Reichsdeputationshauptschluss“ war eine Entwicklung angestoßen, die drei Jahre später zum Ende des „Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation“ führte. Am 12. Juli 1806 gründeten nämlich Bayern, Württemberg, Baden, Hessen-Darmstadt, Nassau, Kleve-Berg und einige weitere Fürstentümer mit dem Erzkanzler Reichsfreiherr Karl Theodor von Dalberg den Rheinbund, der unter französischem Protektorat stand. Die Bundesmitglieder erklärten konsequenterweise am 1. August ihren Austritt aus dem Deutschen Reich und fungierten bei einem Friedensschluss am Ende des dritten Koalitionskrieges als eigenständige Völkerrechtssubjekte. Beim endgültigen Todesstoß für das „Heilige Römische Reich deutscher Nation“ musste Napoleon ein wenig nachhelfen, denn Kaiser Franz II., der bereits seit zwei Jahren als Franz I. Österreich regierte, legte erst nach der ultimativen Drohung eines französischen Einmarsches in Österreich am 6. August 1806 die römisch-deutsche Kaiserkrone nieder und erklärte das Reich für aufgelöst.
Fast tausend Jahre hat das „Heilige Römische Reich“ die Geschichte Europas geprägt. Anfangs war es getragen von der Idee, eine Fortsetzung des untergegangenen Imperium Romanum könne den in der Bibel prognostizierten Untergang der Welt verhindern. Aber im Verlauf der Jahrhunderte erwies sich dieser „Dachverband“ als ungeeignet, das machtpolitische Gegeneinander von Territorialfürsten und kaiserlicher Zentralgewalt aufzulösen. Das „Heilige Römische Reich“ wirkte altmodisch und schwerfällig, hatte keine eigene Macht, war auf die Zusammenarbeit mit den Landesfürsten angewiesen und war schließlich als Klammer über den inneren Gegensätzen eines bunten, europäischen Vielvölkergemisches gescheitert. Dem offenen Machtkampf zwischen Preußen und Österreich um die Vorherrschaft in Deutschland war das „Heilige Römische Reich deutscher Nation“ ohnehin wehrlos ausgeliefert. Aber das Ende des Reichs bedeutete den von Napoleon initiierten Anfang der neuzeitlichen deutschen Geschichte (Nipperdey, 1984).
Mit dem Eintritt in das französische Protektorat „Rheinbund“ wählten die deutschen Fürsten das kleinere Übel, denn der Verlust ihrer Unabhängigkeit wurde durch die Modernisierung ihrer Länder mehr als ausgeglichen. Viele Einwohner der Fürstentümer waren von den Ideen der Revolution begeistert oder standen ihnen zumindest wohlwollend gegenüber. Als nun in den Rheinbundstaaten Verfassungen nach französischem Vorbild erlassen, die Staatsverwaltungen neu organisiert und der Code Napoleon als bürgerliches Gesetzbuch eingeführt wurden, kam das den meisten Menschen entgegen. Fortan war das Zivilrecht zum ersten Mal einheitlich und vollständig geregelt. Das Gewohnheitsrecht, das mitunter von Ort zu Ort variieren konnte, wurde durch dauerhafte, eindeutige, für jeden geltende und für jeden verständliche Regeln abgelöst. Die Errungenschaften der Französischen Revolution galten jetzt auch in Deutschland: Die Freiheit der Person, die Gleichheit vor dem Recht, die Trennung von Kirche und Staat und die Garantie des Eigentums. Zudem wurden das Agrar-, Bildungs-, Wirtschafts-, Steuer- und Finanzwesen grundlegend reformiert. Die Okkupation deutscher Gebiete auf der linken Rheinseite hat vielen Menschen geschmerzt. Aber der Schmerz wurde durch den Import der Ideale der Französischen Revolution gelindert, was einen enormen Modernisierungsschub für die Länder des Rheinbundes, dem bis 1808 beinahe alle deutschen Staaten außer Österreich und Preußen angehörten, mit sich brachte. Dennoch wich die anfängliche Begeisterung für die neue Ordnung im Verlauf des 10jährigen französischen Protektorats dem Gefühl einer zunehmend als Bedrohung empfundenen Besatzung.
Denn für Napoleon stand der Export der Revolutionsideale erst an zweiter Stelle. Das war der Köder, mit dem er die Nachbarn darüber hinwegtäuschen konnte, dass er ihr Land als Auf- und Durchmarschgebiet für seine Großmachtspläne benötigte. Der „Rheinbund“ war eine lose Föderation. Alle Versuche, die Mitglieder straffer zu organisieren, scheiterten am Widerstand der größeren Südstaaten. So blieb der „Rheinbund“ ein französisches Protektoratsgebiet, das enorme Rekrutierungen zu leisten hatte: 1808 wurden bei einer Bevölkerung von 14,6 Millionen Einwohnern 119.000 Soldaten für die französische Armee ausgehoben. Das musste mit modernen Verfassungen belohnt werden, die eine Rückkehr unter die „preußische Willkürherrschaft“ ausschlossen (Nipperdey, 1984). Deshalb waren die Rheinbundstaaten fortschrittlicher als die beiden anderen „Deutschländer“ Österreich und Preußen. Trotzdem war die deutsche Mitte des Kontinents mit dem Ende des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation zur Verfügungsmasse der sie umgebenden Großmächte geworden. Die politische Strategie des französischen Kaisers war dabei ebenso klug wie einfach: das unter seinem Protektorat stehende dritte Deutschland sollte Bollwerk und Gegengewicht zu den anderen Deutschen in Preußen und Österreich sein, mit denen Frankreich nach der Neuordnung der Verhältnisse in der Mitte des Kontinents um die Vorherrschaft im restlichen Europa streiten wollte.
Französische Hegemonie in Europa
Der erste Stolperstein auf dem Weg zu einem franko-europäischen Superstaat war Österreich. Napoleon beschäftigte sich mit der Planung einer Invasion Großbritanniens, als es dem englischen Außenminister William Pitt „dem Jüngeren“ gelang, ein europäisches Bündnis gegen den Franzosen zusammen zu bringen. Hastig brachte Napoleon seine Truppen nach Süddeutschland, wo er das überraschte österreichische Heer am 20. Oktober 1805 nach einigen kleineren Schlachten zur Kapitulation zwingen konnte. Dem Sieg zu Lande folgte am 21. Oktober 1805 aber in der Schlacht von Trafalgar eine vernichtende Niederlage zur See gegen die britische Flotte unter Admiral Horatio Nelson. Damit war zwar die englische Vorherrschaft über die Weltmeere gesichert, aber Napoleons Elan blieb ungebrochen. Keine drei Wochen später marschierte er kampflos in Wien ein. Von dort organisierte er die Auseinandersetzung mit Russland und Österreich. Die Schlacht gegen eine russisch-österreichische Koalitionsarmee fand am 2. Dezember 1805 im südmährischen Austerlitz statt. Der Sieg, den Napoleon in dieser so genannten „Dreikaiserschlacht“ davontrug, ließ seinen Ruhm ins Unermessliche steigen.
Im Frieden von Preßburg, den Österreich am 26. Dezember 1805 unterzeichnen musste, ging die Neuordnung Europas im Sinne einer französischen Hegemonie weiter. Tirol und Vorarlberg, Augsburg und Passau gehörten fortan zu Bayern, Vorderösterreich wurde zu Gunsten Badens und Württembergs aufgeteilt, Venetien, Istrien, Cattaro und Dalmatien gehörte zum neu geschaffenen Königreich Italien, dessen König Napoleon seit dem 26. Mai 1805 selbst war. Als „Entschädigung“ bekam Österreich Salzburg und Berchtesgaden. Franz I. musste nicht nur das neue französische Kaisertum, sondern auch die Gründung der Königreiche Bayern und Württemberg anerkennen. Sein politischer Handlungsspielraum war ohnehin eingeschränkt, denn Napoleon herrschte als französischer Kaiser und italienischer König in unmittelbarer Nähe des österreichischen Kaisers. Nach der Flurbereinigung bei den Nachbarn westlich des Rheins und der Machtdemonstration gegenüber Österreich ging die Neuordnung Europas in Preußen, das seit 1797 von dem als Zauderer bekannten König Friedrich Wilhelm III. regiert wurde, weiter. Der preußische König sah die geostrategischen Veränderungen in Europa mit einem lachenden und einem weinenden Auge, denn Preußen hatte beim „Reichsdeputationshauptschluss“ zwar große Gebiete im Nordwesten des Deutschen Reichs bekommen, gleichzeitig aber sorgte sich Friedrich Wilhelm III. vor einer Abhängigkeit von Frankreich und schmiedete erfolgreich eine Koalition mit Russland und Sachsen. So gestärkt forderte der Preußenkönig ultimativ den Rückzug der Franzosen vom rechten Rheinufer und die Auflösung des soeben beschlossenen Rheinbunds. Aber Friedrich Wilhelm III. hatte sich verkalkuliert, denn Napoleon schlug zusammen mit Louis-Nicolas Davoût ein preußisch-sächsisches Heer in der Doppelschlacht von Jena und Auerstedt am 14. Oktober 1806 so vernichtend, dass der Krieg nach nur einem Tag mit der sofortigen Kapitulation wieder beendet war.
Die königliche Familie floh aus Berlin, Königin Luise versuchte mit großem persönlichem Einsatz den französischen Kaiser zur Milde zu bewegen. Ihr Engagement brachte ihr zwar große Anerkennung bei der preußischen Bevölkerung ein, nützte aber nichts. Napoleon marschierte am 27. Oktober 1806 unter dem Jubel einer großen Menge in Berlin ein, während Friedrich Wilhelm III. das Friedensdiktat des französischen Kaisers erwartete. Im Frieden von Tilsit, den Napoleon in zwei Verträgen mit Russland und Preußen anschließend aushandelte, wurde Osteuropa in eine französische und eine russische Interessenssphäre aufgeteilt, während Preußen auf den Status einer unbedeutenden Mittelmacht reduziert wurde. Ursprünglich wollte Napoleon Preußen gänzlich auslöschen. Aber in den Verhandlungen mit dem russischen Zaren Alexander gab er sich mit einer entscheidenden Schwächung zufrieden. Friedrich Wilhelm III. musste alle Besitzungen westlich der Elbe und jene Gebiete abtreten, die Preußen in den drei polnischen Teilungen zwischen 1772 und 1795 annektiert hatte. Die preußische Armee wurde auf 40.000 Soldaten reduziert. Damit war Preußen de facto aus dem Konzert der europäischen Großmächte ausgeschieden. Napoleon machte fortan gemeinsame Sache mit dem Zaren, was sich in der Kontinentalsperre gegen England ausdrückte, die unmittelbar vor den Friedensverhandlungen von Tilsit schon Ende 1806 verkündet worden war. Seit der verheerenden Niederlage in der Schlacht von Trafalgar ein Jahr zuvor, hatte Napoleon versucht, England durch einen Handelskrieg zu bezwingen. Jetzt sollte es eine Kontinentalsperre richten, die von Norwegen bis Südspanien sämtliche Handelsrouten auf die Insel blockierte. Um Schaden durch den ausfallenden Handel mit England von Frankreich anzuwenden, wurden vor allem die Rheinbundstaaten herangezogen. Je länger dieser Zustand andauerte und je größer die Opfer wurden, die Frankreich verlangte, desto stärker wurde der Widerstand in der Bevölkerung. Eine der Folgen der Kontinentalsperre war das Erstarken der anti-französischen, nationalen Bewegung in Deutschland.
Preußen war zerschlagen, spielte im europäischen Machtpoker keine Rolle mehr. Der deutsche Rheinbund war französisches Protektorat und Russland machte gemeinsam mit Frankreich Front gegen England. Um alle europäischen Küsten unter Kontrolle zu haben und die Insel hermetisch abzuriegeln, marschierten französische Truppen in Portugal und Spanien, in den Niederlanden, in Norddeutschland und in den Kirchenstaat ein. 1810 stand Europa von Portugal im Westen über Spanien, die Balearen, Korsika und das Königreich Italien im Süden, über Kroatien, Österreich, dem Großherzogtum Warschau und dem Königreich Preußen im Osten sowie den Königreichen Dänemark und Norwegen im Norden unter französischer Herrschaft. Der europäische Kontinent war aufgeteilt zwischen Frankreich und Russland, das an seiner westlichen Grenze von Finnland über Estland und Lettland bis nach Bessarabien reichte und von Tauroggen bis Galizien eine gemeinsame Grenze mit dem französischen Imperium hatte.
Reformen in Preußen
Nach anfänglichem Zögern entschloss sich der preußische König 1807 zu Reformen. Friedrich Wilhelm III. war nach der Niederlage gegen Napoleon ein geschlagener Mann. Der einzige Ausweg aus diesem Dilemma schien in einer reformerischen Radikalkur zu bestehen. Die preußischen Reformen waren nicht vergleichbar mit denen der Revolution in Frankreich. Sie waren nicht Ergebnis einer Souveränitätserklärung durch das Volk oder eines Staatsstreichs. Sie entstanden in den Köpfen der Reformer als Mittel zum Zweck. Preußen sollte wieder machtvoll und wehrhaft werden, dazu waren umfassende Veränderungen unerlässlich. Gemeinsam mit einer Gruppe von Reformern machten sich Heinrich Reichsfreiherr vom Stein und Karl August Graf von Hardenberg daran, den preußischen Staat zu modernisieren. Dabei schreckten sie nicht davor zurück, die Errungenschaften der französischen Revolution zu übernehmen. Die nach den beiden benannten „Stein-Hardenbergschen Reformen“ seien ein „Griff in das Zeughaus der Revolution“, hieß es kritisch. Aus dem preußischen Söldnerheer wurde ein Volksheer, dessen große Wirkungskraft man bei der französischen Armee hatte bewundern können. Der veraltete Ständestaat und die Leibeigenschaft der Bauern wurden abgeschafft. Die Staatsverwaltung wurde umstrukturiert, eine Städte- und Justizreform durchgeführt, „Judenemanzipation“ und Gewerbefreiheit verkündet sowie ein Ministerkollegium eingeführt. Höhepunkt war eine Bildungsreform, die dem Staat gut ausgebildete und den Prinzipien des Humanismus verpflichtete Beamte zuführen sollte. Napoleon beobachtete diese Entwicklung mit Sorge, da er die mittelfristige Wirkung solcher Reformen aus Frankreich nur allzu gut kannte. Sein Statthalter in Preußen beobachtete den Reformprozess und die Reformer genau und zog sie - wenn es sein musste – aus dem Verkehr. Dennoch konnte Napoleon die Reformen, die in wenigen Jahren Preußen modernisierten, nicht verhindern.
Derweil machten sich zu Beginn des zweiten Jahrzehnts die Konsequenzen der Kontinentalsperre gegen England bemerkbar. Die Länder des Rheinbundes litten unter den ökonomischen Zwängen, die dieser in ihren Augen „totale Krieg“ mit sich brachte. Dadurch dass es an jenen Waren mangelte, die bisher aus England importiert wurden, war der Krieg auch auf den zivilen Bereich der Bevölkerung ausgeweitet worden. Die Not wurde noch größer, weil die eigenen Produkte nicht mehr nach England exportiert werden durften. Die Konsequenz war ein blühender Schmuggel über Nord- und Ostsee, Dänemark und Schweden. Bis nach Frankfurt oder Leipzig führten die Schmugglerrouten, die vor allem überseeische Kolonialwaren nach Deutschland brachten. Bestechung und Korruption blühten und öffneten immer neue Wege, verbotene Waren ins Land zu holen. Die französische Reaktion ließ nicht lange auf sich warten und steigerte den Hass gegen die Besatzer weiter: französische Truppen übernahmen die Überwachung der deutschen Küstenstreifen, 1810 annektierte Napoleon Holland und wenn das alles nichts half, dann wurden englischen Waren mit derartig astronomischen Zöllen belegt, dass sie unerschwinglich wurden (Nipperdey, 1983).
Ähnliche Schwierigkeiten ergaben sich auch für Russland. Zar Alexander fand zum einen zwar Gefallen daran, neben Napoleon der mächtigste Herrscher auf dem europäischen Kontinent zu sein. Zum anderen aber war die russische Wirtschaft auf die Einfuhr englischer Erzeugnisse angewiesen. Der Export nach England und die Einfuhr von Textilien, Kaffee oder Tee und Tabak waren gestoppt. Das führte einerseits zu Problemen in der eigenen Wirtschaft und andererseits zu einem drastischen Rückgang der Steuereinnahmen aus diesen Geschäften. Ende 1810 verschlechterte sich das Verhältnis Alexanders zu Napoleon durch die Verlegung von französischen Divisionen an die russische Grenze, was den Zaren veranlasste, die Kontinentalsperre gegen England aufzuheben und die russischen Häfen für englische Waren wieder zu öffnen. Eigentlich hätte die eigenmächtige Handlung des russischen Zaren Napoleon signalisieren müssen, dass der Höhepunkt seiner Herrschaft über Europa vorbei war. Stattdessen aber löste die Nachricht aus Moskau einen lautstarken Tobsuchtsanfall des französischen Kaisers aus, dem wüste Beschimpfungen des „russischen Weichlings“ folgten.
Unmittelbar nach dem russisch-französischen Zerwürfnis begannen beide Seiten, sich auf einen Krieg vorzubereiten, der im Juni 1812 mit dem Marsch der „Grande Armée“ nach Moskau auch begann. Es war die größte Truppenbewegung der Geschichte, die Napoleon gegen Russland ins Werk setzte. Seine eigenen Möglichkeiten überschätzend führte er fast eine halbe Million Soldaten nach Russland. Die russische Armee unter der Führung von General Michail Kutusow ließ die Franzosen ins Leere marschieren, indem sie sich immer weiter ins Landesinnere zurückzog und den Franzosen die Versorgungslinien abschnitt. Vor Moskau kam es am 7. September 1812 zur Schlacht von Borodino, mit fast 30.000 Toten oder Verwundeten auf französischer Seite. Die Schlacht endete mit einem Pyrrhussieg für Napoleon. Der Schriftsteller und Schlachtenmaler Albrecht Adam hat das Ende der Schlacht von Borodino miterlebt:
„Bluttriefend schleppten sich die Soldaten aus dem Kampfe, an vielen Stellen war das Feld mit Leichen bedeckt; was ich an Verwundungen und Verstümmelungen an Menschen und Pferden an diesem Tag gesehen, ist das Grässlichste, was mir je begegnete, und lässt sich nicht beschreiben.“
Mitte September 1812 erreichte Napoleon Moskau, einen Tag später zündeten Russen die Stadt an. Ein an den Zaren gerichtetes Waffenstillstandsabkommen blieb einen Monat lang unbeantwortet, so dass Napoleon Ende Oktober 1812 entnervt aufgab und angesichts des beginnenden Winters den Rückzug seiner Truppen anordnete. Der harte Winter und andauernde Überfälle durch russische Kosakenverbände brachten den Invasoren hohe Verluste bei. Nach der Schlacht an der Beresina Ende November 1812 verließ Napoleon seine Truppe und flüchtete nach Paris zurück. Am Ende der Expedition nach Russland war die „Grande Armée“ nahezu vollständig aufgerieben, nur 45.000 Soldaten sahen die französische Hauptstadt wieder.
Europa gegen Napoleon
Die Kunde von der Niederlage der französischen Armee und dem Rückzug des als unbesiegbar geltenden Napoleon verbreitete sich wie ein Lauffeuer in Europa. Preußen hatte für den Russlandfeldzug Soldaten abstellen müssen, die von General York befehligt wurden. Jener General York unterzeichnete am 30. Dezember 1812 ein Waffenstillstandsabkommen mit den russischen Befehlshabern, das nur für seine preußische Armee galt. Diese „Konvention von Tauroggen“ überstieg die Kompetenz des Generals, der aber den zu erwartenden Zorn des preußischen Königs in Kauf nahm. Fünf Tage später schrieb er einen Brief an Friedrich Wilhelm III. und forderte ihn darin zum Handeln gegen den geschwächten französischen Kaiser auf. Wohl selten hat ein Brief eine derartige Wirkung erzielt, denn er war der Startschuss zur Befreiung des Kontinents von der Hegemonie Frankreichs. Zwei Monate später veröffentlichte der preußische König den Aufruf „An mein Volk“ und appellierte dabei an das erwachende Nationalgefühl der Deutschen:
“Brandenburger, Preußen, Schlesier, Pommern, Litauer! Ihr wisst, was Ihr seit fast sieben Jahren erduldet habt, Ihr wisst, was Euer trauriges Los ist, wenn wir den beginnenden Kampf nicht ehrenvoll enden. Erinnert Euch an die Vorzeit, an den großen Kurfürsten, den großen Friedrich. (…) Es ist der letzte entscheidende Kampf, den wir bestehen für unsere Existenz, unsere Unabhängigkeit, unseren Wohlstand; keinen anderen Ausweg gibt es, als einen ehrenvollen Frieden oder einen ruhmvollen Untergang.“
Der Aufruf zeigte Wirkung. Überall strömten Freiwillige zusammen, von einer Welle nationaler Erregung erfasst organisierten Soldatenfrauen patriotische Kaffeekränzchen und tauschten ihre goldenen Eheringe gegen schmucklose Eisenringe, auf denen die Parole eingraviert war „Gold gab ich für Eisen. 1813“. Der „Aufruf an mein Volk“ versetzte Preußen und Deutsche gleichermaßen in einen nationalen Taumel, Freiwilligenverbände marschierten durch die Straßen, verbreiteten das Gefühl des nationalen Widerstands und signalisierten den französischen Besatzern: dieses Volk ist in Waffen! „Deutschland steht auf! Der preußische Adler erweckt in allen treuen Herzen durch seine kühnen Flügelschläge große Hoffnung“, schrieb der 22jährige Dichter Theodor Körner an seinen Vater. Als er kurz danach auf dem „Feld der Ehre“ sein Leben hingab, hatte die nationale Bewegung ihren ersten Märtyrer. Der Aufruf des preußischen Königs traf auf fruchtbaren Boden, denn die rigoros auf die Durchsetzung französischer Interessen gerichtete Politik Napoleons hatte bei vielen Deutschen nationale Gefühle geweckt. Dieser Stimmungswandel war auch in Spanien oder Portugal bemerkbar, wo sich die alten Reichsstände erhoben und den Widerstand gegen die französische Armee organisierten.
In Deutschland meldeten sich nationale Literaten zu Wort und propagierten einen deutschen „Nationalismus“, der dem Übel der französischen Besatzung ein Ende bereiten sollte. Sie propagierten eine spezifisch deutsche Identität und grenzten sich so vom hegemonialen Frankreich ab, das zum Hort allen Übels erkoren wurde. Gleichzeitig wurden „emotionale Bindungen auf das Kollektiv“ übertragen und eine „eine Sakralisierung des Vaterlands“ (Planert, 2004) vorgenommen. Johann Wolfgang von Goethe machte sich über „Deutschlands Zukunft“ Gedanken und schrieb 1813, dass die Deutschen „eine große Bestimmung haben, eine Bestimmung, welche um so viel größer sein wird denn jenes gewaltige Werk der Zerstörung des Römischen Reichs“ (Pollmann, 1989). Johann Gottlieb Fichtes „Reden an die deutsche Nation“ waren schon im Titel ein Programm und hatten die Deutschen bereits 1808 aufgefordert, ihr Schicksal in die Hand zu nehmen und „Großes zu vollbringen.“ Aber der deutsche Nationalismus stand vor dem Problem, auf welches Deutschland er sich beziehen sollte. So lange Preußen und Österreich eigenständige Staaten waren, machte die Vorstellung einer Identität aller Deutschen als Angehörige einer Abstammungsgemeinschaft mit gemeinsamer Kultur und Sprache keinen Sinn. Die patriotischen Hoffnungen zielten also nicht auf eine geeinte Nation, sondern erst auf das „Heilige Römische Reich“ unter habsburgischer Führung und als das nicht mehr bestand auf den Rheinbund. Dabei forderten Johann Gottlieb Fichte und andere eine Abkehr von Napoleon und eine Hinwendung zu einem selbständigen deutschen Staat. Sie wollten ein neues Gemeinwesen, dass die Macht der Fürsten einschränkte und an Gesetze band.
Während der „Franzosenzeit“ wirkten die nationalen Zirkel im Verborgenen, hatten keine öffentliche Strahlkraft. Mit den steigenden Repressionen durch französische Truppen in Deutschland wurden die Rufe nach einem „nationalen Zusammengehen“ aber lauter. Alsbald mischten sich bei Theodor Körner oder Achim von Arnim Beschwörungen zum „heiligen Krieg“ oder zum „Kreuzzug“ gegen Frankreich in die romantisierenden nationalen Klagen. Nach der Niederlage Napoleons in Russland, dem königlichen Aufruf zum Widerstand gegen Frankreich und der begeisterten Rezeption durch die preußische und darüber hinaus deutsche Bevölkerung wurden nationale Lieder, Gedichte und Karikaturen verfasst, die Ausdruck eines gewachsenen deutschen Nationalismus waren. Preußen war nun Hoffnungsträger der Befreiung vom Joch der französischen Besatzung und wurde von der „Lyrik der Befreiungskriege mit jener transzendenten Macht ausgestattet, die bisher nur der Religion vorbehalten war“ (Planert, 2004). Ernst Moritz Arndt griff religiöse Überhöhungen in seinem „Kriegskatechismus“ auf und sprach davon, dass es „blutige Tyrannen“ gewesen seien, die „Freiheit und Gerechtigkeit“ getilgt hätten. Ohne die Franzosen oder Napoleon beim Namen zu nennen, wusste jeder wer oder was gemeint war.
Die nationale Euphorie, die man in Deutschland ausmachen konnte, äußerte sich in Preußen etwas zurückhaltender. Der Staat war erst 1701 gegründet worden, konnte also kaum auf eine lange eigene Entstehungsgeschichte zurückblicken, die Stolz oder Glücksgefühle hätte vermitteln können. Der Nationalismus blieb in Preußen intellektuellen Zirkeln und Debattierclubs vorbehalten, die Schriften Johann Gottfried Herders, Friedrich Schleiermachers, Johann Gottfried Fichtes oder Ernst Moritz Arndts machten vor allem in den übrigen deutschen Ländern die Runde. Zwar hatte der Staatswissenschaftler und Publizist Friedrich Carl von Moser den Deutschen ins Stammbuch geschrieben, dass für die meisten von ihnen, das Stück Erde, auf dem sie geboren wurden, ihr „wahres und alleiniges Vaterland“ sei. Dennoch war die Konfrontation mit der französischen Besatzung die Geburtsstunde eines nationalen Gemeinsamkeitsgefühls der Deutschen, das weit über die eigene Scholle hinausging. Für Johann Gottlieb Fichte waren die Deutschen das „unverfälschte Volk, das gegen die militärische wie kulturelle Unterjochung durch Frankreich um seine Freiheit und Identität kämpft.“ Ohne diese Identität näher zu definieren, war Fichte und anderen klar, dass sie sich als Gegenwehr zur Herrschaft der Franzosen entwickelt hatte. Friedrich Ludwig „Turnvater“ Jahn ließ die deutsche Jugend über Bock und Seil springen, um sie fit zu machen für den Kampf gegen Napoleon und Ernst Moritz Arndt schließlich erklärte den blutigen Hass gegen Frankreich zur Religion, die in der Anbetung des Vaterlands münden sollte. Die französische Besatzung hatte einen deutschen Nationalismus mit zwei Elementen geweckt: Der eigenen nationalen Überhöhung und der Herabwürdigung der französischen Besatzer. Beides wird die Beziehung der Nachbarvölker für die kommenden 150 Jahre kennzeichnen.
Einer allein ist nicht stärker als die anderen zusammen
Nach dem französischen Rückzug aus Russland begannen sich die europäischen Großmächte um eine antifranzösische Koalition zu bemühen. Die nationale Begeisterung in Deutschland kannte kaum Grenzen, als im Frühjahr 1813 Preußen und Russland Frankreich den Krieg erklärten. Bald darauf trat auch Österreich der antifranzösischen Koalition bei und erklärte Frankreich ebenfalls den Krieg. Im Sommer 1813 standen auf französischer Seite etwa 190.000 Soldaten aus Frankreich, Italien, dem Königreich Neapel, dem Herzogtum Warschau und aus einigen kleineren Staaten des Rheinbunds. Die Koalition brachte ein paar Tausend Soldaten mehr aus Preußen, Russland, Österreich und Schweden auf das Schlachtfeld vor den Toren Leipzigs. In der „Völkerschlacht“, die vom 16. bis zum 19. Oktober 1813 stattfand, erlitt Frankreich eine Niederlage, Napoleon konnte der eigenen Gefangennahme nur durch eine überstürzte Flucht entgehen. Am gleichen Tag desertierten die Truppen der Rheinbundstaaten und läuteten das Ende der französischen Herrschaft in Deutschland ein. Als Napoleon das vom österreichischen Außenminister Clemens Fürst von Metternich übermittelte Friedensangebot ablehnte, britische Truppen aus Spanien vorrückten und die Koalitionstruppen Ende März 1814 vor den Toren von Paris standen, dankte er am 6. April 1814 ab und ging auf Elba ins Exil.
Während die Siegermächte in Wien schon über eine Nachkriegsordnung in Europa diskutierten, kehrte Napoleon am 1. März 1815 aber noch einmal nach Paris zurück, wo ihn seine Anhänger mit großem Jubel empfingen. König Ludwig XVIII. musste fliehen, Napoleon dachte ein leichtes Spiel zu haben und erlies ein liberales Regierungsprogramm. Aber die Anti-Frankreich-Koalition reagierte sofort, stellte erneut ein Heer zusammen und zog am 18. Juni 1815 bei Waterloo in der Nähe von Brüssel erneut gegen Napoleon in die Schlacht. Als der Tag sich seinem Ende zuneigte, war die Entscheidung gefallen: Napoleon war besiegt und Europa von der französischen Vorherrschaft endgültig befreit. Der geschlagene Napoleon dankte ein zweites Mal ab und wurde erneut verbannt; dieses Mal auf die kleine Insel St. Helena im südatlantischen Ozean, wo der einstige Imperator am 5. Mai 1821 einsam und – wie er meinte - von der Welt unverstanden, starb.
Napoleons Versuch, den Kontinent unter die Hegemonie eines Staates zu zwingen, war endgültig missglückt. Eine Einheit Europas unter französischem Protektorat war genauso zum Scheitern verurteilt, wie ein „arisches“ Europa unter deutschem Vorzeichen, das 120 Jahre später vom nationalsozialistischen Deutschland initiiert wurde. Auf Dauer war es Frankreich am Beginn des 19. Jahrhunderts nicht gelungen, genügend Macht und Stärke zu entwickeln, um das europäische Gleichgewicht langfristig zu seinen Gunsten zu verändern. Vitalität und Widerstandskraft der europäischen Völker waren stärker als die militärische Gewalt des nach der Alleinherrschaft strebenden französischen Kaisers. Ein weiteres Mal hatte sich gezeigt, dass Europa aus vielen Mitgliedern besteht, von denen keines groß und mächtig genug ist, um die anderen unter seine Fuchtel zu zwingen: Einer allein ist nicht stärker als die anderen zusammen.
Am Ende der mehr als 10jährigen Besatzung durch die Franzosen und nach den Entbehrungen vieler europäischer Kriege fragten sich die Menschen in Deutschland, warum sie all das jahrelang ertragen haben. Familien, deren Väter oder Söhne auf irgendeinem Schlachtfeld liegen geblieben waren, wollten eine Antwort auf die Fragen, warum das Blut ihrer Angehörigen fließen musste. Nationalen und liberalen Intellektuellen gelang es, diese Fragen mit dem politischen Ziel eines geeinten Deutschlands zu verbinden. Einer der Wortführer war der Herausgeber des „Rheinischen Merkur“ Johann Joseph Görres. Er setzte sich in seiner Zeitung für liberale Ideen ein, wünschte sich „die nationale Freiheit der Deutschen“, und forderte im Sommer 1815 eine deutsche Verfassung:
“Etwas Ganzes und Rechtes soll da werden, und man soll die Stimme des Volkes befragen, (die) an allen Orten spricht. Deutschland will eine Verfassung, die sichere, was das Volk mit seinem Blut erworben hat“.
Diese pathetischen Zeilen dürften auch eine dunkle Vorahnung des Urhebers beinhaltet haben, denn die Ordnung, die die europäischen Potentaten nun ausarbeiteten, nahm auf nationale Wünsche oder Befindlichkeiten keine Rücksicht. Einzig die Angst vor erneuten Revolutionen und Umstürzen, bei denen die Monarchien in Mitleidenschaft gezogen werden würden, trieb die europäischen Regenten an, als sich daran machten, eine Nachkriegsordnung zu verabreden. Die Deutschen in der Mitte des Kontinents fühlten sich zwar einerseits als Sieger über Napoleon, befürchteten aber andererseits auch, Opfer im Machtpoker…