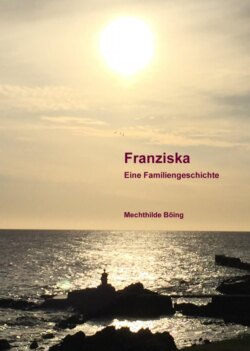Читать книгу Franziska - Mechthilde Böing - Страница 4
4 Christine - Sommer 1936
ОглавлениеSie stand in der großen Hauptküche und schaute aus dem Fenster. Christine konnte ihren Blick schweifen lassen bis zum Horizont. Kein Mensch war zu sehen, nur Kühe und Pferde in weiter Ferne.
Rund um das Haus wuchs ein kleiner Wald aus hohen Bäumen, die für die Gegend typischen Ceibos und Ombues, aus denen das Gekreische der gigantischen Ansammlung grüner Papageien an ihr Ohr drang. In einiger Entfernung konnte sie die Allee von Obstbäumen sehen, die an dem Schotterweg entlang gepflanzt waren, der zu den kleinen Häusern der Arbeiter führte. An beiden Seiten des Weges befanden sich ausgedehnte Weideflächen für die Pferde der Gauchos, die allerdings momentan in der Viehtriebsaison komplett leer waren.
Sie hatte diese immergrüne, hügelige Landschaft mit der Zeit lieben gelernt und war nie böse, dass es in Uruguay keine harten Winter gab mit Schnee und Eis. Davon hatte sie in Deutschland für ihre ganze Lebenszeit genug gehabt.
Auch jetzt im Juni, dem Monat des Winteranfangs, waren die Temperaturen tagsüber noch nicht unter zwölf Grad gesunken und an den meisten Tagen strahlte das Sonnenlicht am klaren blauen Himmel so sehr, dass sie nicht ohne Sonnenbrille das Haus verlassen konnte.
Das hieß allerdings nicht, dass es im Haus nicht kalt war. Es zog durch alle Fenster und Ritzen, so dass die Gardinen ständig in Bewegung waren, und die Luftfeuchtigkeit konnte so sehr ansteigen, dass einem die Kälte buchstäblich in die Wäsche kroch. Dann zog einem die Kühle auch schon mal durch Mark und Bein, besonders, wenn man sich nicht in der Küche oder dem Salon aufhielt, wo Herd und Kamin ohne Unterlass befeuert wurden.
Sie war froh, dass sie damals ihre Wintersachen aus Deutschland mitgebracht hatte. Hier konnte sie ihre selbst gestrickten Socken und die dicken Pullover im Norwegermuster gut gebrauchen, wenn sie abends nach getaner Arbeit mit Eduardo in ihr eigenes gemütliches Verwalterhaus ging und darauf wartete, dass der Kamin seine wohlige Wirkung entfachte.
Christine hatte ihren Platz im Leben gefunden. Sie war glücklich, zumindest die meiste Zeit. Ihre Stellung als sogenannte Ama de Llaves, Haushaltsvorsteherin und oberste Dienstherrin, auf der Estancia Nueva Mehlem erlaubte ihr ein schönes, komfortables Leben mit vielen Annehmlichkeiten. Ihr Mann Eduardo war der vom Besitzer eingesetzte Verwalter des Guts, einem für sie zuvor unvorstellbar großen Rinderzuchtbetriebs mit siebenundzwanzigtausend Hektar, den zwei Brüder der bekannten Bankiersfamilie Wendelstadt aus Bonn vor vielen Jahren gegründet hatten.
Christine trug die Verantwortung für den gesamten Haushalt des Herrschaftshauses sowie die Gästeunterkünfte, inklusive des Personals. Ihre Aufgabe war es, vor allem sicher zu stellen, dass es den Besitzern und ihren Besuchern an nichts fehlte, wenn diese für einige Wochen im Jahr vor Ort waren. In der übrigen Zeit konnte sie sich ihren vielfältigen sozialen Kontakten widmen, die sich überwiegend aus den anderen Verwaltern der Landgüter in der Region rekrutierten, mit denen man sich regelmäßig traf und ein feudales Leben zelebrierte. Sie las ausgiebig, machte Handarbeiten und schrieb häufig Briefe an ihre Brüder und Freunde in Deutschland, in denen sie mit Begeisterung von ihrem Leben am anderen Ende der Welt erzählte.
Wenn sich die derzeitigen Besitzer der Estancia einmal im Jahr für einen längeren Zeitraum ansagten und aus Deutschland anreisten, war bei allen Mitarbeitern, besonders aber bei Eduardo und Christine, Arbeit auf Hochtouren angesagt.
Tagelang ritt Eduardo über die Felder, um Inventur des Rinderbestandes zu machen, den Zustand der Wiesen und Zäune zu begutachten, die wirtschaftliche Lage des Betriebs in Zahlen und Worten festzuhalten, um dann die Bilanzen zu erstellen und das Budget für das nächste Jahr anzufertigen.
Christine sorgte dafür, dass das Herrschaftshaus auf Hochglanz gebracht und mit den vor Ort reichlich blühenden Blumen und Gräsern ansprechend dekoriert wurde. Alle Schlafzimmer mussten gründlich gereinigt, das Silber geputzt, alle Gläser und das beste Geschirr abgewaschen und der Fußboden im gesamten Haus gewienert werden. Hierbei standen mehrere Hausmädchen unter ihrer Aufsicht, die sämtlich aus den dreißig deutschen Familien stammten, die vor mindestens zwei Generationen in diese Gegend ausgewandert waren und sich jetzt in verschiedenen Funktionen auf dem Gut wiederfanden. Da war dann ein Gewusel und Geklapper im ganzen Haus, dass es Christine mit Stolz und Zufriedenheit erfüllte, ob ihrer guten Organisation.
Wenn die Herrschaften angekommen waren, wurde jeweils die Menüfolge der folgenden Woche festgelegt und sie fuhr in die nächstgelegene Stadt Fray Bentos, um all das zu besorgen, was sie nicht selbst auf dem Hof herstellen konnten. Es gab eine wunderbare Manufaktur für edles Konfekt, einen Getränkevertrieb, bei dem man den in Strömen fließenden edlen Whiskey, Bier und Wein erstehen konnte, exzellente Fischräuchereien und einen Obst- und Gemüseimporteur mit exotischem Angebot aus der gesamten Welt.
Christine hatte schon vor einiger Zeit das Autofahren erlernt und freute sich jedes Mal wie eine Königin, wenn sie in ihrem besten Kleid im neuen Buick Cabrio saß, ihr die Sonne ins Gesicht lachte und der Wind an ihrem Hut zerrte, den sie mit einem Tuch um den Kopf festgebunden hatte. Ihr kleiner Foxterrier Carlo war immer an ihrer Seite, wenn sie unterwegs war, und sie fühlte sich vom lieben Gott reichlich beschenkt.
Einmal im Jahr, rund um Weihnachten, im uruguayischen Sommer, gaben die Besitzer ein großes Grillfest, Asado genannt, zu dem die Nachbarn und Geschäftspartner des Gutes eingeladen wurden.
Rinder und Lämmer wurden geschlachtet und auf riesigen Grills von den Männern über Stunden zubereitet. Das Fleisch war so saftig und lecker, dass Christine schon beim Gedanken daran das Wasser im Mund zusammenlief. Jeder Teil der Tiere wurde verwendet, die guten Stücke für die honorigen Gäste, die anderen für die Gauchos und ihre Familien, und selbst von den Knochen fand man nichts mehr, wenn die Hundemeute sich mit ihnen beschäftigt hatte.
In der Küche wurden zuvor Körbe voll mit Broten gebacken, Unmengen an Salaten zubereitet, und die leckersten Torten kreiert. Auch die süßen Desserts, vornehmlich mit Dulce de Leche, einer Art Karamell, durften nicht fehlen. Es duftete im ganzen Haus und jeder war in einem Zustand freudiger Erwartung auf das Fest, das unter den Bäumen in lockerer Atmosphäre alle Generationen zusammenbrachte.
Bei einem solchen Asado hatten sich Christine und Eduardo vor mehr als fünfzehn Jahren kennengelernt.
Christine liebte diese Wochen, wenn die Eigentümer vor Ort waren. Dann konnte sie zur Höchstform auflaufen und alle ihre Talente zur Schau stellen. Sie fühlte sich trotz ihrer bescheidenen Herkunft in der gehobenen Gesellschaft wohl und konnte jede Diskussion entweder mit Wissen oder zumindest mit Charme bereichern.
Das nie fehlende Lob der Hausherrin am Ende des Besuchs war für sie der schönste Lohn.
„Liebe Christine, wie Sie das wieder hinbekommen haben. Einfach toll. Es ist jedes Jahr wieder ein riesiges Vergnügen für uns alle, hier zu sein. Wir freuen uns schon auf unser Kommen im nächsten Jahr.“
Und das Lächeln würde erst Tage später von Christines Gesicht weichen.
Danach genoss sie auch gern wieder die Ruhe, wenn das Leben seinen gewohnten Gang ging und sie eine Menge Zeit für sich selbst fand, um ausführliche Briefe an ihre Lieben daheim zu schreiben.
Sie wartete dann sehr gespannt auf die Antworten, in denen ihr Bruder Aloys aus seinem Leben berichtete und ein neues Familienfoto hinzufügte.
Die ständige Geldknappheit hatte für Aloys nicht abgenommen und der Tod des kleinen Sohnes Eduard, der nach seinem Onkel in der Ferne benannt war, und der 1928 einjährig an Brechdurchfall gestorben war, hatte ihn und seine Frau mehr getroffen, als sie jemals erwartet hätten. Zuvor hatte Aloys, dessen Aufgabe es war, die Kirchenglocken zu läuten, wenn ein Gemeindemitglied gestorben war, auf Nachfrage schon mal gesagt, „Ach, es war nur ein Kleinkind.“ Das sagte er nie wieder nach Eduards Tod.
Aloys dankte trotzdem dem Herrgott täglich, dass er so viele seiner Kinder aufwachsen sehen durfte und dass seine Frau die vielen Schwangerschaften und Geburten heil überstanden hatte. Das war beileibe keine Selbstverständlichkeit in diesen Zeiten, wo Mütter oft im Kindsbett starben und ansteckende Krankheiten Familien erheblich dezimieren konnten. Josefines Schwägerin in Oeding hatte bereits drei ihrer neun Kinder verloren und dann auch noch ihren Mann, der bei der Reparatur des alten Daches ihres Hauses abgestürzt war. Was für ein hartes Schicksal.
In seinem letzten Brief hatte Aloys resümiert, wie sehr sie doch eigentlich gesegnet waren, wenn man mal alles zusammengenommen betrachtete.
Einzig der kleine Hannes war derzeit ein Sorgenkind. Der Dreijährige hatte kurz zuvor eine Operation am rechten Bein gehabt, wo sich ein Abszess am Oberschenkel bis in den Knochen gefressen hatte. Tagelang war er im Krankenhaus gewesen, bevor er dick bandagiert nach Hause kam. Regelmäßig musste die Wunde drainiert werden, was so schmerzhaft gewesen war, dass er sich noch lange Zeit später weigerte, am Krankenhaus vorbei zu laufen, aus Angst, er müsse wieder durch diese Tür zu seinen Folterern gehen.
Er hoppelte mit einem Stühlchen durchs Zimmer und ließ seine Mutter nie aus den Augen, die trotz ihrer sonst eher harten Erziehungsmethoden für ihren Jüngsten eine weiche Stelle in ihrem Herzen gefunden hatte. Sie gab ihm heimlich Bananen als Belohnung für seine Tapferkeit, die sie sich eigentlich nicht leisten konnten. Aloys hatte so getan, als würde er es nicht bemerken, aber er liebte Josefine dafür.
Die Geschwister nannten den Kleinen „das verwöhnte Hänneschen“. Wenn die älteren Schwestern nach Hause kamen, versuchten die selbsternannten, strengen Ersatzmütter ihm irgendwelche Allüren auszutreiben, bevor sie überhaupt entstehen konnten.
Die Familie war das einzige, was Christine in Uruguay vermisste. Sie hatte zwar immer viele Menschen um sich, aber Blut war doch irgendwie dicker als Wasser. Zumal es ihr bisher nicht vergönnt war, eigene Kinder zu bekommen.
Es wollte einfach nicht klappen, obwohl sie Kinder doch so liebte. Sie war mehrfach schwanger geworden und stets voller Hoffnung gewesen. Aber dann hatten Bauchkrämpfe und bald einsetzende Blutungen ihrem Traum wieder ein jähes Ende gesetzt.
Ein Arzt, den sie zu diesem Thema in Montevideo aufgesucht hatte, hatte ihr erläutert, dass ihre Gebärmutter nicht richtig entwickelt sei und das wachsende Kind nicht halten könne. Er hatte ihr angeraten, ihren Wunsch nach eigenen Kindern aufzugeben und ein Waisenkind zu adoptieren, aber so weit war sie noch nicht.
Der Gedanke ging ihr jedoch nicht mehr aus dem Kopf und sie hatte sich vorgenommen, das Thema nach ihrem Deutschlandurlaub ausführlich mit Eduardo zu besprechen. Sie freute sich schon sehr darauf, in ein paar Wochen ihre Familie wiederzusehen und die Olympischen Spiele in Berlin zu besuchen.
In Berlin hatte alles angefangen und ihr heutiges Leben wäre damals, als junge Frau, für sie völlig undenkbar gewesen.
Sie hatte zunächst als Kindermädchen in einer Arztfamilie in Bocholt gearbeitet, als sie im Jahr 1916 als Zwanzigjährige von einer Freundin gefragt wurde, ob sie nicht zusammen nach Berlin gehen wollten. Dort gäbe es wesentlich besser bezahlte Stellungen für junge Frauen und das Angebot an heiratsfähigen Männern sei auch reichlicher, denn der andauernde Krieg hatte schon damals große Lücken gerissen.
Christine war schon von jeher abenteuerlustig und neugierig gewesen, und ihre Brüder brauchten sie nicht mehr. Die wurden seit einigen Jahren von ihren Angetrauten bestens versorgt.
So kostete es sie wenig Überwindung, die Heimat zu verlassen und das Wagnis Großstadt einzugehen. Sie mochte das überragende Angebot an möglichen Zeitvertreiben und genoss es für eine Weile, frei und unabhängig zu sein.
Einem Mann, der ihr Herz eroberte, begegnete sie allerdings vorerst nicht. Es schien, als ob auch in Berlin nur die für den Krieg aus irgendwelchen Gründen Ungeeigneten und bereits zurückgekehrten traumatisierten Versehrten auf dem Heiratsmarkt zur Verfügung stünden. Außerdem ging ihr das Gewimmel der Stadt nach einiger Zeit gehörig auf die Nerven und sie wusste bald, dass sie nicht ewig in einer Metropole leben wollte.
Da kam es ihr gerade recht, als ihre Arbeitgeberin, Senta Goldstein, sie fragte, ob sie nicht mit nach Uruguay kommen wolle, wo die Familie ein großes Anwesen besaß und regelmäßig alle paar Jahre nach dem Rechten schauen musste.
Sie hatte die Stellung als Gouvernante der Goldsteins schon kurz nach ihrer Ankunft in Berlin gefunden und sich mit der Frau des Hauses gleich angefreundet. Die Familie hatte drei Kinder, um deren Wohl sie sich ausschließlich kümmerte, und die sie in all ihren Belangen unterstützte, sei es morgens beim Ankleiden, auf dem Weg zur Schule, bei den Hausaufgaben oder den vielen außercurricularen Aktivitäten. Es war eine Aufgabe ganz nach ihrem Geschmack, und man behandelte sie bald wie ein Familienmitglied.
Die Goldsteins waren Besitzer einer Eisenwarenhandelskette, die auch in den oder gerade wegen der Kriegszeiten bestens florierte, so dass es der Familie an nichts fehlte. David Goldstein verkehrte regelmäßig mit den Oberen des Staates und sein Unternehmen war als kriegswichtig eingestuft, mit dem Ergebnis, dass er nicht wie seine Brüder an der Front dienen musste.
Die Kinder gingen auf Privatschulen, die von Schülern aus den besten Familien der Stadt besucht wurden und wo der religiöse oder kulturelle Hintergrund keine Rolle spielte, so lange man die exorbitanten Schulgebühren bezahlen konnte.
Die Familie Goldstein praktizierte ihren jüdischen Glauben eher nachlässig, lediglich die wichtigsten Feiertage und Riten wurden befolgt, und man ging nach Möglichkeit an Freitagabenden nicht aus. Sie fühlten sich als traditionelle, die hohen Künste verehrende, durch und durch deutsche Vertreter eines gehobenen Standes, den sie sich aufgrund ihrer harten Arbeit verdient hatten. So störte es sie auch nicht, dass Christine katholisch war und ihren Kindern manchmal aus dem Neuen Testament vorlas. Mit den christlichen Werten konnten sie sich gut arrangieren. Sie sahen wenig Widersprüche zu ihrer eigenen Sicht auf das Leben.
Christine konnte ihr Glück kaum fassen. Sie würde Gelegenheit bekommen, die weite Welt zu sehen und brauchte noch nicht einmal dafür zu bezahlen. Sie musste sich einzig und allein um die Kinder kümmern, die nach Aussage Senta Goldsteins in Uruguay den ganzen Tag über auf der Farm spielen konnten, ohne größeren Gefahren ausgesetzt zu sein.
Im November 1919 betrat sie in Bremen zum ersten Mal in ihrem Leben ein Schiff, das sie drei Wochen später und, wegen der anfänglichen Seekrankheit, einige Pfund leichter in Montevideo wieder verließ. Dort begab sich die Familie unverzüglich zum Bahnhof, um mit dem Zug die dreihundert Kilometer nach Fray Bentos zurückzulegen, denn man wollte vor dem Chanukka Fest sein Ziel erreichen.
Während der gesamten Fahrt schaute Christine mit einem unwirklichen Gefühl der Ehrfurcht aus dem Fenster und genoss das Vorbeiziehen der lieblichen Landschaft, in der man nur ab und zu in der Ferne ein Haus oder ein kleines Dorf ausmachen konnte.
In Fray Bentos wurden sie vom Verwalter des Familienanwesens begrüßt und in einer Kutsche zur Farm gefahren, während die Fülle der Koffer und Kisten, die alles enthielten, was man an neuer europäischer Kunst herzeigen wollte, mit einem Pferdekarren abtransportiert wurde.
Bereits in der zweiten Woche ihres Aufenthalts in Uruguay erhielt die Familie die Einladung für ein Asado auf der Nachbarfarm Nueva Mehlem. Es war selbstverständlich, dass Christine mitkommen würde, denn sie gehörte ja quasi zur Familie.
Es war ein wunderschöner Hochsommertag. Alle waren bester Laune und glücklich sich wieder zu sehen. Es war eine eingeschworene Gemeinschaft, hier am anderen Ende der Welt. Viele Landbesitzer waren Deutsche oder andere Europäer, so dass man ein Wirrwarr von Sprachen durcheinander hörte.
„Guten Tag, junge Frau. Ich dich nicht kennen.“, sprach sie ein lässig gekleideter, aber mit stolzer Haltung vor ihr stehender Mann an, den sie auf Ende zwanzig schätzte, und den sie schon zuvor im Gespräch mit David Goldstein beobachtet hatte.
Er war ihr gleich aufgefallen, weil er so selbstsicher erschien mit einer starken physischen Präsenz, hochgewachsen, drahtig und muskulös, mit sonnengebräunter Haut. Offensichtlich war er aber keiner der Landbesitzer, denn er gab detaillierte Anweisungen in Spanisch an die Gauchos, die das Fleisch zubereiteten.
„Guten Tag. Ich bin Christine, die Gouvernante der Familie Goldstein. Ich bin zum ersten Mal in Uruguay.“
Und so begann die Liebesgeschichte des auf wundersame Weise zusammen gekommenen Paares aus zwei verschiedenen Kontinenten.
Eduardo hatte sich gleich in sie verliebt und warb um sie mit lateinamerikanischer Passion, obwohl er der Abstammung nach Österreicher war. Seine deutschen Sprachkenntnisse waren in der dritten Generation in Uruguay eher verkümmert, aber das behinderte ihn kaum. Die Sprache der Liebe kennt keine Grenzen.
Als Christine nach acht Wochen Aufenthalt zurück nach Berlin schipperte, hatten sie sich versprochen, die Treue zu halten, bis zum nächsten Besuch wöchentlich zu schreiben und ihre Wünsche und Träume auszutauschen. Christine wollte sofort damit beginnen, Spanisch zu lernen, denn es war von vornherein klar, dass eine gemeinsame Zukunft allenfalls in Uruguay möglich wäre.
Es dauerte drei Jahre bis Christine wieder mit den Goldsteins in Fray Bentos ankam. Diesmal stand auch Eduardo am Bahnhof und zappelte aufgeregt wie ein Schuljunge hin und her. Als er sie in die Arme schloss, wusste er, das sich das lange Warten gelohnt hatte.
Über die nächsten zwei Monate schmiedeten sie bereits Heiratspläne. Diese wurden dann endgültig im Oktober 1924, nach Christines offizieller Einbürgerung in Uruguay, vollzogen. Seit diesem Tag waren sie nie mehr getrennt gewesen.
Anfängliche Auseinandersetzungen, die im Wesentlichen auf kulturellen Unterschieden beruhten, wurden irgendwann gütlich beigelegt. Die beiden starken Charaktere fanden einen Weg, den anderen so zu akzeptieren, wie er war, und sich bei der Aufgabenverteilung nicht in die Quere zu kommen.
Jetzt, viele Jahre später, freute sich Christine endlich Eduardo ihrer Familie vorzustellen. Immerhin waren sie ja bereits fast zwölf Jahre verheiratet, aber das Geld für die lange Reise hatten sie sich erst zusammensparen müssen.
An einem kalten, klaren Tag Anfang Juli zogen sie ihre besten Kleider an, verabschiedeten sich von ihrem Personal und einigen Freunden, die an den Bahnhof gekommen waren, und stiegen mit freudiger Erregung in den Zug nach Montevideo. Hier bummelten sie abends durch die schicke Prachtstraße Avenida 18. Juli mit ihren exklusiven Boutiquen, verbrachten eine Nacht im stilvollen Art Nouveau Hotel Palacio in der Altstadt, gingen zum Frühstück ins Café Rheingold und machten sich dann auf den Weg zum Hafen, wo die Columbus II der Reederei Norddeutsche Lloyd schon auf sie wartete.
Als sie nach zwei Wochen in Bremen ankamen, waren beide froh, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben, denn das Schaukeln auf hoher See bei Windstärke sechs hatte ihnen schwer zugesetzt.
Ihre Reiseplanung sah für die ersten drei Wochen einen Aufenthalt in Berlin bei der Familie Goldstein vor, und sie freuten sich sehr auf ein Wiedersehen. Die Goldsteins hatten ihr Anwesen in Uruguay schon 1925 verkauft, um in Argentinien zu investieren, wo sie ein noch größeres Areal in der Nähe von Buenos Aires erworben hatten.
Dort hatten Christine und Eduardo sie im Jahr 1930 einmal besucht und mussten bei der Rückreise über den Rio de la Plata fast um ihr Leben fürchten, weil fußballverrückte Argentinier sie unangenehm bedrängten. Diese waren noch immer äußerst unglücklich darüber, dass Uruguay die erste Weltmeisterschaft ausgerichtet und dann auch noch gewonnen hatte. Das ließ der Stolz der Albicelestes, wie sich die Fußballanhänger der viel größeren Nachbarnation wegen ihrer blauweiß gestreiften Trikots nannten, einfach nicht zu.
Die Zugreise von Bremen nach Berlin war sehr angenehm gewesen und Eduardo bestaunte die Sauberkeit und Ordnung in den Städten entlang der Route.
Am Hauptbahnhof in Berlin nahmen sie sich ein Taxi und ließen die Schönheit der Stadt auf sich wirken, die sich sehr verändert hatte, seit Christine sie im Jahr 1924 verlassen hatte. Die Siegessäule oder, wie Christine ihren Mann aufklärte, die Goldelse, erstrahlte in vollem Glanz über der großen sternenförmigen Kreuzung, die Eduardo wegen ihres intensiven Verkehrs für einen Moment schwindlig werden ließ. Er hatte für eine Sekunde die Orientierung verloren, sah dann aber in der Ferne, dass sie auf das Brandenburger Tor zufuhren.
An beiden Seiten des Boulevards standen in kurzen Abständen Flaggenmasten, die alle mit der Fahne der Nationalsozialistischen Partei bestückt waren, die brav vom Wind in dieselbe Richtung geweht wurden. Der Eindruck war ergreifend und die beiden sprachen lange nicht, so sehr waren sie in den Bann gezogen worden vom Anblick dieser Stadt, die aufs Herrlichste herausgeputzt war.
Christine bewunderte die vielen Baustellen, an denen neue, monumentale Gebäude entstanden und freute sich, dass das Berliner Schloss, der Dom und die Museumsgebäude der Gründerzeit wieder in ihrer alten Pracht zur Geltung kamen.
Am Alexanderplatz wimmelte es von Menschen, die von Geschäft zu Geschäft eilten, um ihre Einkäufe zu erledigen. Überall waren Polizisten und Soldaten in Uniform zu sehen, die durch die Straßen schlenderten und offensichtlich dafür sorgen sollten, den Besuchern der Olympiade einen sicheren und angenehmen Aufenthalt zu bereiten.
In einigen Schaufenstern hingen Schilder „Kauft nicht bei Juden!“, worauf Christine etwas erschrak und sich fragte, ob das wohl auch für die Goldsteins galt.
Als sie endlich an der Villa der Goldsteins in der Frankfurter Allee ankamen, waren sie ziemlich erschöpft von der langen Reise und den überwältigenden Eindrücken der letzten halben Stunde.
Sie wurden von Senta und David Goldstein freudestrahlend begrüßt. Ihnen wurde das schönste Gästezimmer zugewiesen, das es im Haus gab. Den Abend verbrachten sie damit, alte Geschichten wieder aufzuwärmen und sich nach dem Wohlbefinden gemeinsamer Freunde zu erkundigen.
Senta hatte überraschender Weise selbst gekocht, eine Köchin war in der Küche nicht zu sehen gewesen. Es gab Rindergulasch mit Kartoffelbrei und Rotkohl. Sie lachten viel und scheinbar unbeschwert, so dass Christine und Eduardo glücklich ins Bett fielen.
Am nächsten Morgen wagte es Christine zu fragen, was es mit den Schildern in den Geschäften auf sich habe, und die Goldsteins wurden still. Schließlich erzählten sie ihren Gästen, dass ihre Eisenwarengeschäfte bereits an ein nichtjüdisches, nationalsozialistisches Parteimitglied verkauft waren, zu einem aus ihrer Sicht lächerlichen Preis, und sie in Kürze Berlin verlassen würden, um fürs Erste nach Argentinien umzusiedeln.
Die Situation hatte sich für sie seit der Machtübernahme der Nationalsozialisten dramatisch verschlechtert. Ihre Kinder konnten nicht mehr in Deutschland studieren und waren bereits an Hochschulen in New York und London gegangen. Auf einmal war alles, was sie ausgemacht hatte, ihre gehobene Stellung, ihr gesellschaftliches Ansehen, die loyale Unterstützung des deutschen Staates während des Krieges, ihres Staates, wie sie betonten, nichts mehr wert. Sie wurden, wie andere wohlhabende Juden auch, verdächtigt, sich gegen „die Deutschen“ verschwören zu wollen, und wurden als geldgierige Monster und unhygienische Lumpen verunglimpft.
David hatte das alles nicht wahrhaben wollen, bis er eines Tages von SS-Schergen auf der Straße attackiert wurde. Danach hatte Senta darauf bestanden, dass sie zur eigenen Sicherheit und die der Kinder Deutschland verlassen würden, bis dieser, wie sie sich ausdrückte „menschenverachtende, willkürlich tobende Mob“ in der nächsten, höchstens aber der übernächsten Wahl zum Teufel geschickt würde. Sobald der gesunde Menschenverstand wieder in ihr Heimatland einzöge, kämen sie zurück. Immerhin waren alle ihre Wurzeln hier, und sie konnten sich das Alter ohne ihre Freunde und Verwandte in Berlin dann doch nicht vorstellen.
Die uruguayischen Gäste waren sichtlich konsterniert und erschrocken. In ihren Zeitungen waren die Nationalsozialisten eher als eine zu bewundernde politische Gruppierung beschrieben worden, die Deutschlands Zukunft proaktiv gestaltete und einen Führer hatte, der mit viel Charisma und eindrucksvollen Ansprachen Menschen für seine Sache gewinnen konnte und nur die besten Absichten für sein Volk hatte.
Auch Christines Bruder Aloys berichtete in seinen Briefen begeistert von den Veränderungen im Land, die ihn mit Stolz erfüllten und hoffnungsvoll in die Zukunft schauen ließen. Nun fanden sie heraus, dass diese Sicht nicht unbedingt von jedem geteilt wurde und die rosigen Zukunftsaussichten vielleicht nicht allen Menschen des Landes winkten.
Die nächsten Tage nutzten Christine und Eduardo, die nun erst einmal mit etwas gemischten Gefühlen durch die Stadt gingen, um Museen zu besuchen, eine Bootstour auf dem Wannsee zu machen, entlang der Spree zu spazieren und dem schönsten Zoo, den sie je gesehen hatten, einen Besuch abzustatten.
Die Stadt war gefüllt mit Besuchern aus dem In- und Ausland und es herrschte auf den Straßen eine fast ausgelassene Stimmung. Die Polizisten und Soldaten waren freundlich und zuvorkommend und alle zeigten sich von ihrer besten Seite. So schlimm, wie die Goldsteins es beschrieben hatten, konnte es doch nicht sein.
Am Samstag, den 1. August stiegen sie in die S-Bahn Richtung Spandau, die sie zum neuen Olympiastadion bringen sollte, wo sie mit einiger Aufregung der Eröffnungsfeier für die Olympischen Spiele entgegenfieberten.
Welch wunderbare Arena, der sie sich von der Haltestelle aus langsam näherten, durch ein langes Spalier von tausenden Hitlerjungen schreitend, die allgegenwärtigen Hakenkreuzflaggen im Hintergrund, mit ehrfürchtigem Blick auf das architektonische Gesamtkunstwerk. Diese imposanten hohen Türme, zwischen denen die olympischen Ringe aufgehängt waren, die grandiosen Skulpturen auf den Wiesen vor dem Stadion, das riesige Reichssportfeld dahinter mit den Reiterstatuen, wo die Dressur- und Springreitwettbewerbe ausgerichtet würden, und dann das Stadion selbst, das einhunderttausend Besucher fasste und dessen Stahlbauskelett mit tausenden von Werksteinplatten verkleidet worden war.
Die Feier war ein perfekt inszeniertes, riesiges Spektakel mit einer Demonstration der wirtschaftlichen Leistungskraft und des Stolzes des deutschen Volkes. Sie wurde per Rundfunk in die ganze Welt übertragen. Keiner der Besucher konnte sich ihrer Wirkung entziehen.
Als der Reichsführer Adolf Hitler mit seinem Gefolge die Treppe des Marathontors herabschritt, reckten sich unzählige rechte Arme ihm zum Gruß kerzengerade entgegen.
Die Olympische Hymne ertönte „Völker! Seid des Volkes Gäste, kommt durchs offene Tor herein!“, und es begann der Einmarsch der Nationen.
Uruguay war mit siebenunddreißig Athleten vertreten, die allerdings wenig Aussicht auf Medaillen hatten. Aber das tat der Freude Eduardos keinen Abbruch, der vor Begeisterung aufsprang und seinen Landsleuten zujubelte, als sie hinter ihrer blauweißen Fahne mit gelber Sonne in das Rund einbogen.
Ein weiterer emotionaler Höhepunkt war das Einlaufen des Staffelläufers mit der brennenden Olympischen Fackel, die zum ersten Mal in Griechenland entfacht und von dreitausendvierhundert Fackelläufern nach Berlin getragen worden war. Alle Besucher waren ergriffen von diesem Moment, als das Olympische Feuer hoch über dem Stadion entzündet wurde, als die Völkerverständigung zum Greifen nah erschien und alle sich auf das große Fest des Friedens freuten.
In den darauffolgenden Tagen besuchten Christine und Eduardo vornehmlich die Wettkämpfe, an denen uruguayische Athleten teilnahmen. Sie sahen das Basketballspiel gegen Belgien, das die Uruguayer für sich entscheiden konnten, schauten beim Boxen zu, wobei Christine des Öfteren den Blick abwenden musste, feuerten ihre Mannschaft vergeblich beim Fechten an und fuhren nach Grünau, wo die Ruderwettbewerbe auf einer eigens geschaffenen zweitausend Meter langen Regattastrecke stattfanden.
Am Ende ihres Berlinaufenthalts, den sie trotz der anfänglich entstandenen Vorbehalte doch sehr genossen hatten, waren sie überzeugt, dass die Befürchtungen der Goldsteins bezüglich der Nationalsozialisten wohl nicht eintreffen würden. Sicher würde die Regierung eine gute Lösung für alle Bürger finden, die sich gesetzestreu verhielten und einem geordneten Leben nachgingen. Die spürbare Heiterkeit in der Stadt und die ausgelassene Stimmung überall dort, wo sich viele Menschen trafen, an den Plätzen und Veranstaltungsorten, in den Kulturstätten und Bars, ließen aus ihrer Sicht keine andere Schlussfolgerung zu.
Nun war es an der Zeit, die Familie zu besuchen, und Christine hatte vor Aufregung Schmetterlinge im Bauch, als sie endlich mit Eduardo nach einer vollen Tagesreise in Rhede aus dem Zug stieg.
Dort schallte ihnen ein „Kein schöner Land in dieser Zeit, als hier das unsere weit und breit“ entgegen, das ihr Bruder Aloys angestimmt hatte, und in das seine Frau Josefine und die Kinder auf sein Zeichen hin im Kanon mit einfielen.
Christine musste sich erst einmal orientieren, um die ihr von den vielen Briefen und jährlichen Fotos geläufigen Namen der Kinder den Gesichtern zuzuordnen.
Da war Mariechen, sehr hübsch und adrett gekleidet, eine attraktive junge Dame, ohne Zweifel. Tine, ihr Patenkind, das sie in ihrer Erinnerung gerade noch bei der Taufe gehalten hatte, kurz bevor sie ausgewandert war, hatte sich zu einer hochaufgeschossenen, sehr schlanken Jugendlichen entwickelt, und strahlte sie erwartungsvoll an.
Daneben Franziska, freundlich und höflich, aber eher zurückhaltend. Sie schaute etwas unglücklich drein, denn eigentlich wäre sie lieber mit ihren Freundinnen im Pastors Busch spielen gegangen, als im besten Kleid die ihr unbekannte Tante und den merkwürdig sprechenden Onkel zu begrüßen.
Neffe Heinz war ein gutaussehender, zuvorkommender, fast schon erwachsener junger Mann, der sich stolz in der Tracht des Jungvolkführers der Hitlerjugend präsentierte - braunes Hemd mit Hakenkreuzbinde, schwarze kurze Hose, Kniestrümpfe - und sich gleich ihres Gepäcks annahm.
Sein Bruder Alois kam eher nachlässig daher. Er schien gerade noch rechtzeitig von einem wichtigen Ausflug mit seinen Kumpels herbeigeeilt zu sein, denn seine Hose war nur notdürftig vom Dreck befreit und sein Hemd ziemlich verschwitzt. Dem Tadel seiner Mutter, „Wo kommst du denn jetzt her und wie siehst du aus?“, begegnete er nur mit einem breiten Grinsen.
Jupp, der mit seinen fast sieben Jahren aussah wie ein richtiger kleiner Lausbub, gab Tante und Onkel brav die Hand und sprang danach fröhlich vor sich hin pfeifend auf dem Bahnhofsvorplatz herum.
Das kleine Hänneschen, jetzt schon vier Jahre alt, war der jüngste Spross der Familie. Er versteckte sich verlegen hinter seiner Mutter und lugte nur langsam hervor, um die neuen Gäste zu begutachten. Dabei nahm er den Daumen nicht aus dem Mund.
Luise und Klara waren in Holland in Stellung und konnten dem Begrüßungskomitee nicht beiwohnen. Klara wurde in ein paar Tagen erwartet und würde ihren kurzen Jahresurlaub mit der Familie in Rhede verbringen.
Auch Else fehlte, das unscheinbare Mittelkind. Sie wohnte schon seit ihrem zehnten Lebensjahr bei der Bauersfamilie Tetiedt in Büngern und wurde dort an Kindes statt angenommen, wie das so hieß.
Sie war das einzige Kind auf dem Hof und auch jetzt die junge Frau im Haushalt, die die fehlende Arbeitskraft des eigenen Nachwuchses ersetzte. Dies bedeutete nicht, dass sie wie das eigenen Fleisch und Blut behandelt wurde. Nein, sie wurde gut versorgt, was Essen und Trinken anging, war aber eigentlich zur Unterstützung bei den vielfältigen Arbeiten in der Küche, im Stall und draußen auf dem Feld auf den Hof geholt worden.
Als man damals vor Jahren auf Bitten des befreundeten Bauernpaares das Arrangement getroffen hatte, war die Wahl ganz natürlich auf Else gefallen. Luise und Klara waren schon aus dem Haus und trugen mit ihrem Salär zum Familieneinkommen bei. Mariechen hatte sich für Josefine als Hilfe im Haushalt unentbehrlich gemacht und würde ebenfalls in Kürze arbeiten gehen. Und so traf das Schicksal Else, die gesund und kräftig war; zudem ein Esser weniger im Haus half, alle anderen satt zu bekommen.
Else litt sehr unter der Einsamkeit auf dem Hof, die plötzlich und unerwartet in ihr bis dato unbeschwertes Leben in der Großfamilie kam, ohne Freundinnen und Spielkameraden, weit weg von den Geschwistern, aber sie ertrug auch dies ohne Aufbegehren.
Sie würde ihre Tante Christine aus dem fernen Uruguay später treffen, wenn das lange geplante Familienfest im Jugendheim stattfand, zu dem auch die anderen Onkel und Tanten sowie alle Cousinen und Vettern eingeladen waren.
Ein Stich ging Christine durchs Herz. Sie beneidete ihren Bruder und Josefine um ihre große Kinderschar. Wie gern hätte sie mindestens eine Tochter oder einen Sohn mit auf die Reise genommen und heute mit den Cousinen und Vettern bekannt gemacht. Sie betete inständig, dass sie einmal die Chance bekäme, ein Kind großzuziehen und hatte sich fest vorgenommen, am Sonntag in der Kirche mit dem lieben Gott ein ernstes Wort darüber zu reden.
Für Aloys war sein katholischer Glaube ein unverrückbarer Pfeiler des Lebens. Daran konnten auch die Nationalsozialisten nichts ändern, deren politische Ideale er mit Inbrunst teilte. Er sah auch nicht unbedingt einen Widerspruch, denn die Basis beider Ideologien waren Treu und Glauben an die Obrigkeit, ein rechtschaffenes Leben und das Einstehen für alte Werte wie Disziplin, Fleiß und Gemeinschaftssinn.
So war er Anfang des Jahres in die Partei eingetreten, hörte mit Begeisterung die Reden des Führers über das wiedererstarkte Deutschland im Radio, ging zu den Parteiversammlungen, meldete seine Kinder in der Hitlerjugend und beim Bund Deutscher Mädel an, und verschrieb sich ganz der deutschen Sache, soweit sie den allmächtigen Gott unberührt ließ. Was Hitler über die Juden verbreitete, darüber machte sich Aloys wenig Gedanken, denn er konnte die Thesen mangels täglichen Umgangs mit jüdischen Mitbürgern im erzkatholischen Rhede weder bestätigen noch widerlegen.
Nach wie vor engagierte er sich in der Kirche, ging jeden Tag früh morgens zur Messe, schmetterte am Sonntag das Kyrie Eleison im Hochamt und schickte seine Kinder nachmittags zur Andacht. Vor und nach jedem Essen wurde gebetet „Komm lieber Jesus sei unser Gast!“ und „Herr, dein Diener ist satt.“, denn ohne Gottes Segen schmeckte Aloys das Essen nicht.
Josefine teilte die Liebe ihres Mannes zum Allerhöchsten, obwohl sie die Religionserziehung und die Bibelstunden vornehmlich der Kirche und der katholischen Volksschule überließ.
Hier lernten die Kinder zum Beispiel im Fach Katechismus den Sinn der Beichte, den sie ganz pragmatisch für sich umsetzten: Nach der Aufzählung der unvermeidlichen Sünden aller Art im dunklen Beichtstuhl, wo der Pastor hinter einer Wand mehr oder weniger angestrengt lauschte oder auch schon mal schnarchte, und ein paar „Vater Unser“ und „Gegrüßet seist du Maria“, die die Absolution brachten, konnte man da weitermachen, wo man aufgehört hatte, denn es gab ja schon in der kommenden Woche die nächste Gelegenheit zur Reue.
Zudem wurde den Kindern im Kommunionunterricht beigebracht, wie man als Kommunionkind die Hände faltete und den Blick in Demut senkte, um in Zukunft das Fleisch und Blut Jesus Christus in Form einer Hostie empfangen zu dürfen, und vieles andere mehr, das einem den Weg ins Himmelreich sicherte.
Franziska war fasziniert von ihrer vornehmen Tante, die immer nur mit Hut, sorgfältig geschminkt und mit Schmuck behangen aus dem Haus ging, und von ihrem schicken Mann, der ihr im feinen Anzug den Arm anbot, wenn sie durch das Dorf flanierten.
So liefen ihre Eltern nie nebeneinander auf der Straße; sie hatten allerdings auch keine Zeit, einfach nur spazieren zu gehen. Wenn sie an Sonntagen nicht arbeiteten, waren sie meist getrennt unterwegs, Aloys beim Fußball oder beim Frühschoppen bei Essing in der Kneipe, wo er sich zwei Biere gönnte, bevor die Suppe zuhause auf ihn wartete, und Josefine ab und an nachmittags beim Kaffeeklatsch mit Nachbarinnen oder Cousinen.
Luxus gab es in ihrem Haus keinen, wenn man mal von der täglichen Zigarre nach dem Mittagessen absah, die Aloys mit Raucherstolz fast gänzlich abbrennen ließ, bevor er die Asche abstreifte.
Von Seidenwäsche für das Bett hatte Franziska noch nie gehört und wunderte sich nicht schlecht, als Tante Christine die Oberbetten mit diesen edlen, herrlich glänzenden Textilien überzog, die sie in Berlin gekauft hatte und mit nach Uruguay nehmen würde.
Aloys und Josefine hatten ihre Ehebetten für die Gäste geräumt und schliefen auf dem Sofa im Wohnzimmer unter einfachen Wolldecken, wobei beide darüber nachdachten, wie es wohl wäre, den anderen weichen Stoff auf ihrer Haut zu spüren.
Christine fühlte sich wie im siebten Himmel in ihrer alten Heimat. Sie genoss es sichtlich, von ihren vielen Verwandten umgeben zu sein und hätte ihre Lieben den ganzen Tag umarmen mögen.
Sie selbst hatte die westfälische Zurückhaltung in Sachen Körpernähe in Uruguay längst aufgegeben, wo sich alle Menschen zur Begrüßung auf die Wange küssten und auch im Gespräch so eng beieinanderstanden, dass kaum ein Blatt Papier dazwischen passte.
Sie herzte alle nach Lust und Laune, auch wenn die meisten hinterher etwas erschrocken einen Schritt zurück machten, und erzählte jedem mit leuchtenden Augen von ihrem schönen Leben im fernen Südamerika.
Die Kinder klebten an ihren Lippen und stellten sich vor, wie es wäre, als Gaucho über die Wiesen zu reiten und die Rinder übers Land zu treiben. Sie träumten davon, einmal im Leben ein ganzes Stück Fleisch für sich allein zu haben und mit Tante Christine in ihrem schicken Auto mitfahren zu dürfen.
Als Franziska ihrer Freundin Trude auf dem Weg zur Schule von ihrer extravaganten Tante erzählte, wollte die alles ganz genau wissen.
„Wie sieht sie aus?“
„Groß und stattlich, immer sehr elegant gekleidet, mit echtem Goldschmuck an den Ohren, um den Hals und am Arm.“, war die Antwort, aus der ihre Bewunderung deutlich herauszuhören war.
„Spricht sie noch Deutsch?“
„Na klar, so gut wie du und ich. Das verlernt man doch nicht.“
„Wieviel Kinder hat sie?“
„Gar keine, braucht sie auch nicht. Die hat einen ganzen Stall voll Hausmädchen unter sich, die ihr aufs Wort gehorchen müssen. Die machen morgens ihr Bett, kochen und putzen und springen um sie herum, wenn sie Gäste hat, und räumen auch die Küche hinterher wieder auf.“, erklärte Franziska.
„Toll, das hätte ich später auch gern. So ein Leben stelle ich mir klasse vor. Den ganzen Tag schicke Kleider tragen, mit den Freundinnen Kaffee trinken gehen und dann am Abend Leute einladen und sich amüsieren.“, schwärmte Trude.
„Ja, das wäre wirklich schön. Aber ich möchte dafür nicht aus Rhede weggehen müssen. Da bleib ich lieber hier. Was würde ich denn ohne dich machen?“, lachte Franziska und sie bogen auf den Schulhof ein, wo die anderen Schüler bereits dabei waren, sich in Reih und Glied aufzustellen, um wie die Pinguine klassenweise das Gebäude zu betreten.
Franziska ging gern zur Schule. Sie waren um die vierzig Mädchen in einem Jahrgang und etwa die gleiche Anzahl an Jungen, die in der Parallelklasse unterrichtet wurden. In der Pause traf man sich auf dem Schulhof, wobei die Jungen ihre Zeit hauptsächlich mit Kräftemessen und wildem Herumrennen verbrachten, während die Mädchen eher miteinander spielten.
Das Lernen fiel ihr leicht und sie hatte bald erkannt, wie man am besten ohne Probleme durchkam: Nur nicht auffallen, weder positiv noch negativ. Keiner mochte die Streber, die immer als erste aufgeregt ihre Finger in die Luft reckten, wenn der Lehrer eine Frage stellte. Und das kriegten diese dann auch später auf dem Pausenhof zu spüren, wenn plötzlich die Hinkelgruppen und Seilspringteams alle komplett waren und sie nicht mitmachen durften.
Auf der anderen Seite gab es die mutigen, frechen Schüler, die schon mal Widerworte gaben oder geheime Zettel durch die Klasse schickten. Sie wurden regelmäßig von den strengen Lehrern nach vorn beordert, die kein Vergehen durchgehen ließen, um sich einen oder mehrere Schläge mit dem Rohrstock abzuholen oder stundenlang mit hochroten Ohren in der Ecke zu stehen. Darauf hatte Franziska nun wirklich keine Lust.
Sie liebte ihre junge Turn- und Handarbeitslehrerin Irmgard Danilov, von den Kindern in ihrer Geheimsprache, in der die wichtigsten Worte von hinten nach vorn buchstabiert wurden, Dragmri Volinard genannt, die so bewundernswert burschikos und unkonventionell war. Sie fuhr Motorrad und wurde nach der Schule häufig von schicken Männern in Lederjacken abgeholt.
Sie brachte allen Kindern der Klasse das Schwimmen bei. Dazu besorgte sie für Schüler, die keines hatten, ein Fahrrad, und dann fuhren sie gemeinsam hintereinander aufgereiht die zwei Kilometer nach Krechting, wo sie ihnen im Naturfreibad an der Aa Schwimmunterricht gab, bis alle mehr oder minder hektisch paddelnd nicht mehr untergingen.
Auch organisierte sie einmal einen Filmbesuch im Kino, an dem alle Mädchen ihrer Klasse teilnahmen, nur Franziska durfte nicht. Ihre Mutter teilte ihr unumwunden und ohne Mitleid mit, für so einen Quatsch hätten sie kein Geld, die fünfzig Pfennig Beitrag seien einfach zu teuer. An diesem Abend weinte Franziska heimlich in ihr Kissen und wünschte sich, dass ihr Vater Apotheker wäre oder wenigstens Milchbauer.
Zuhause verhielt sich Franziska nach der gleichen erfolgreich getesteten Maxime: Nur nicht auffallen. Das brachte ihr die besten Chancen, bei der Aufgabenverteilung im Haushalt möglichst übersehen zu werden und direkt nach Erledigung der Schulaufgaben wie der Wind hinterm Haus verschwinden zu können.
Sie verbrachte ihre Nachmittage mit ihren Freundinnen auf dem Sportplatz oder im Pastors Busch, wo sie stundenlang Räuber und Gendarm, Verstecken, und „Ich sehe was, was du nicht siehst“ spielten oder was ihnen sonst noch einfiel.
Die elterliche Anordnung war, dass sie spätestens um neunzehn Uhr zum Abendbrot erscheinen musste, was sie regelmäßig um mindestens fünf Minuten verpasste, denn sie wartete, bis sie die Kirchenglocken siebenmal schlagen hörte, bevor sie durch die Nachbarsgärten nach Hause rannte.
Dann begrüßte sie ihr Vater meist augenzwinkernd.
„Na Zikus. Hast du den Tag mal wieder bis zur letzten Minute ausgekostet?“
Ihre Mutter murrte gelegentlich.
„Kannst dich ruhig mal mehr anstrengen hier zuhause. Eigentlich solltest du den Tisch zu decken, aber du warst ja mal wieder nicht zu finden. Du bist unser Kostgänger. Wir sehen dich hier nur zu den Mahlzeiten.“
Aber das war Franziska gerade recht. Jede Minute in Freiheit zählte.
Klara war gerade mit dem Zug aus Holland gekommen.
Christine war verblüfft, wie ähnlich sie ihr sah, als sie selbst noch zwanzig Jahre jünger war. Nicht nur hatten sie das gleiche runde Gesicht und mittelblonde Locken, auch die Größe und Körperhaltung waren fast identisch.
Klara hatte eine gewisse Ausstrahlung und wirkte im Zusammenwirken mit ihren Geschwistern reichlich dominant. Gleich gab es kleine Reibereien, nur ihre Schwester Tine wechselte ihr unerschrocken die Worte.
Christine beobachtete, wie Aloys Klara beiseite nahm und sie nach ihrem Geld fragte. Er musste mal wieder Leder kaufen und brauchte den Verdienst seiner Tochter dringend. Sie gab ihm, was er verlangte, denn es war von vornherein klar gewesen, dass sie einen erheblichen Beitrag zum Familieneinkommen würde leisten müssen. Sie hielt auch nichts für die Aussteuer zurück, weil ihre Arbeitgeberin sich äußerst großzügig gab und sie bereits mit dem Nötigsten ausgestattet hatte.
Da hatte es Luise, die leider nicht für den Besuch ihrer Tante frei bekommen hatte, schlechter getroffen. Auch sie musste den allergrößten Teil ihres Salärs aus Holland an ihren Vater schicken und tat sich schwer, ihre Truhe mit Wäsche und Geschirr zu füllen, obwohl sie bereits konkrete Heiratsabsichten hatte. Seit drei Jahren ging sie mit Johann aus, den sie auf einer Tanzveranstaltung in Bocholt kennengelernt hatte, und mit dem sie sehnlichst darauf hinarbeitete, das notwendige Startkapital zusammenzusparen.
Klara dachte noch nicht ans Heiraten. Sie arbeitete gern in Holland, wo sie bei einer Diplomaten-Familie angestellt war, die bereits große Kinder hatte und mit ihrer willigen Unterstützung im Haushalt sehr zufrieden war.
Sie war gleich Feuer und Flamme gewesen, damals, als der Brief ihrer Cousinen Resi und Mimi ankam, die schon einige Zeit in Holland beschäftigt waren. Sie berichteten, dass sie dort dreißig Gulden im Monat verdienten. Das war eine Menge Geld, ein Vielfaches dessen, was man in einer deutschen Fabrik erzielen konnte.
Bloß raus aus diesem Haus mit den vielen Bälgern und rein ins Abenteuer, dachte sich Klara. Kurz darauf waren sie und Luise auf dem Weg ins Nachbarland.
In Den Haag schloss sich Klara gleich dem Deutschen Verein an, wo eine ganze Horde junger Frauen ihres Alters regelmäßig zusammenkam. Heimweh kam bei ihr erst gar nicht auf.
Sie war geschickt im Umgang mit ihrer Dienstherrin, die sie schon bald ins Herz schloss und begeistert war, dass sie bereits nach zwei Tagen die holländische Zeitung lesen konnte. Aber mit Plattdeutsch als erster Sprache zuhause fiel ihr die Umstellung leicht.
Klara hatte ihren kleinen Brüdern einen Roller mit Luftreifen mitgebracht. Das war vielleicht eine Sensation. Mit dem konnte man so schnell fahren wie der Blitz. Kein Vergleich mit den Holzrollern, die sie bisher kannten.
Stolz zeigten sie ihr neues Gefährt all ihren Freunden, die vor Neid erblassten. Sie spielten Krieg im Pastors Busch mit einfachen Soldaten und Offizieren, die Anweisungen gaben, und einem Kradfahrer, in ihrem Falle auf einem Luftreifenroller unterwegs, der Meldungen von einer Gruppe zur nächsten transportierte. Das wurde für die nächsten Wochen die mit Abstand beliebteste Rolle!
Christine ging zu ihrem Bruder in die Werkstatt. Dort hatte sich nicht viel verändert in den letzten Jahren.
Sie sog den Geruch des frischen Leders ein und lachte über den langen Holzbalken auf zwei Böcken, der mit Nägeln gespickt war, die die Kinder zum Zeitvertreib und zum Erlernen des Umgangs mit dem Hammer einschlagen durften. Ein Magnet war die neueste Errungenschaft, mit ihm konnte man die kleinen Nägel einsammeln, die sich abends auf dem Boden wiederfanden. Das Regal an der Rückwand war voll von Leisten unterschiedlicher Größe und penibler Beschriftung bezüglich der Kunden, zu denen sie gehörten.
Aloys war gerade dabei, ein paar Schuhe neu zu besohlen und schlug mit geübten Bewegungen in schneller Reihenfolge kleine Nägel, die er zwischen seinen Zähnen hielt, in die Unterseite.
„Na, wie geht es dir?“, fragte Christine, ohne auf eine Antwort zu warten. „Josefine sieht nicht sehr glücklich aus. Ihr hättet wirklich nicht die Betten für uns räumen müssen.“
„Uns geht es gut. Mach dir da mal keine Sorgen. So lange der Herrgott auf uns aufpasst, kann uns nichts passieren. Josefine ist überarbeitet. Der ganze Haushalt und die vielen Kinder, das ist schon anstrengend. Das bleibt nicht einfach in den Klamotten hängen“, sagte Aloys mit einem belehrenden Ton in der Stimme.
Dann fügte er nachdenklich hinzu,
„Sie ist eine gute Frau. Sie tut, was sie kann, auch wenn sie öfters zu streng ist. Kürzlich hat sie Franziska so verdroschen, dass ich Angst bekommen habe, nur, weil die Kleine abends nicht schnell genug ins Bett gegangen ist, als Willi aus Westerholt hier war und so schön und lustig erzählt hat. Da sind die Gäule mit Josefine durchgegangen.“
„Apropos Franziska.“, hakte Christine ein. „Sie ist ein wirklich nettes Mädchen und ich mag sie sehr. Du weißt, bei uns klappt es bisher nicht mit dem Kinderkriegen, und ich hätte so gern ein Mädchen. Meinst du, sie könnte mit mir nach Uruguay gehen und bei mir leben. Ich verspreche dir, ich würde sie lieben und versorgen wie ein eigenes Kind. Du hast doch noch so viele andere und einen Kostverwerter weniger, das wäre doch auch für euch nicht so schlecht.“
Aloys dachte nur sehr kurz nach.
„Das lass mal stecken, Christine. So weit weg gebe ich unseren Zikus nicht. Dann würden wir sie ja auf Jahre nicht wiedersehen, und sie wäre erst einmal ziemlich traurig in dem fremden Land. Das kannst du allein auch nicht wettmachen, und wenn du dich noch so anstrengst.“
„Na ja, war ja nur so ein Gedanke.“, lenkte Christine gleich verlegen ein und sprach das Thema nie wieder an.
Nach zwei Wochen intensiver Familienzeit und ausgiebigen Treffen mit allen Leuten, die sie in der Gegend noch so kannte, hieß es Abschied nehmen für Christine.
Eduardo hatte sich wacker an ihrer Seite geschlagen, obwohl er nun müde wirkte nach all der Anstrengung mit den vielen neuen Gesichtern, dem unablässigen Geräuschpegel um sich herum und dem ständigen Versuch, der deutschen Sprache ihre schwierige Grammatik abzuringen. Er sehnte sich nach Ruhe auf seiner Farm und seufzte erleichtert, als sie endlich im Zug saßen, der sie auf den Weg nach Hause bringen sollte.
Christine hatte noch Tränen in den Augen und kämpfte mit ihren Emotionen, die sie am Bahnhof übermannt hatten. Sie ahnte nicht, dass es fünfunddreißig Jahre dauern würde, bis sie wieder heimischen Boden betreten konnte, und dass sie soeben ihren Bruder das letzte Mal in ihrem Leben in den Arm genommen hatte.