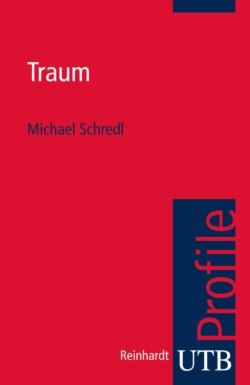Читать книгу Traum - Michael Schredl - Страница 9
Оглавление2
Traumerinnerung
Trotz der Tatsache, dass wahrscheinlich während des gesamten Schlafes geträumt wird, ist die Erinnerung an das nächtliche Geschehen sehr variabel. Es gibt Personen, die fast jeden Morgen etwas berichten können, und andere behaupten, sie träumen (bzw. erinnern sich) nie.
Zunächst werden die theoretischen Ansätze vorgestellt, die die Unterschiede in der Traumerinnerung erklären sollen, im Anschluss daran die Messmethoden und die mannigfaltigen Studien auf diesem Gebiet. Schließlich erfolgt eine Bewertung des bisherigen Forschungsstandes und ein Ausblick auf die Fragen, die noch zu beantworten sind.
Erklärungsmodelle
Seit Sigmund Freud wurden immer wieder neue Erklärungsansätze hinsichtlich der Traumerinnerung formuliert.
• Verdrängungshypothese (Freud, 1900)
• Life-Style-Hypothese (Schonbar, 1965)
• Interferenz-Hypothese (Cohen / Wolfe, 1973)
• Salience-Hypothese (Cohen / MacNeilage, 1974)
• Arousal-Retrieval-Modell (Koulack / Goodenough, 1976)
• Zustands-Wechsel-Modell (Koukkou / Lehmann, 1980)
Freuds Verdrängungshypothese (Freud 1900) besagt, dass der Traum als Ganzes verdrängt (d.h. nicht erinnert wird), wenn er seine Aufgabe der „Veränderung“ (Traumarbeit in der Terminologie von Freud) nicht wahrgenommen hat. Die Traumarbeit verhindert, dass unbewusste Triebimpulse ins Wachbewusstsein dringen können. Hier sei gleich angemerkt, dass bei diesem wie auch bei den anderen Ansätzen eine direkte Prüfung im Experiment nicht möglich ist, da der nicht erinnerte Traum nicht zugänglich ist. Die Frage, ob er sich tatsächlich von den erinnerten Träumen unterscheidet, muss immer unbeantwortet bleiben.
14
Die Life-Style-Hypothese von Schonbar (1965) besagt, dass eine gute Traumerinnerung Teil eines Lebensstils ist. Personen, die kreativ, introvertiert sind, inneren Prozessen viel Aufmerksamkeit schenken, erinnern sich auch häufiger an Träume. Dieser Ansatz erklärt allerdings kaum, warum diese Personen sich im Prozess des Aufwachens besser an ihre Träume erinnern sollen als andere.
Diesbezüglich ist die Interferenz-Hypothese von Cohen und Wolfe (1973) schon spezifischer. Unter Berufung auf die klassische Gedächtnistheorie wird hier postuliert, dass der Traum dann besser erinnert wird, wenn möglichst wenig Störungen zwischen dem Aufwachen und dem Berichten des Traumes liegen.
Auch die Salience-Hypothese (Cohen / MacNeilage 1974) geht auf die klassische Gedächtnistheorie zurück. Das Wort „Salience“ kann mit „Bedeutung“ oder „Wichtigkeit“ übersetzt werden. Je salienter ein Traum, desto besser wird er erinnert. Auch hier gilt jedoch, dass die direkte Prüfung – wie es bei Gedächtnisaufgaben im Wachzustand ein Leichtes ist – nicht möglich ist. Der Ausgangspunkt (alle Träume) bleibt verborgen, nur die erinnerten Träume sind zugänglich.
Etwas komplexer ist das Arousal-Retrieval-Modell von Koulack und Goodenough (1976). Es werden zwei Schritte angenommen, die zu einer erfolgreichen Traumerinnerung führen. Zunächst muss ein gewisser Wachheitsgrad vorliegen, d.h., die Person muss während des Traums oder unmittelbar danach aufwachen, zumindest für kurze Zeit, weil der Traum sonst nicht im Gedächtnis gespeichert wird. Im zweiten Schritt wird der Traum aus dem Zwischenspeicher dann komplett erinnert, wenn er besonders wichtig war und wenig Störeinflüsse vorhanden sind. Auch die Verdrängungshypothese wurde mit aufgenommen, besonders intensive und „verdrängungswürdige“ Träume werden nach diesem Denkansatz auch schlecht erinnert.
Als Grundlage des Zustands-Wechsel-Modells (Koukkou/Lehmann 1980) dient ein Modell des Gehirns bzw. Bewusstseins, das verschiedene funktionelle Zustände mit zugehörigen Gedächtnisspeichern vorsieht. Die Zustände mit hoher Aktivierung („Wach“) können nur bedingt auf die Gedächtnisspeicher der niedrigeren Zustände („Schlaf“) zugreifen, während es umgekehrt keine Probleme gibt. Das würde bedeuten, dass Träume aus besonders aktiviertem Schlaf besser erinnert werden.
15
Messmethoden der Traumerinnerungshäufigkeit
Um die empirischen Studien adäquat bewerten zu können, ist es wichtig, sich mit den Messmethoden sowie deren Vor- und Nachteilen auseinanderzusetzen. Im Wesentlichen kommen drei verschiedene Ansätze zum Zuge: Fragebogenskalen, Schlaf- bzw. Traumtagebücher, Schlaflaborweckungen.
Die Vorgabe einer Fragebogenskala eignet sich vor allem für die Untersuchung großer Stichproben. Dabei werden sehr unterschiedliche Formate angewendet. So wurde z. B. bei einer Studie die Frage gestellt, ob man sich am Morgen dieses Tages an einen Traum erinnert hat, oder in einer anderen Studie nach der Zahl der Träume in den letzten vier Wochen gefragt. Mittlerweile haben sich dabei sogenannte Rating-Skalen bewährt, die in zwei Gruppen unterteilt werden. Die Antwortkategorien auf die Frage „Konnten Sie sich in der letzten Zeit an Ihre Träume erinnern?“ bestehen aus „nie“, „selten“, „manchmal“, „oft“ und „sehr oft“. Beim zweiten Skalentyp sind dagegen in der Skala explizit Häufigkeiten angeben, da es durchaus nicht der Fall sein muss, dass jede Person unter „selten“ oder „manchmal“ dieselbe Häufigkeit versteht:
| Wie häufig erinnern Sie sich in der letzten Zeit (einige Monate) an Ihre Träume? | |
|---|---|
| O | fast jeden Morgen |
| O | mehrmals pro Woche |
| O | etwa einmal pro Woche |
| O | 2 bis 3mal im Monat |
| O | etwa einmal im Monat |
| O | weniger als einmal im Monat |
| O | gar nicht |
Obwohl die ↑ Korrelation zwischen diesen beiden Skalen sehr groß ist (r = .647, N = 444; Schredl et al. 2003a) zeigten die Studien doch, dass die Retest-Reliabilität (↑ Reliabilität) als Maß für die Messgenauigkeit bei den Skalen mit absoluten Kategorien (obiges Beispiel) höher ist (r = .85, N = 198, 55 Tage; Schredl 2004), während eine Skala mit relativen Kategorien nur einen Wert von r = .56 (Bernstein / Belicki 1995-96) lieferte. Das Hauptproblem bei der Anwendung solcher Skalen stellt die Fähigkeit der Probanden dar, sich retrospektive daran erinnern zu können, 16ob sie sich morgens nach dem Aufwachen an einen Traum erinnert haben. Die hohe Retest-Reliabilität lässt darauf schließen, dass trotzdem eine relativ genaue Schätzung möglich ist, da bei wiederholter Messung ähnliche Ergebnisse erzielt werden. Diese Befunde sprechen auch für stabile Unterschiede in der Traumerinnerung zwischen Personen.
Bei der Tagebuchtechnik wird die Versuchsperson gebeten, jeden Morgen anzugeben, ob sie sich an mindestens einen Traum der Nacht erinnern kann. Dazu werden ebenfalls zwei verschiedene Formate verwendet: Zum einen sind das Checklisten, in die nur eingetragen werden muss, ob ein oder mehrere Träume erinnert wurden. Bei der anderen Technik wird die Person gebeten, den Trauminhalt aufzuschreiben. Der zweite Ansatz erhöht den Aufwand für die Versuchspersonen, vor allem für die Vielträumer, erheblich, sodass es nicht verwunderlich ist, wenn die Traumerinnerung nach einer Woche Tagebuchführen schon etwas absinkt, ein Befund, der sich bei dem Führen von Checklisten nicht zeigt (Schredl / Fulda 2005a). Obwohl die Korrelation zwischen Tagebuchmaß und Fragebogenskala mittelhoch ist (r = .562, N = 444, Schredl et al. 2003a), zeigen sehr viele Studien, dass – vor allem bei Personen mit niedriger Traumerinnerung zu Beginn der Studie – die Traumerinnerung durch die bewusste Aufmerksamkeitslenkung drastisch zunehmen kann (Schredl 2002). Durch die Tagebuchtechnik wird also zwar der Fehler, der durch Rückerinnerung entsteht, minimiert, aber durch die Lenkung der Aufmerksamkeit auf das Träumen die Traumerinnerung erhöht.
Ganz besonders deutlich wird dies bei Traumweckungen im Schlaflabor. Bei gezielten Weckungen aus dem ↑ REM-Schlaf liegt die Berichtsrate bei über 80 % (Nielsen 2000), sodass bei vier oder fünf Weckungen pro Nacht sehr viel Material zusammenkommt. Trotz dieser dramatischen Steigerung durch Schlaflaborweckungen ist es so, dass Personen, die zu Hause wenig Träume berichten, auch im Labor weniger erinnern als die Hocherinnerer (46 % vs. 93 %; Goodenough et al. 1959).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zusammenhänge zwischen den unterschiedlichen Erhebungsmethoden hinsichtlich der Traumerinnerung, zufrieden stellend sind und sich die Ergebnisse verschiedener Studien miteinander vergleichen lassen.
17
Einflussfaktoren
Es wurden sehr viele Studien durchgeführt, die untersucht haben, mit welchen Faktoren die Traumerinnerung zusammenhängt. Um die Darstellung etwas zu vereinfachen, wurden die Faktoren in zwei Gruppen eingeteilt: State-Faktoren und Trait-Faktoren.
Definition
State-Faktoren sind kurzfristig wirksame Einflüsse, wie z. B. Stress am Vortag oder nächtliches Erwachen, die vor allem für die Schwankungen der Traumerinnerung bei einer Person verantwortlich sein können, während Trait-Faktoren über die Zeit stabiler sind und Unterschiede zwischen verschiedenen Personen erklären können.
Die wichtigsten Trait-Faktoren sind:
• Soziodemographische Variablen (Geschlecht, Alter, sozioökonomischer Status)
• Genetische Faktoren
• Persönlichkeitsfaktoren (Verdrängung, Neurotizismus, Ängstlichkeit, Introversion, Hypnotisierbarkeit, Absorption, „dünne“ Grenzen)
• Kognitive Faktoren (Intelligenz, Gedächtnis, Phantasie, Kreativität)
• Schlafverhalten
• Einstellung zu Träumen
Eine eigene Metaanalyse, die über 150 Studien von 1889 bis heute einschließt und aktuell in Arbeit ist, zeigt, dass sich Frauen im Schnitt häufiger an ihre Träume erinnern als Männer. Beim Alter zeigen Querschnittsstudien eine Abnahme der Traumerinnerung mit dem Alter, beginnend mit dem 30. Lebensjahr (z.B. Giambra / Jung / Grodsky 1996). Echte Längsschnittstudien, die Personen über 10 oder 20 Jahre verfolgen, wurden zu diesem Thema jedoch noch nicht durchgeführt. Der Literaturüberblick von Schredl und Montasser (1996–97) erbrachte folgendes Ergebnisse hinsichtlich des sozioökonomischen Status: Es liegen zwei Studien vor, die zeigten, dass Personen aus höheren Schichten eine höhere Traumerinnerung aufweisen.
Ein genetischer Einfluss für die Traumerinnerung konnte in zwei Zwillingsstudien nicht nachgewiesen werden. Am häufigsten wurde der Zusammenhang zwischen der ↑ Persönlichkeitsdimension „Verdrängung“ 18und der Traumerinnerung untersucht. Das Bild ist jedoch uneinheitlich, die groß angelegten Studien zeigten keinen signifikanten Effekt. Auch für die Dimensionen „Neurotizismus“, „Ängstlichkeit“ und „Introversion“ waren keine eindeutig positiven Zusammenhänge zu berichten. Vielversprechender waren Eigenschaften, die mit der Dimension „Offenheit für Erfahrungen“ in Verbindung stehen, wie zum Beispiel „Absorption“ und „Dünne Grenzen“. Allerdings konnte eine kürzlich durchgeführte Studie (Schredl et al. 2003a) zwar Zusammenhänge nachweisen, diese waren jedoch sehr klein: Varianzaufklärung (↑ Varianz je Faktor unter 5 %).
Die allgemeine Intelligenz zeigte keinen Einfluss auf die Fähigkeit, sich an Träume zu erinnern. Bei älteren Menschen war – wegen der bildhaften Qualität der Träume wie erwartet – das visuelle Gedächtnis von Bedeutung, nicht jedoch bei jungen Erwachsen. Dies führte zu der Vorstellung, dass kognitive Faktoren nur dann wirksam werden, wenn sie einen bestimmten Grenzwert unterschreiten. Diese Annahme wird auch gestützt durch die Befunde, dass Patienten mit einer demenziellen Erkrankung sich seltener an Träume erinnern (Kramer et al. 1975). Viele Studien belegen, dass kreative Personen mit viel Phantasie und Tagträumen sich auch besser an ihre Nachtträume erinnern können (z. B. Schredl 1995b). Allerdings war der Zusammenhang in der Untersuchung von Schredl et al. (2003a) zwar statistisch bedeutsam, aber sehr schwach ausgeprägt.
Eine schlechte Schlafqualität und das damit verbundene häufigere Erwachen in der Nacht gehen mit einer erhöhten Traumerinnerung einher. Das klingt plausibel, da die Chance, sich an einen Traum zu erinnern, zunimmt, wenn man häufiger erwacht. Die gewohnheitsmäßige Schlafdauer scheint nur einen sehr schwachen Einfluss auf die Traumerinnerung zu haben.
Die positive Einstellung zu Träumen zeigte in vielen Studien einen deutlichen Zusammenhang mit der Traumerinnerung (Hill et al. 1997). Schredl et al. (2003a) konnten jedoch nachweisen, dass dem vor allem ein methodisches Problem der verwendeten Skalen zur Messung der Einstellung zu Träumen zugrunde lag. Viele Skalen erfassten z.B. die Häufigkeit, mit der über Träume nachgedacht wurde. Es liegt auf der Hand, dass das entsprechende Ergebnis stark mit der Traumerinnerungshäufigkeit korreliert. Verwendet man jedoch Aussagen wie „Ich finde es gut, sich mit Träumen zu beschäftigen“, so sind die Korrelationen zur Traumerinnerungshäufigkeit viel schwächer ausgeprägt.
19
Die wichtigsten State-Faktoren sind:
• Vortag, Stress
• Therapie
• Schlafdauer/nächtliches Erwachen
• Aktiviertheit im Schlaf
• Störungen im Aufwachprozess
• Psychische Erkrankungen
• Ausfälle im bestimmten Gehirnarealen
Stress führt hinsichtlich des Geschlechts zu unterschiedlichen Ergebnissen: Zunahme der Traumerinnerung bei Frauen und eine Abnahme der Traumerinnerung bei Männern (Armitage 1992). Wenn die Personen selbst nach Erklärungen für Phasen mit gesteigerter Traumerinnerung gefragt werden, sind Stress und belastende Lebensereignisse die Hauptgründe (sowohl für Männer als auch für Frauen).
Patienten, die sich einer Psychotherapie unterziehen, vor allem einer psychoanalytisch orientierten, berichten über eine deutliche Zunahme der Traumerinnerung (Schredl et al. 2000). Selbst die Teilnahme an einer Traumstudie führt zu einer verbesserten Traumerinnerung (Redfering /Keller 1974b).
In vielen Studien zeigte sich kein Einfluss der gewohnheitsmäßigen Schlafdauer auf die Traumerinnerung, aber Schwankungen der Schlafdauer bei einer Person verändern auch die Chance, sich an einen Traum zu erinnern; eine Stunde länger schlafen erhöhte die Chance an eine Traumerinnerung um 20 % (Schredl / Fulda 2005b). Auch das nächtliche Erwachen wirkte sich fördernd auf die Traumerinnerung aus.
Während in der ursprünglichen Laborstudie von Cohen und Wolfe (1973) Störeinflüsse einen negativen Effekt auf die Traumerinnerung hatten (die Versuchspersonen mussten den Wetterdienst anrufen), zeigte sich bei der Tagebuchstudie von Schredl (1995a) kein Effekt von Störungen auf die Traumerinnerung im normalen Alltag.
Die Studien, in denen die physiologische Aktiviertheit (gemessen mittels ↑ EEG-Maßen oder autonomen Parametern wie Herzschlag etc.) mit der Traumerinnerung in Verbindung gesetzt wurde, lieferten keinen eindeutigen Beleg für einen Zusammenhang (Schredl 1999). Einen deutlichen Einfluss auf die Traumerinnerung hat jedoch das Vorliegen einer Depression; die betreffenden Patienten erinnern sich seltener an Träume als Gesunde (Schredl 1995c). Bei anderen Erkrankungen wie 20Angst- oder Essstörungen zeichneten sich kaum Unterschiede ab (Schredl / Engelhardt 2001).
Aufschlussreich waren die Untersuchungen an Patienten mit Hirnverletzungen. Vor allem bei Schädigungen von Hirnarealen, die mit der visuellen Vorstellungskraft zu tun haben, kam es subjektiv zu einem Traumverlust, d.h., die Patienten konnten keine Träume mehr erinnern (Solms 1997).
Bewertung und Ausblick
Angesichts der Fülle der Befunde ist eine Bewertung der Theorien nicht einfach. Eine groß angelegte Studie (Schredl et al. 2003a) hat den gleichzeitigen Einfluss von mehreren Faktoren untersucht. Insgesamt haben Schlafverhalten (Häufigkeit des nächtlichen Erwachens), Kreativität, Persönlichkeit (Offenheit für Erfahrungen) und die Einstellung zu Träumen nur 8,5 % der Gesamtvarianz der Traumerinnerung erklärt. Das bedeutet, dass über 90 % der Unterschiede unerklärt blieben. Dazu kommt der Befund, dass schon einfache Ermunterungen die Traumerinnerung dramatisch steigern können (Halliday 1992), sodass stabile Faktoren nicht viel Erklärung bieten.
Insgesamt sprechen die Befunde für das Arousal-Retrieval-Modell von Koulack und Goodenough (1976). So spielt das nächtliche Erwachen in vielen Studien eine Rolle. Auch die Persönlichkeitsfaktoren, die Kreativität, die Einstellung zu Träumen und der Einfluss von Stress lassen sich in dieses Modell integrieren, sodass die Salience-Hypothese und die Life-Style-Hypothese mitenthalten sind. Für die Verdrängungshypothese und die Interferenzhypothese ist die Befundlage sehr schwach. Auch für das komplexe Zustands-Wechsel-Modell (Koukkou /Lehmann 1980) liegen keine gesicherten Erkenntnisse vor. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass sich die Aktivität des Gehirns schlecht mit nur einer Dimension beschreiben lässt, vielmehr sind es unterschiedliche Muster von Aktivierungen, die beispielsweise Schlaf vom Wachzustand unterscheiden.
Letztendlich bleibt die Frage, welche Faktoren während des Aufwachvorgangs für eine erfolgreiche Traumerinnerung verantwortlich sind, unbeantwortet. Spannend sind hierzu die Befunde, dass nach dem Aufwachen das Gehirn bis zu 15 Minuten braucht, um „hochzufahren“, d.h., dass bestimmte Leistungen wie Reaktionsgeschwindigkeit, aber auch das Gedächtnis nicht gleich auf Hochtouren laufen. Im englischen 21Sprachraum wird das „sleep inertia“ genannt (Tassi/Muzet 2000). Es wäre interessant, zu prüfen, ob dieser Sleep-Inertia-Effekt etwas mit der Traumerinnerung zu tun hat. In Zukunft werden bildgebende Verfahren wie die Kernspintomographie aufklären können, welche Gehirnareale bei einer erfolgreichen Traumerinnerung aktiviert sein müssen.