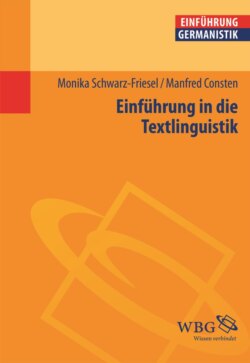Читать книгу Einführung in die Textlinguistik - Monika Schwarz-Friesel - Страница 6
1. Einleitung:
Zur Relevanz von Texten und Textanalysen
ОглавлениеTexte begleiten und prägen unser gesamtes Leben. Es vergeht kaum ein Tag, an dem wir nicht wenigstens einen Text gelesen oder geschrieben haben. Wir erhalten und versenden E-Mails oder SMS, lesen eine Zeitung oder Artikel im Internet, sehen Werbeplakate, Formulare, Informationszettel, schmökern in Büchern, konzentrieren uns auf wissenschaftliche Aufsätze oder suchen Informationen in Enzyklopädien. Wir zitieren Stellen aus Texten, die wir gelesen haben, erinnern uns an Kinderlieder und rezitieren Gedichte, berichten anderen von Romanen, die wir gerade lesen, verfassen Briefe oder Einkaufszettel, Protokolle oder Rechnungen, Hausarbeiten oder Tagebucheinträge. Texte informieren uns über die Welt, geben Gedanken und Meinungen an andere weiter, legen Gesetze und Normen fest, geben Anleitungen, halten historisches Wissen fest. Manche der vielen Texte, die uns täglich begegnen, schauen wir nur flüchtig an, zum Teil registrieren wir sie kaum, andere dagegen werden sehr sorgfältig studiert und sogar analysiert. Ein Kochrezept wie (1)
(1) Zutaten für die Scones
Für 16 Stück braucht man: 500 g Mehl, ¾–1 Päckchen Backpulver, 1 TL Salz, 80 g Zucker, 100 g weiche Butter, 1 Ei und etwa 50 ml Milch. Mehl, Zucker und Backpulver gut mischen, die weiche Butter in Fleckchen hineingeben und mit einem Messer oder einer Gabel gut vermischen, bis eine krümelige Konsistenz entsteht.
verlangt von uns wenig Fantasie, wir vermuten keinen tieferen Sinn dahinter, sondern benutzen es, um eine alltägliche Handlung nachzuvollziehen. Ein Gedicht wie (2) dagegen versuchen wir zu interpretieren, d.h. einen Sinn darin zu erkennen, es weckt unsere Neugier und verlangt eine geistige Auseinandersetzung mit dem Text.
(2) das schwarze geheimnis
ist hier
hier ist
das schwarze geheimnis
(Eugen Gomringer, das schwarze geheimnis)
Wir finden Texte langweilig oder spannend, informativ oder nichtssagend, schwer oder leicht verständlich, zusammenhängend und gut strukturiert oder konfus und inkohärent.
Es gibt Texte, die einen tiefen Eindruck bei uns hinterlassen, die unter Umständen unser gesamtes Leben beeinflussen. Ein Abschieds- oder Trennungsbrief kann Verzweiflung und Kummer auslösen, ein Liebesgedicht Glück und Freude, eine Urkunde be- und festlegen, dass wir eine bestimmte Ausbildung absolviert haben oder dass wir in einer festen Anstellung sind. Ein bestimmter Roman kann eine neue Erlebensdimension in uns aktivieren, uns geistig und emotional stimulieren, ein Sachbuch völlig neue Erkenntnisse vermitteln.
Es gehört allgemein zu den Eigenschaften sprachlicher Äußerungen, dass sie einerseits der Informationsvermittlung dienen, andererseits auch der Etablierung und Steuerung von sozialen Beziehungen. Mit Texten fordern wir andere zu etwas auf, entschuldigen wir uns, beleidigen andere, machen glücklich, wiegeln wir auf. Texte können einen neuen gesellschaftlichen Zustand schaffen, z.B. zwischen zwei Menschen das Ja-Wort auf dem Standesamt oder eine Kriegserklärung zwischen zwei Staaten.
Realität
Texte bilden also nicht nur Realität ab, sie erzeugen auch Realitäten. Nicht nur fiktive Texte erzeugen bestimmte Welten, auch politische, ideologische Texte können die Welt auf eine bestimmte Weise zeigen. Ein Text kann den Blick auf die Welt in bestimmter Weise lenken und Wirklichkeiten oder Bewertungssysteme erzeugen. Ein Text wie (3) vermittelt die fremdenfeindliche Bewertung, man müsse vor Ausländern Angst haben:
(3) „Gegen den Willen des deutschen Volkes […] wurden von Großkapital, Regierung und Gewerkschaften Millionen von Ausländern nach Deutschland eingeschleust. Durch massenhafte Einbürgerungen wird das deutsche Staatsbürgerrecht aufgeweicht und das Existenzrecht des deutschen Volkes in Frage gestellt“ (Punkt 10 des Parteiprogramms der NPD, www.npd.de, 04.06.2010)
Ein Werbetext wie Liebe ist, wenn es Landliebe ist zu Bildern einer glücklichen Familie suggeriert zwischen den Zeilen die Bewertung, dass gute Eltern ihren Kindern bestimmte Milchprodukte kaufen. Solche implizit vermittelten Informationen, sogenannte Implikaturen, spielen oft eine wichtigere Rolle als die tatsächlich ausgedrückten, wörtlich vermittelten Informationen.
kollektives Gedächtnis
In Texten spiegelt sich das kulturelle Wissen ganzer Gesellschaften wider, sie sind Teil des kollektiven Gedächtnisses und konservieren Kenntnisse unserer Vergangenheit. Die Thora, die Bibel und der Koran sind die Basis der großen Weltreligionen. Durch Texte werden Normen kodifiziert, Werte tradiert und Kulturinhalte vermittelt. Der Literat und Philosoph Johann Gottfried Herder hat daher erklärt, dass der Mensch seine Wahrnehmungsmerkmale in „Zeichen“ fasst, mit denen er sich die Welt erklärt und „Merkworte ins Buch seiner Herrschaft“ einträgt (zit. n. Hartmann 2000: 83).
Texte legen Gesetzgebungen von Gesellschaften fest, steuern, initiieren und begleiten politische (Entscheidungs-)Prozesse, massenmediale Texte können Meinungen bilden und manipulieren. Politische Kämpfe sind oft Kämpfe um die Definitionshoheit über Wörter, wie sozial, Freiheit und demokratisch. Ein Satz wie Die Juden sind unser Unglück (Heinrich Gotthardt von Treitschke, 1879: 575) spaltet eine Bevölkerung in zwei Gruppen und vermittelt damit zugleich ein Bedrohungspotenzial und Feindbild (das in der realen Welt gar nicht gegeben ist).
Der Schriftsteller und Philosoph Pascal Mercier schreibt diesbezüglich in seinem Roman Nachtzug nach Lissabon:
„Dass Worte etwas bewirkten, dass sie jemanden in Bewegung setzen oder aufhalten, zum Lachen oder Weinen bringen konnten: Schon als Kind hatte er es rätselhaft gefunden, und es hatte nie aufgehört, ihn zu beeindrucken. Wie machten die Worte das? War es nicht wie Magie?“ (Mercier 2006: 59)
Was hier poetisch im Roman als Magie bezeichnet wird, nannte Sigmund Freud die „Zauberkraft“ der Worte (Freud 1916/1969: 43). Wissenschaftlicher ausgedrückt handelt es sich hierbei um die persuasive Funktion von Sprache, Menschen zum Handeln zu bewegen, sie glücklich oder unglücklich zu machen, sie zu überzeugen oder zu überreden. Dieses persuasive Potenzial von Texten ergibt sich aus der Instrument- und Handlungsfunktion von Sprache, Bewusstseinsinhalte zu aktivieren oder zu verändern, Gefühle zu wecken oder zu intensivieren und Handlungsimpulse auszulösen. Um zu verstehen, wie Texte benutzt werden können, um andere Menschen zu informieren, zu beeinflussen etc., muss man verstehen, was Texte für Gebilde sind, wie sie aufgebaut werden, nach welchen Prinzipien sie funktionieren und wie sie verarbeitet werden.
Aufgaben der Textlinguistik
Die Textlinguistik beschäftigt sich als wissenschaftliche Disziplin mit der Struktur, der Funktion und der Verarbeitung von Texten: Sie analysiert, nach welchen Prinzipien Texte gebildet sind und wie wir die komplexen Inhalte anordnen, die wir an andere weitergeben, und mit welchen sprachlichen Mitteln Information vermittelt wird. Sie beschreibt dabei, wie Form und Inhalt eines Textes zusammenhängen. Es geht aber auch um die Frage, inwiefern uns Typen von Texten oft ganz maßgeblich in unseren Entscheidungen, Meinungen, Stimmungen, Handlungen beeinflussen. Welche Merkmale von Texten sind besonders verantwortlich für dieses Persuasions- und Emotionspotenzial? Und was machen wir eigentlich geistig, wenn wir Texte schreiben oder lesen? Welche mentalen Prozesse laufen in unseren Köpfen ab, wenn wir Textinformationen verarbeiten? Worin genau besteht die Kompetenz zur Textproduktion und -rezeption?
Die umfassende Bedeutung von Texten für den Alltag von Menschen, ihre komplexe sprachliche Struktur und schließlich die Interaktion verschiedenster kognitiver Prozesse bei ihrer Verarbeitung verlangen eine intensive Beschäftigung mit allen Aspekten der Textlinguistik. Diese Einführung vermittelt grundlegende Kenntnisse über Annahmen und Methoden der textlinguistischen Untersuchung, also einer wissenschaftlichen Analyse von Texten. Was unterscheidet den alltäglichen Umgang mit Texten von einer wissenschaftlichen Analyse? Im alltäglichen Leben machen wir uns meist nicht bewusst, was wir tun, wenn wir mit Texten umgehen. Die meisten sprachlichen Prozesse laufen automatisch und so selbstverständlich ab, dass wir die dahinterliegenden Kompetenzen und Routinen gar nicht erkennen können. Die berühmte Textstelle von Augustinus über die Zeit lässt sich auch auf die Beschäftigung mit Texten übertragen: „Was also ist die Zeit? Wenn mich niemand fragt, weiß ichs; wenn ich es einem Fragenden erklären will, weiß ichs nicht.“ (Confessiones XI, 14, 22f.)
intuitives Textwissen
textuelle Kompetenz
Auch bei Texten sind wir überzeugt, zu wissen, worum es sich handelt. Versuchen wir jedoch, unsere Intuition genauer zu beschreiben und klare Aussagen über Texte, ihre Struktur und Funktion zu machen, geraten wir bald ins Stocken oder wir artikulieren subjektive, oft nicht nachprüfbare Eindrücke. Viele wichtige Aspekte von Texten fallen uns gar nicht mehr auf; z.B., dass sie oft wörtlich etwas anderes beinhalten als das Gemeinte, so dass wir zusätzliches Wissen aktivieren müssen, um sie zu verstehen: Jeder, der auf die Frage Wissen Sie, wie viel Uhr es ist? als Antwort lediglich ein Ja und sonst keine weitere Auskunft erhält, stößt automatisch auf dieses Phänomen. Jeder, der eine Schlagzeile wie Bus rollt über Bein! liest und dabei automatisch, blitzschnell und ohne zu überlegen aufgrund dieser geringen Information im Verstehensprozess die geistige Repräsentation eines komplexen Sachverhalts konstruiert, aktiviert Weltwissen aus seinem Langzeitgedächtnis, ohne sich dessen bewusst zu sein. Die textuelle Kompetenz funktioniert, ohne dass wir dies bemerken und darüber reflektieren.
Der Sprachphilosoph Wittgenstein hat dieses Phänomen folgendermaßen beschrieben: „Wir können es nicht bemerken, weil wir es immer vor Augen haben.“ (zit. n. Mausfeld 2005: 47). Die routinierte Selbstverständlichkeit blockiert so den analytischen Blick auf Texte und verhindert oft ein kritisches Wahrnehmen. Auf die Oberfläche des Textes, d.h. seine grammatischen und lexikalischen Verknüpfungsformen achten wir ohnehin kaum (es sei denn, es gibt Verständnisprobleme), vielmehr konzentrieren wir uns fast ausschließlich auf den Inhalt von Texten. Texte sind aber immer Form-Inhalt-Kopplungen: Ohne Formen können wir keine Inhalte vermitteln (da wir nicht Gedankenlesen können). Die Art und Weise der Realisierung, der Kodierung von Inhalten spielt oft eine besonders wichtige Rolle; sie entscheidet darüber, ob ein Text als schwer oder leicht verständlich, innovativ oder abgedroschen empfunden wird.
Nachbardisziplinen
Die Textlinguistik blickt auf Texte als sprachliche Gebilde an sich und untersucht alle wesentlichen Charakteristika von Texten als Texte, anders als Disziplinen wie Literaturwissenschaft, Hermeneutik, Pädagogik oder Rechtswissenschaft, die nur jeweils bestimmte Aspekte betrachten (z.B. Ästhetik von Texten, Sinnauslegung). Die Textlinguistik will die Beziehung zwischen Form, Bedeutung und Funktion beschreiben, Implizites explizieren, Unbewusstes bewusst machen und Alltägliches und scheinbar Selbstverständliches kritisch reflektieren. Hierzu benutzt die Textlinguistik, wie andere Wissenschaften auch, ihre eigene Fachterminologie; sie stellt möglichst präzise Beschreibungs- und Erklärungsmodelle auf, um transparent zu machen, was wir als normaler Sprachbenutzer beim Textverstehen vielleicht intuitiv wahrnehmen und fühlen, aber nicht präzise formulieren und erklären können. Dabei gilt für die Textlinguistik, was für alle empirischen Geisteswissenschaften gilt: Ihre Annahmen, Theorien und Modelle sollen nicht nur intersubjektiv nachvollziehbar sein (dazu müssen sie in sich widerspruchsfrei sein und im Einklang mit den Erkenntnissen von Nachbardisziplinen wie Kognitions- und Neuropsychologie stehen), sie sollen auch überprüfbar sein, insbesondere durch systematische Beobachtung und Analyse „echter“ Texte (im Gegensatz zu Beispielen, die eigens dazu erfunden werden, die eigene Theorie zu belegen).
Zum einen gibt die Textlinguistik also ein Werkzeug an die Hand bzw. in den Kopf, das ermöglicht, Texte angemessen zu beschreiben und zu erklären: eine Fähigkeit, die nicht nur für Sprach- und Literaturwissenschaftler sowie Lehrer wichtig ist. Denken Sie an die Tätigkeit von Lektoren, Journalisten, Medienberatern, PR-Leuten, Werbefachleuten, Redenschreibern und forensisch arbeitenden Kriminalisten, von Vorurteilsforschern und Historikern. Alle diese Tätigkeiten erfordern einen geübten Blick auf Texte, ihre Strukturen und ihre Funktionen. Zum anderen aber soll durch die textwissenschaftliche Analyse auch ganz allgemein der Umgang mit Texten reflektierter und kritischer werden. Die Leser dieses Buches sollen in der Lage sein zu erkennen und zu beschreiben, was an bestimmten Texten besonders, auffällig, interessant und u.U. auch gefährlich ist. Texte vermitteln Wissen über die Welt, aber sie schaffen auch Welten und prägen Wertvorstellungen (und dies nicht nur in der Literatur, sondern auch im politischen, ideologiegeprägten Diskurs und im Werbebereich).
Texte als Spuren
Dass wir Texte produzieren und rezipieren können, ist Ausdruck unserer sprachlichen und insbesondere unserer textuellen Kompetenz. Insofern sind Texte als Spuren der geistigen Aktivität von Menschen zu betrachten. Sie verraten uns ganz konkret etwas über ihre Verfasser und geben u.a. Einblick in Situationszusammenhänge oder andere geschichtliche Epochen. Textanalysen decken Argumentationsmuster und manipulative Strategien auf, legen stilistische und ästhetische Dimensionen frei, machen nur Angedeutetes klar und transparent. Textanalysen ermöglichen es aber auch, geistige Prozesse zu rekonstruieren, nämlich was die mentale Basis unserer Textkompetenz ist, geben also Aufschluss über eine entscheidende, zentrale geistige Fähigkeit des Menschen. Konkrete Texte sind Spuren der Kompetenz, die als abstrakte, nicht sofort fassbare Eigenschaft dem sprachlichen Handeln zugrunde liegt. Sie ermöglichen also, mentale Fähigkeiten zu rekonstruieren und zeigen uns letztlich, wie die menschliche Kognition hinsichtlich der Sprachverarbeitung funktioniert und auf welche Kenntnissysteme und prozedurale Fähigkeiten sie zurückgreift, wenn wir Texte produzieren und rezipieren.
In den folgenden Kapiteln werden wir die wesentlichen Fragen, Annahmen und Methoden der Textlinguistik beschreiben und sie anhand vieler authentischer Bespiele diskutieren und anwendungsorientiert erproben.
Diese Einführung unterscheidet sich von den bereits vorliegenden Textlinguistikbüchern vor allem dadurch, dass sie erstens nicht primär strukturorientiert ist, sondern alle Komponenten textueller Kompetenz aufeinander bezieht, und sich zweitens auf natürliche Daten stützt. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf der prozeduralen Komponente, also der Kompetenz zur Produktion und Rezeption von Texten, ohne die z.B. das zentrale Phänomen der Kohärenz, also der inhaltliche Zusammenhang von Texten, gar nicht erklärt werden kann. Dieses Buch richtet sich besonders an alle Studierenden in den philologischen Bachelor-, Master- und Lehramtsstudiengängen, die sich anhand eines komprimierten und gut verständlichen Überblicks über die wesentlichen Fragen und Ergebnisse der aktuellen Textlinguistik informieren wollen und ihre Kenntnisse anhand von Textanalysen und Übungsaufgaben erproben möchten (Übungen, Aufgaben mit Lösungen, Glossar und Tipps für Hausarbeiten finden sich auf der Seite www.linguistik.tu-berlin.de/menue/Textlinguistik-Einfuehrung/). Prinzipiell aber können alle an Texten und Textuntersuchungen Interessierten diese interdisziplinäre Abhandlung mit Gewinn lesen, da sie viele Aspekte umreißt, die in den üblichen Einführungen und Lehrbüchern nicht oder zu wenig thematisiert werden, und stets die anwendungsorientierte sowie gesellschaftsrelevante Dimension wissenschaftlicher Textanalysen berücksichtigt.
kognitiver Ansatz
Auf formale Darstellungen und die Berücksichtigung formalistischer Ansätze verzichten wir. Diese suggerieren oft nur ein höheres Maß an Wissenschaftlichkeit durch (pseudo-)mathematische Repräsentationen, bringen tatsächlich aber keinerlei Erkenntnisgewinn über Textproduktion oder -rezeption. Menschliche Kommunikation folgt generell nicht nur formalen, sondern auch mentalen und sozialen Gesetzmäßigkeiten. Ein wichtiges Anliegen dieses Buchs ist, zu zeigen, dass die Textlinguistik ein Bindeglied ist zwischen der Beschreibung interner Sprachstrukturen und der Erforschung des menschlichen Sprachgebrauchs in allen seinen Facetten und dass textlinguistische Analysen weit mehr beinhalten als die Aufzählung kohäsiver Mittel und die Beschreibung von Kohärenzrelationen. Sich auf Kohärenztheorie und Textverstehensmodelle einzulassen, bedeutet immer auch, sich mit dem eigenen Kopf, mit der menschlichen Kognition zu beschäftigen und (selbst-) kritisch dessen Funktionsweise zu reflektieren. Somit ist diese Einführung in einem doppelten Sinn anwendungsorientiert und praktisch ausgerichtet. Sie zeigt einerseits auf der Basis theoretischer Grundlagen und anhand vieler Analysen authentischer Beispiele auf, wie Kenntnisse der Textlinguistik in der alltäglichen wie auch massenmedialen Kommunikation helfen, Texte und ihr Wirkungspotenzial intensiver zu betrachten, besser zu verstehen, kritisch(er) zu beurteilen und präziser zu beschreiben. Andererseits schärft sie aber auch den Blick für die eigenen geistigen Fähigkeiten und Leistungen im Umgang mit Texten.
Dank
Wir danken Maria Fritzsche, Gerrit Kotzur, Sara Neugebauer, Jonas Nölle und Sabine Reichelt für viele hilfreiche Kommentare zur Verständlichkeit aus studentischer Leserperspektive sowie die Unterstützung beim Korrekturlesen und Formatieren. Konstanze Marx gebührt Dank dafür, dass sie unser Kap. 6 durch einen Abschnitt zur forensischen Textanalyse bereichert hat.