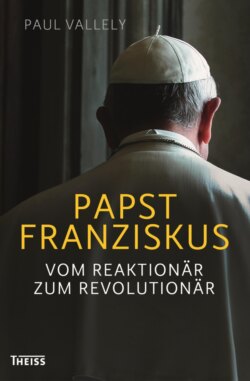Читать книгу Papst Franziskus - Paul Vallely - Страница 8
1 SCHMUTZIGE TRICKS IM VATIKAN
ОглавлениеNiemand wollte zugeben, dass er die E-Mail verschickt hatte: Der Botschafter wollte es nicht gewesen sein, der Anwalt auch nicht, und ebenso wenig der journalist. Auch etliche hochrangige Offizielle in der Gesellschaft Jesu, dem weltweit größten und einflussreichsten religiösen Orden, stritten es ab. Das Dossier aber, das anonym im Posteingang führender Kardinäle eintraf, während sie in Rom zusammenkamen, war belastend. Zumindest sollte es das sein. Jemand wollte Jorge Mario Bergoglio als Papst verhindern.
Wenn ein Papst stirbt, versammeln sich Kardinäle aus der ganzen Welt im Vatikan zur sogenannten Generalkongregation. Im April 2005 ging es in den ersten Tagen dieser Zusammenkunft um all die Fragen, die sich aus dem Tod jenes Mannes ergaben, den der Vatikan rasch „Johannes Paul den Großen“ taufte. „Santo subito“, hatte die Menge auf dem Petersplatz skandiert: „Sprecht ihn heilig, sofort!“ Der alte Papst war einen langen öffentlichen Tod gestorben und hatte dabei eine Ikone des Leidens aus sich gemacht, so als wollte er eine Welt zurechtweisen, die vor lauter Geschäftigkeit das einfache Sein verlernt hatte. Doch während die Kardinäle der römisch-katholischen Kirche in jener Kongregation öffentlich die Einzelheiten der größten Beisetzung in der Geschichte der Menschheit berieten, diskutierten sie privat eine ganz andere Frage: Wer sollte der nächste Papst werden?
Das war die Situation, in der das genannte Dossier eintraf. Nur drei Tage vor dem Konklave von 2005 zur Wahl des neuen Papstes erstattete der Menschenrechtsanwalt Marcelo Parrilli in Argentinien Anzeige gegen Kardinal Bergoglio: Er sei mitschuldig an der Entführung von zwei Jesuitenpriestern, deren tätiges Bemühen um die Armen in einem Elendsviertel von Buenos Aires vom argentinischen Militär und seinen Todesschwadronen als subversiv angesehen worden war. Bergoglio hatte die Priester eine Woche vor ihrem Verschwinden aus der Gesellschaft Jesu ausgeschlossen, weil sie seiner Anordnung, ihre Arbeit in den Slums zu beenden, nicht Folge geleistet hatten. Während ihrer Verschleppung wurden sie gefoltert und fünf Monate lang gefesselt und mit verbundenen Augen gefangen gehalten, bis man sie freiließ.
Der Sprecher des Kardinals in Buenos Aires qualifizierte die Anschuldigungen – mit denen wir uns in einem späteren Kapitel ausführlich befassen werden – 2005 als die üblichen „alten Verleumdungen“ ab. Die Vorwürfe basierten auf den Untersuchungen eines verbissen kämpfenden Journalisten, Horacio Verbitsky, der mit einem der entführten Jesuiten nach seiner Freilassung gesprochen hatte. Außerdem hatte er Darstellungen von Priestern und Laienhelfern zusammengetragen, die die Anschuldigungen angeblich erhärteten und schließlich in alten Regierungsakten Belastendes aus Bergoglios Zeit als Leiter der Jesuitenprovinz in Argentinien entdeckt. Die gegen den Kardinal eingereichte Klage wurde schließlich abgewiesen, die Diskussionen aber gingen unvermindert weiter.
Bergoglios Verteidiger brachten vor, dass Verbitsky aus niederen Motiven handele. Er sei ein politischer Verbündeter des vormaligen Präsidenten Néstor Kirchner und seiner Nachfolgerin Cristina Kirchner. Verbitskys am meisten ins Detail gehende Anschuldigungen gegen Bergoglio finden sich in seinem im März 2005 veröffentlichten Buch El Silencio, das er nach Bergoglios Kritik an Präsident Néstor Kirchner verfasst hatte. Der Kardinal hatte Kirchner öffentlich an den Pranger gestellt, weil er weder gegen die Korruption vorgegangen sei noch sich für die Armen eingesetzt habe. Die wichtigste argentinische Zeitung Clarín behauptete, die Kirchner-Regierung habe das Dossier über ihren Botschafter beim Heiligen Stuhl unter den Kardinälen verbreiten lassen. Doch sowohl die Regierung als auch der Botschafter dementierten diese Meldung. Verbitsky seinerseits konterte mit dem Hinweis, dass er bereits 1999 mit der Untersuchung der Anschuldigungen begonnen hatte, also vier Jahre, bevor die Kirchners an die Macht gelangten.
Es gab in diesem Zusammenhang noch andere Verdächtige, die als Absender infrage kamen. Alicia Oliveira, eine frühere argentinische Menschenrechtsanwältin und Richterin, die von der Militärjunta verfolgt worden war – und die nach wie vor eng mit Bergoglio befreundet ist –, beschuldigte konservative Elemente in den Machtzirkeln des Landes mit Verbindungen zu Opus Dei. Sie seien es gewesen, die 2005 versucht hätten, die Wahl Bergoglios ins Papstamt zu vereiteln. Für andere wiederum geht die E-Mail auf das Konto von Ordensbrüdern, die es sich mit Bergoglio während seiner Zeit als Provinzial in Argentinien verdorben hatten. Es ist ganz sicher richtig, dass es unter den Jesuiten starke Vorbehalte gegen ihn gab; viele Jahre zuvor hatten sich die Ordensleute bei der Jesuitenkurie in Rom über sein Verhalten beschwert. Dazu waren E-Mails in Umlauf, in denen sich Ordensbrüder beklagten, Bergoglio sei ein Mann, „der niemals lächelt“. Wer auch immer das Dossier an die zahlreichen Kardinäle verschickte – letztlich war es eine gemeinschaftliche Aktion, eine Kampagne, um Bergoglio aufzuhalten, daran kann kein Zweifel bestehen. Katholiken sagen gern, dass die Kirche bei der Auswahl eines Papstes durch den Heiligen Geist gelenkt wird. In diesem Fall aber waren fraglos andere Kräfte am Werk, die den Ausgang des Geschehens zu bestimmen suchten. Doch hatten sie auch Erfolg damit?
Die Kardinäle der Generalkongregation trafen sich bei ihrer ersten Zusammenkunft in der Synodenhalle im Schatten des Petersdoms. Dieser unscheinbare Nachkriegsbau mit einem Innenbereich in fadem Beige und dem Charme eines Universitätshörsaals passt irgendwie zu der trostlosen Förmlichkeit der Kirchenpolitik. Die richtige Politik aber fand nicht in diesem Rahmen statt, sondern in den Mittagspausen und bei den Abendessen der Kardinäle, die im Konklave die Fäden ziehen würden. „Seit dem letzten Abendmahl Jesu hat die Kirche ihre wichtigsten Angelegenheiten am Esstisch entschieden“, witzelte einer der Wahlberechtigten. Manche der Kardinäle kannten einander bereits gut. Sie waren jedoch in der Unterzahl. Papst Johannes Paul II. hatte das Kardinalskollegium über die Jahre hinweg internationalisiert, und neue Wahlberechtigte aus allen Teilen der Welt kamen hinzu. Er habe „Scharen von Kardinälen aus Entwicklungsländern“ gesehen, berichtete der Berater eines Kardinals, „die wie Touristen überwältigt in Rom umherwanderten“. Einer soll sogar gefragt haben: „Wo finden diese Essen statt, von denen die anderen alle reden?“
Cormac Kardinal Murphy-O’Connor, damals Erzbischof von Westminster, richtete im Päpstlichen Irischen Kolleg ein Treffen der englischsprachigen Kardinäle aus. Die wirklich wichtigen Dinge aber besprach er mit einer kleineren Gruppe von europäischen Liberalen, darunter die Kardinäle Carlo Mario Martini aus Mailand, Walter Kasper aus Stuttgart und Godfried Daneels, Erzbischof von Brüssel. Die Gruppe hatte sich viele Jahre lang mindestens einmal jährlich getroffen, und Martini, ebenfalls ein Jesuit, war lange Zeit ihr Kandidat für das Papstamt gewesen. 2005 aber schien Martini mit 78 Jahren zu alt zu sein; dazu war er gesundheitlich so angeschlagen, dass er sich bereits drei Jahre zuvor mit dem Erreichen der Altersgrenze vom Amt des Erzbischofs zurückgezogen hatte. Erzbischof Bergoglio aus Buenos Aires war eine andere Option für diese Gruppe. Er und Murphy-O’Connor waren 2001 im selben Konsistorium in den Kardinalsstand erhoben worden. In der vatikanischen Sitzordnung bedeutete dies, dass sie bei offiziellen Anlässen im Vatikan immer nah beieinander saßen. So hatte sich zwischen den beiden Männern eine Freundschaft entwickelt.
Für viele aber war Joseph Kardinal Ratzinger der offensichtliche Kandidat. Er war seit 24 Jahren die rechte Hand von Johannes Paul II. und in seiner Funktion als Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre wachte er im Auftrag des Vatikans über deren Wahrung. Damit war er einer der wenigen ranghohen Offiziellen, mit denen jeder Kardinal bei Routinebesuchen in Rom zusammentraf. Zudem war er Dekan des Kardinalskollegiums und hatte aus diesem Grund den Vorsitz der Generalkongregationen inne. Ratzinger leitete auch die Trauermesse für Johannes Paul II. sowie die Messe Pro eligendo Papa (Zur Wahl des Papstes) am ersten Morgen des Konklaves. Bei den Generalkongregationen sprach Ratzinger, der über ein phänomenales Gedächtnis verfügte, jeden Kardinal mit Namen an und redete mit jedem in einer Sprache, die er seines Wissens verstehen konnte. Für neue wahlberechtigte Kardinäle – die sich gegenseitig so gut wie gar nicht kannten, schlecht Italienisch sprachen und die Kandidaten zur Abstimmung kaum einzuschätzen wussten – schien er die naheliegende Wahl zu sein. Schließlich war er der engste Berater des verstorbenen Johannes Paul II. gewesen, vor dem das Konklave solche Ehrfurcht hatte. Dazu trat er in den Kongregationen liebenswürdig, aber bestimmt auf; seiner Predigt während der Trauermesse vermochte er Wärme zu verleihen, während er sich in der Messe vor dem Konklave mit analytischer Klarheit über die Unzulänglichkeiten der Gesellschaft äußerte. Viele der Kardinäle, die mit der Frage „Wenn nicht Ratzinger, wer dann?“ eingetroffen waren, begannen sich zu fragen: „Warum nicht Ratzinger?“ Nach dem 26 Jahre währenden Papsttum Johannes Pauls II. stand niemandem der Sinn nach einem weiteren langen Pontifikat, sodass Joseph Ratzingers fortgeschrittenes Alter von 78 Jahren nicht als ausschlaggebend angesehen wurde. Es wirkte wie ein Fingerzeig, dass jemand dem deutschen Kardinal an seinem Geburtstag am Vorabend des Konklaves ein Arrangement aus weißen und gelben Tulpen – den Papstfarben – überreicht hatte.
Und wenn das Dossier, mit dem Bergoglio aufgehalten werden sollte, nicht in Umlauf gewesen wäre? Hätte die Wahl dann einen anderen Verlauf genommen, obwohl alles zu Ratzingers Gunsten zu sprechen schien? Um 16.30 Uhr am ersten Tag des Konklaves setzte sich die feierliche Prozession der Kardinäle in die Sixtinische Kapelle in Bewegung. Beinahe eine Stunde verging, bis die 115 wahlberechtigten Kardinäle ihren Eid geleistet und sich zu Ernsthaftigkeit und Verschwiegenheit verpflichtet hatten. Auf die förmliche Proklamation „Exeunt omnes“ (Alle gehen hinaus) hin verließen alle Nichtbeteiligten die Kapelle und die Türen wurden verschlossen – das lateinische con clave bedeutet „mit einem Schlüssel“. Damit konnte die Abstimmung beginnen.
Als Ergebnis all der formellen Kongregationen und informellen Treffen standen schließlich vier Kardinäle im Zentrum der Aufmerksamkeit: Joseph Ratzinger, Carlo Maria Martini, der Kardinalvikar von Rom, Camillo Ruini, und Jorge Mario Bergoglio. Auch andere Namen machten die Runde: Dionigi Tettamanzi, Erzbischof von Mailand, Angelo Scola, Patriarch von Venedig, und Francis Arinze, Erzbischof von Onitsha in Nigeria. Der Dekan fragte die Versammlung, ob sie gleich abstimmen oder sich lieber auf den Abend vertagen wollte. Man entschloss sich zur Abstimmung.
Im ersten Wahlgang erhielt Ratzinger 47 Stimmen; damit fehlten ihm 30 Stimmen zur erforderlichen Zweidrittelmehrheit von 77. Die wirkliche Überraschung der ersten Runde war jedoch, dass auf den Argentinier Bergoglio zehn Stimmen entfielen – eine mehr als auf den Kandidaten der Liberalen, den emeritierten Mailänder Erzbischof Martini. Ruini bekam sechs Stimmen, und der Staatssekretär im Vatikan, Angelo Kardinal Sodano, der Erster Minister Papst Johannes Pauls II. gewesen war, erhielt vier Stimmen. Auf den Honduraner Óscar Andrés Kardinal Rodríguez Maradiaga, Erzbischof von Tegucigalpa, entfielen drei, auf den Mailänder Erzbischof Tettamanzi nur zwei Stimmen. Ein paar andere Kandidaten bekamen eine einzige Stimme.
Die Kardinäle beendeten die Abstimmung für diesen Tag und gingen zum Abendessen. An den Tischen im Speisesaal, in den kleinen Gruppen von zwei oder drei Personen, in denen sie sich später im Flur oder in ihren Privaträumen zusammenfanden, oder auf der Terrasse beim Rauchen – man sprach über Bergoglio und darüber, dass er seinen Ordensbruder Martini geschlagen hatte. Wer wenig über ihn wusste, begann sich zu informieren. Manche erinnerten sich noch von der Bischofssynode vor vier Jahren her an ihn. Damals, im Jahr 2001, war dem Erzbischof von New York, Edward Kardinal Egan, die Tätigkeit des Relators übertragen worden; er hatte die Diskussionen und Resultate zusammenfassen sollen, war jedoch infolge der Terroranschläge vom 11. September gezwungen gewesen, nach New York zurückzukehren. Papst Johannes Paul II. hatte Bergoglio gebeten, die Aufgabe zu übernehmen, und einige der Geistlichen konnten sich noch gut an die kollegiale Art erinnern, mit der er den Vorsitz führte.
Der gegenseitige Austausch beim Essen brachte jedoch noch weitaus Interessanteres zutage: Bergoglio hatte über die Jahre Beziehungen zu einer der neuen Laienbewegungen innerhalb der Kirche geknüpft, der Comunione e Liberazione, von der auch Papst Johannes Paul II. sehr angetan gewesen war. Für ein Buch, das den italienischen Gründer der Bewegung, Padre Luigi Giussani, würdigte, hatte Bergoglio ein Kapitel verfasst, und er war mehrere Male in Rimini gewesen, um auf der jährlich stattfindenden Massenveranstaltung der Bewegung zu sprechen. Dieser Kontakt war von spezieller Bedeutung, da die Communio einst als mailändische Hauptopposition zu Bergoglios jesuitischem Konkurrenten Kardinal Martini gegolten hatte.
Bergoglio gab sich zugeknöpft und wortkarg in Bezug auf die Frage, ob er Papst werden wolle. Auch seine bis heute engen Freunde in Argentinien wurden nicht richtig schlau aus ihm. Manche glaubten, er wolle das Amt, andere nicht. „Manchmal weiß man einfach nicht, was ein Jesuit denkt“, bemerkte einer von ihnen. Mit Sicherheit aber ist Bergoglio nicht hinter den Kulissen in eigener Sache aktiv geworden. Dagegen begann Kardinal Lehmann, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, für ihn die Werbetrommel zu rühren. Auch Kardinal Daneels, der Erzbischof von Brüssel, vermochte eine nicht eben kleine Gruppe von wahlberechtigten Kardinälen aus dem Norden wie aus dem Süden zu Bergoglios Unterstützung zu gewinnen. Zwei dienstältere Kurienkardinäle stellten sich ebenfalls hinter ihn. Ihrer Ansicht nach verkörperte er eine echte, einheitsstiftende Alternative zu Ratzinger: Konservative konnten ihn als einen Mann verehren, der unter den Jesuiten die Stellung gegen liberalisierende Strömungen gehalten hatte und der marxistischen Tendenzen in der Befreiungstheologie entgegengetreten war; auf der anderen Seite konnten die Moderaten in ihm ein Symbol für das Bemühen der Kirche um die Armen und die Interessen der Entwicklungsländer sehen. Und in einer wichtigen Hinsicht gab es sogar eine Schnittmenge: Konservative und Moderate wussten gleichermaßen zu schätzen, wie Bergoglio ein feines Gespür für die Seelsorge mit der Anspruchslosigkeit als Person verband – ein Kirchenfürst, der das große erzbischöfliche Palais gegen eine einfache Wohnung in seinem episkopalen Bürogebäude eingetauscht hatte, der seine Mahlzeiten selbst zubereitete und auf eine Limousine samt Chauffeur verzichtete, um stattdessen U-Bahnen und Busse zu benutzen. Nicht zuletzt war Bergoglio ein Mann des innigen Gebets.
Am nächsten Morgen um halb zehn wurde die Wahl mit einer neuen Abstimmung fortgesetzt. Unter den lateinischen Schriftzug Eligo in summum pontificem („Ich wähle zum höchsten Pontifex“) schrieb jeder Kardinal mit verstellter Handschrift seine Entscheidung auf einen rechteckigen Wahlzettel, faltete ihn längs und warf ihn in eine eigens für diesen Zweck entworfene Wahlurne. Der zweite Wahlgang erbrachte, dass Ratzingers Stimmanteil mit 65 Befürwortern gewachsen war, der von Bergoglio sich jedoch mehr als verdreifacht hatte – auf ein Viertel der Stimmen. 35 Kardinäle hatten ihn gewählt. Martini und Ruini bekamen gar keine Stimme, auf Sodano und Tettamanzi entfielen wie zuvor einige wenige.
Um elf Uhr vormittags begann der dritte Wahlgang. Diesmal erhielt Ratzinger 72 Stimmen und näherte sich damit bis auf 5 Stimmen der erforderlichen Mehrheit von 77 an. Bergoglio aber bekam 40 Stimmen – das reichte aus, um eine Sperrminorität zu bilden und Ratzinger am Erreichen jener Zweidrittelmehrheit zu hindern, die er benötigte, um zum Papst erklärt zu werden.
Es kam jedoch noch ein weiterer Faktor zum Tragen. Im Jahr 1996 hatte Papst Johannes Paul II. mit Universi Dominici gregis eine neue apostolische Verfassung erlassen. Nach der durch sie verfügten Änderung des Wahlsystems würde im Falle einer Blockierung nach 34 Wahlgängen eine einfache Mehrheit zum Sieg reichen. Einige von Ratzingers Unterstützern ließen verlauten, sie bräuchten nur dafür zu sorgen, dass die Abstimmungen in den nächsten 13 Tagen keinen anderen Sieger fänden. Ihr Kandidat würde dann in jedem Fall den Sieg davontragen, weil er schon jetzt mehr als die für eine einfache Mehrheit nötigen 58 Stimmen auf sich versammelt hatte.
An dieser entscheidenden Stelle unterbrachen die Kardinäle ihr Konklave für das Mittagessen. Würde Ratzinger aus dem nächsten Wahlgang als Papst hervorgehen? Diese Frage trieb alle um und wurde flüsternd diskutiert. Oder hatte womöglich die Unterstützung für Ratzinger ihren Höhepunkt bereits erreicht? Dann konnte es sein, dass die bisher auf ihn entfallenen Stimmen auf einen anderen Kandidaten übergingen, womöglich auf Jorge Mario Bergoglio.
Jenseits der Sixtinischen Kapelle war sich der argentinische Kardinal völlig im Klaren darüber, dass er in jedem Wahlgang an zweiter Stelle gestanden hatte. Bei jeder Abstimmung waren mehr Kardinäle zu ihm geschwenkt und hatten für ihn votiert. Die 40 Stimmen, die er im letzten Wahlgang erzielen konnte, stellten den höchsten Wert dar, der je von einem Lateinamerikaner erreicht wurde. Er wusste aber auch, dass Ratzingers Unterstützer, wenn ausreichend viele von ihnen eine harte Linie verfolgen würden, so lange aushalten konnten, bis die einfache Mehrheit ausreichen würde. Ein derartig langes Konklave würde dem Image der Kirche in der Welt schaden. Man würde darin ein Zeichen der Uneinigkeit sehen.
Bergoglio gab – mehr mit Gesten als mit Worten – zu verstehen, dass seine Unterstützer ihre Stimme nicht länger ihm, sondern Ratzinger geben sollten. Im vierten Wahlgang erhielt Bergoglio lediglich 26 Stimmen, auf seinen Konkurrenten entfielen 84. Joseph Ratzinger wurde zum Papst erklärt und in den Ankleideraum für den neuen Pontifex geführt, der als „Raum der Tränen“ bekannt ist, ohne dass dazugesagt wird, ob es sich um vor Kummer oder aus Freude geweinte Tränen handelt.
Bergoglio versuchte dem neuen Papst – der nach Annahme der Wahl erklärt hatte, er wolle den Namen Benedikt annehmen – zu folgen, um mit ihm zu sprechen. Die Schweizer Gardisten ließen ihn aber nicht ein. Der Mechanismus der Römischen Kurie zur Erhebung des neuen Hirten und zu seiner Absonderung von der Herde griff unverzüglich. Die Glocken läuteten. Draußen auf dem Balkon vor den wartenden Massen auf dem Petersplatz strahlte Benedikt XVI., hob seine Arme und führte seine Hände zu einer Jubelpose zusammen wie ein Preisboxer im Triumph.
Am nächsten Morgen harrte Jorge Mario Kardinal Bergoglio länger als fast jeder andere in der Sala Clementina im dritten Stock der Residenz des Papstes aus, um mit dem neuen Pontifex zu sprechen, sich in Ehrerbietung vor ihm zu verbeugen und ihm die Treue zu geloben, wie die Kardinäle es seit dem Mittelalter tun. In seinem Herzen muss er erwogen haben, dass die Dinge nicht auf diese Weise gehandhabt werden sollten. Wäre es ohne das Dossier vielleicht anders gekommen?
Es gibt Fälle, in denen ein Papst keine große Ähnlichkeit mehr mit dem Kardinal hat, der er einmal war. Als Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre – der ehedem als Heilige Kongregation der römischen und allgemeinen Inquisition bekannten päpstlichen Behörde – war Joseph Ratzinger der Hüter der Rechtgläubigkeit innerhalb der Kirche gewesen, der weder Widerspruch noch Debatten duldete. Doch als er Papst Benedikt XVI. wurde, verwandelte sich der Mann, der als „Rottweiler Gottes“ verschrien war, in einen freundlichen deutschen Hirten. Seine Ansichten waren so klar wie zuvor, er brachte sie jedoch in einem anderen Ton vor. Er wartete mit einem überraschend sanften Lächeln auf und trat bei seinen Auslandsreisen als ein Papst in Erscheinung, der dem Dialog mit der übrigen säkularen Welt aufgeschlossen gegenüberstand. „Er hat uns ins Grübeln gebracht“, erklärte der britische Premierminister David Cameron nach Benedikts diversen und als einfühlsam wahrgenommenen Ansprachen in Großbritannien. Doch auch wenn er ein weiser Lehrmeister und ein sanfter Seelenhirte war, so war Benedikt der XVI. doch ein schwaches Oberhaupt und ein schlechter Politiker.
Seine acht Amtsjahre waren von einer Reihe unglückseliger Entscheidungen und PR-Katastrophen geprägt. Diese nahmen ihren Anfang mit einer Vorlesung in Regensburg 2006, welche die Muslime auf der ganzen Welt verletzte, und setzten sich fort mit der Wiederaufnahme eines den Holocaust leugnenden Bischofs in die Kirche, der Zumutung zutiefst konservativer Bischöfe auf der ganzen Welt, die mehr an Kulturkriegen interessiert waren als am geistlichen Amt, sowie der Schaffung eines Ordinariats mit dem Ziel, traditionalistische Anglikaner für Rom zu gewinnen, ohne dass zuvor die Führung der Anglikanischen Gemeinschaft konsultiert wurde. Hinzu kamen neue Geldwäschevorwürfe gegenüber der skandalumwitterten Vatikanbank, eine umstrittene liturgische Neuregelung der Messe und die Disziplinierung amerikanischer Nonnen, die in bestimmten Belangen wie etwa der Homosexualität als zu liberal galten. All das ließ die Beziehungen zwischen dem Vatikan und katholischen Theologen auf den tiefsten Punkt seit der Reformation sinken. Und über allem schwebten zum Überfluss noch der anhaltende Skandal der Vertuschung sexuellen Missbrauchs durch Priester und ein vatikanischer Beamtenapparat, der von Karrieristen durchsetzt und außer Kontrolle geraten war.
Wie Jorge Mario Bergoglio in Argentinien all diesen Dingen begegnete, war aufschlussreich. Seine Reaktion auf den Regensburger Aufruhr brachte ihn in unmittelbaren Konflikt mit dem Vatikan. Das Ganze begann mit einer sorgsam ausgearbeiteten Vorlesung über Glaube und Vernunft, die Benedikt XVI. an seiner alten Regensburger Universität hielt. Darin zitierte der Papst eine hochexplosive Äußerung eines byzantinischen Kaisers, wonach der Islam und Gewalt zusammengehörten, und pflichtete diesem Diktum dem Anschein nach bei. Daraufhin kam es auf der ganzen Welt zu Unruhen, bei denen Christen starben. Der Papst entschuldigte sich zwar, wirkte aber irritiert darüber, dass Äußerungen, von denen niemand Notiz genommen hätte, als er noch lediglich Wissenschaftler war, nun eine solche Wucht entfalteten.
Doch Jorge Mario Bergoglio weit weg in Lateinamerika hatte durchaus verstanden, was hier auf dem Spiel stand. Durch einen Sprecher setzte er Newsweek Argentina von seiner „Unzufriedenheit“ mit Benedikts Worten in Kenntnis. „Papst Benedikts Darlegung spiegelt nicht meine eigenen Ansichten wider“, erklärte der Erzbischof von Buenos Aires. „Diese Äußerungen eignen sich dazu, innerhalb von 20 Sekunden jene Konstruktion von Beziehungen mit dem Islam einzureißen, die Papst Johannes Paul II. über die letzten 20 Jahre hinweg sorgsam errichtet hat.“ Der Vatikan war aufgebracht; er verlangte die Entlassung von Bergoglios Pressereferenten Pater Guillermo Marcó, der seit acht Jahren als sein Sprecher wirkte und der mit Newsweek gesprochen hatte. Marcó nahm die Schuld auf sich und trat zurück, wobei er betonte, dass er die Kommentare nicht als Bergoglios Sprecher abgegeben habe, sondern als Präsident des Instituts für interreligiösen Dialog. Allerdings glaubten nur wenige, dass es sich bei seinen Äußerungen nicht um Bergoglios Gedanken handelte, die er nur wiedergegeben hatte. Bergoglio reagierte umgehend: Er berief ein interreligiöses Treffen ein und demonstrierte zugleich sein politisches Geschick, indem er einen anderen den Vorsitz führen ließ.
Genauso wenig erfreut war der Erzbischof von Benedikts Entscheidung im Jahr 2009, die Exkommunikation von vier lefebvrianischen Bischöfen der abgespaltenen Priesterbruderschaft St. Pius X. aufzuheben – einer dieser Geistlichen, Bischof Richard Williamson, stellte sich als Holocaustleugner heraus, der beharrlich abstritt, dass Millionen von Juden in den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten vergast worden waren. Benedikt räumte später ein, eine simple Überprüfung im Internet hätte diese Tatsache ans Licht bringen können – ein Anruf bei Bergoglio hätte es auch getan. Williamson lebte in Argentinien, wo er selbst unter den Lefebvrianern als derart extrem galt, dass sie ihn als Leiter eines ihrer Priesterseminare absetzten. Bergoglios Freunde in Argentinien wussten von zahlreichen ekklesiologischen wie politischen Schwierigkeiten zu berichten, die er im Laufe der Jahre mit den Lefebvrianern gehabt hatte. „Für ihn waren sie Anhänger der Militärdiktatur“, erklärte Alicia Oliveira. „Er hatte eine Menge Probleme mit ihnen.“ Im Zuge der Wiederherstellung der Demokratie in Argentinien wurde die Vergangenheit in verschiedenen Gerichtsverfahren zur Militärjunta aufgearbeitet. Dabei war auch herausgekommen, dass der Gründer der Splittergruppe, Erzbischof Marcel Lefebvre, in jener Zeit nach Buenos Aires gereist war. Dort hatte er das Militär zur gewaltsamen Unterdrückung links orientierter Dissidenten beglückwünscht, von denen Zehntausende durch die militärischen Todesschwadrone gefoltert und getötet wurden. Bergoglio sah in den Lefrebvristen Anhänger der Junta.
Ebenso wenig begeistert war Bergoglio von einer weiteren Aktion des Papstes, der noch im selben Jahr versuchte, die unzufriedenen Traditionalisten in der Anglikanischen Kirche davon zu überzeugen, „den Tiber zu durchschwimmen“, also das Lager zu wechseln. Nicht lange nach seiner Amtseinführung telefonierte der Kardinalerzbischof von Buenos Aires mit seinem anglikanischen Amtsbruder Gregory Venables, dem Bischof von Argentinien und damaligen Primas der Iglesia Anglicana del Cono Sur, und lud ihn zum Frühstück ein. Venables sagte später, Bergoglio habe ihm gegenüber „sehr klar formuliert, dass das Ordinariat ganz unnötig war und dass die Kirche uns als Anglikaner braucht“.
Unterschiedliche Standpunkte vertraten der Papst und Bergoglio auch in Bezug auf das Zweite Vatikanische Konzil und dessen Vermächtnis. Trotz aller Lippenbekenntnisse zum II. Vatikanum war Benedikt XVI. ebenso deutlich wie sein Vorgänger Johannes Paul II. der Ansicht, dass viele der damaligen Reformen zu weit gegangen waren. Beide taten sie ihr Bestes, um den Schwung und die Erwartung zu dämpfen, die der Geist des Konzils innerhalb der Kirche bewirkt hatte. Mit zunehmendem Alter zog sich Benedikt noch weiter zurück in seine eigene geistliche Welt in den Grenzen der traditionellen Formen der Liturgie, des gregorianischen Gesangs, der lateinischen Sprache und des monarchischen Ornats der vorkonziliaren Kirche. Seine Entscheidung, schnellstmöglich die Weichen für eine Heiligsprechung von Papst Johannes Paul II. zu stellen, war zu einem Teil der Versuch, das Erbe der Vergangenheit zu festigen und zu erhalten. In Buenos Aires indes feierte der Kardinal der Stadt die Liturgie auch weiterhin auf eine freie und offene Weise in zeitgemäßen Messgewändern und legte im Umgang mit der Gemeinde Wert darauf, die einfachen Leute anzusprechen und die Verbindung mit ihnen zu stärken. Radikale Traditionalisten in Buenos Aires beklagten sich, Bergoglio habe das Lesen der Lateinischen Messe derart mit Vorschriften belegt, dass diese so gut wie gar nicht mehr stattfand. Priestern, die die Einschränkungen missachteten, wurde persönlich Einhalt geboten durch den Mann, der das II. Vatikanum später als „ein großes Werk des Heiligen Geistes“ bezeichnen und darauf bestehen wird, dass „sich das Rad der Zeit nicht zurückdrehen“ lässt.
Was den sexuellen Missbrauch durch Priester und die priesterliche Pädophilie anbelangte, steuerten die beiden Männer einen ähnlichen Kurs. Doch selbst darin wichen sie in einem Punkt nicht unwesentlich voneinander ab. Während der gesamten Amtszeit Benedikts als Papst wurden immer wieder Missbrauchsvorwürfe gegen Priester laut, und in allen Fällen ließ die Amtskirche eine angemessene Reaktion vermissen. Immer neue Meldungen versetzten der moralischen Autorität der Kirche in der restlichen Welt jedesmal einen Schlag. Benedikt verfolgte eine strengere Linie als sein Vorgänger Papst Johannes Paul II., unter dem die Kurie Serientäter wie etwa den mexikanischen Gründer der „Legionäre Christi“ Marcial Maciel schützte. Eine von Benedikts ersten Amtshandlungen bestand darin, Maciel aus dem aktiven Dienst zu entfernen und zu verfügen, dass er seine restlichen Tage mit Beten und Büßen zubringen sollte. In seinen späten Jahren als Kardinal Ratzinger hatte er darauf gepocht, dass jeder Missbrauchsvorwurf gegen einen Priester an ihn persönlich weitergeleitet werden sollte. Er befasste sich jede Woche persönlich mit diesen Fällen, immer freitags oder, wie er sagte, an den „Bußfreitagen“. Er war viel entschiedener im Umgang mit pädophilen Priestern und anderen Missbrauchstätern aus den Reihen der Kirche, als gemeinhin angenommen wurde. Dennoch teilte er die alten Instinkte der Kirche in puncto privates Tun und öffentliche Verschwiegenheit. Obwohl er sich während seiner Auslandsreisen in einem Land nach dem anderen öffentlich entschuldigte und sich an jedem Ort bemühte, mit den Opfern solcher Verbrechen zusammenzutreffen, agierte er zumeist hinter verschlossenen Türen. So verfestigte sich der Eindruck, dass die Kirche auch weiterhin mehr auf ihre Selbsterhaltung als Institution bedacht war als auf die Verkündigung der Werte des Evangeliums.
Der Kardinalerzbischof von Buenos Aires war insgesamt zupackender. Ihm war es wichtig, von vornherein klarzustellen, dass zwischen Zölibat und Pädophilie keine Verbindung bestehe. „Es gibt Perversionen der Seele, die schon vor der Entscheidung für ein Leben im Zölibat da waren“, machte er deutlich. „Wenn ein Priester pädophil ist, dann war er das schon, bevor er Priester wurde.“ Und er wartete auch mit einer Statistik zu seinen Äußerungen auf, nach der „70 Prozent der Fälle von Pädophilie im familiären und nachbarschaftlichen Umfeld geschehen: durch Großväter, Onkel, Stiefväter, Nachbarn“. Unabhängig davon aber vertrat er vehement eine Politik der Nulltoleranz. Wenn ein Priester jemanden missbraucht, „darf man nicht zur Seite schauen. Man kann nicht eine Machtposition einnehmen und diese Macht dann einsetzen, um das Leben eines anderen Menschen zu zerstören.“
Die Versuche vonseiten der Kirche, das Problem zu vertuschen, waren nach Ansicht Bergoglios ebenso falsch wie kontraproduktiv. Anders als manche andere halte er nichts davon, „einen gewissen Korpsgeist zu pflegen, um so zu verhindern, dass das Image der Institution Schaden nimmt“, erklärte er. „Die Priester in eine andere Pfarrei zu versetzen, […] ist keine Lösung […], weil sie das Problem auch weiter mit sich rumtragen.“ Argentinien ist von keinem so großen Missbrauchsskandal getroffen worden, wie sie andernorts zu verzeichnen waren. Seit 1987 ist gegen vergleichsweise wenige 23 Priester wegen sexuellen Missbrauchs ermittelt worden, und Bergoglio selbst hatte keinen Fall in seiner Erzdiözese. Dennoch gab er anderen Bischöfen einen eindeutigen Rat: „Einmal rief mich ein Bischof an, um zu fragen, was man in einer solchen Situation tun solle. Ich sagte ihm, er solle dem Priester die kanonischen Lizenzen entziehen, ihm nicht länger gestatten, das Priesteramt auszuüben, und ein kirchenrechtliches Verfahren beim entsprechenden Diözesangericht einleiten.“ Vielen Unterstützergruppen von ehemaligen Opfern reicht das nicht aus. Wenn es nach ihnen ginge, sollte der Priester bei der Polizei angezeigt und nicht bloß vor ein kirchliches Gericht gebracht werden. Dessen ungeachtet, war Bergoglios Herangehensweise ein wichtiger Schritt hin zu mehr Offenheit und ganz im Sinne der Nulltoleranz. Auch beim Thema des sexuellen Missbrauchs von Kindern in der gesamten Gesellschaft nahm er kein Blatt vor den Mund und bezeichnete Buenos Aires wegen der Prostitution und des Menschenhandels in der Stadt als „Fleischwolf“.
Als Benedikt 2005 zum Papst gewählt worden war, hofften viele, dass er das Notwendige tun und die Kurie reformieren würde, die in den 26 Jahren des Pontifikats Johannes Pauls II. ungehemmt angewachsen war. Papst Paul VI. war der letzte Pontifex gewesen, der es geschafft hatte, die Kurie mit ihrem Staatssekretariat, ihren neun Kongregationen, drei Tribunalen, elf päpstlichen Räten und verschiedenen anderen Dienststellen zur Unterstützung des Papstes richtig zu führen. Die Behörde seines Ersten Ministers, das Staatssekretariat, und verschiedene andere Ämter des Vatikans stattete er mit beträchtlicher Macht aus; allerdings veranstaltete er regelmäßige Pflichttreffen der Leiter der unterschiedlichen Kurienbehörden und lehnte den Kirchenstaat damit an den säkularen Typ der Kabinettsregierung an. Diese Praxis aber war unter Johannes Paul II., der den Leitern der unterschiedlichen Ämter gestattete, sie wie unabhängige Lehen zu verwalten, hinfällig geworden. So irritierte es Bergoglio, dass seine Empfehlungen von der Bischofskongregation des Vatikans regelmäßig übergangen wurden.
Papst Johannes Paul II. hatte zwar ausgiebig die Welt bereist, die Regierungsgeschäfte jedoch arg vernachlässigt. Beim Konklave nach seinem Tod trugen sich daher viele Kardinäle mit der Hoffnung, dass ein linientreuer Insider mit den bestehenden Problemen fertigzuwerden wüsste. Doch weit gefehlt: Der Verfall des Systems setzte sich vielmehr auch unter Benedikt XVI. fort. Er brachte seine Anhänger in Positionen mit behördlichen Machtbefugnissen, und zwar, weil er sie kannte und ihnen vertraute, nicht, weil sie die nötigen Fähigkeiten für die Aufgabe gehabt hätten. Sein Staatssekretär Tarcisio Kardinal Bertone sollte sich während der Generalkongregationen von 2013 ungewöhnlich offener Kritik vonseiten der Kardinäle ausgesetzt sehen. Er galt als Abnicker ohne diplomatische Erfahrung oder Redegeschick, der seine Hauptaufgabe darin sah, den Papst vor schlechten Nachrichten zu schützen. Während Benedikt weiterhin Bücher schrieb und im Stillen für sich betete, betrieben die verschiedenen Behörden der Römischen Kurie Politik und verwalteten die unterschiedlichen Bereiche der Kirche ohne Konsultation oder Koordination. Der eine oder andere Leiter einer Behörde führte sich auf wie ein mittelalterlicher Baron, war eifersüchtig auf seine Autonomie bedacht und verstimmt, wenn er eine Einmischung witterte. Statt die Kurie zu reformieren, vernachlässigte Benedikt sie einfach.
Irgendwann wurde all das dem deutschen Papst zu viel. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich: Sein Hörvermögen hatte gelitten, und mit dem linken Auge konnte er nicht mehr sehen. Er war so abgemagert, dass die Schneider kaum nachkamen mit dem Anpassen neuer Kleider. Ende 2012 ließ sich sein Biograf, der deutsche Journalist Peter Seewald, vernehmen, er habe den Papst noch nie so erschöpft und niedergeschlagen gesehen. Im März des Jahres war Benedikt auf einer Reise nach Mexiko und Kuba in seinem Zimmer ins Straucheln gekommen und gestürzt, wobei er mit dem Kopf auf einem Waschbecken aufschlug. Der Unfall wurde vom Vatikan geheim gehalten, doch für den nachlassenden Papst war es ein ausschlaggebender Moment. Nach seiner Rückkehr von der äußerst strapaziösen Reise vertiefte er sich ins Gebet und verbrachte viele Stunden vor dem großen Bronzechristus, der von der Wand seiner kleinen Privatkapelle in seinen Wohnräumen im Apostolischen Palast herabblickte. Ihm war noch vor Augen, wie Johannes Paul II. sich entschieden hatte, im Licht der Öffentlichkeit zu sterben; atmosphärisch hatte jene letzten Sterbetage etwas beinah Karnevaleskes umgeben, womit der strenge und zurückhaltende Mann aus Bayern überhaupt nicht einverstanden war. Nach langem Beten entschloss er sich zu einem Schritt, den seit 598 Jahren kein Papst mehr unternommen hatte. Damals hatte Papst Gregor XII. abgedankt, um dem westlichen Schisma zwischen rivalisierenden Päpsten und Gegenpäpsten – jeder von unterschiedlichen Lagern und Königreichen innerhalb der katholischen Kirche anerkannt – ein Ende zu setzen. Benedikt würde auf sein Amt verzichten und zurücktreten.
Lange Zeit behielt er diese Entscheidung für sich. Er wollte einen günstigen Zeitpunkt für die Bekanntgabe finden, um der Kirche unnötige Turbulenzen zu ersparen und sie in ihrem liturgischen Leben nicht mehr als nötig zu stören. Nach Pfingsten oder vor der Fastenzeit schienen passende Zeitpunkte zu sein. Doch noch bevor er der Welt die Neuigkeiten bekanntmachen konnte, wurde die Kirche, die seit Jahren schon wankte und von einer Krise in die andere schlitterte, von neuen dramatischen Entwicklungen heimgesucht. Sie erschütterten Benedikts ohnehin schon brüchig gewordene Zuversicht in ihren Grundfesten.
Am 23. Mai 2012 wurde der Kammerdiener des Papstes Paolo Gabriele unter dem Vorwurf verhaftet, er habe sensible Unterlagen vom Schreibtisch des Papstes gestohlen und sie an die Presse weitergespielt. Gabriele gehörte zu einer Handvoll von Leuten, die einen Schlüssel zu dem Fahrstuhl hatten, der in die privaten Wohnräume des Papstes führte. Seit sechs Jahren war er Benedikts Kammerdiener gewesen. Der Papst, so behaupteten Eingeweihte, sah ihn wie einen Sohn an. Der Verrat war niederschmetternd.
Viele Medien berichteten über die Affäre wie über einen lustigen Streich. „What the Butler Leaked“ („Was der Diener durchsickern ließ“) war als Schlagzeile einfach zu verführerisch. Doch als Gabriele verurteilt wurde, begriff jeder, der die Gerichtsverhandlung eingehender verfolgte, dass die Sache in ganz anderer Hinsicht niederschmetternd war. Gabriele hatte einem Journalisten Papiere zugespielt, die vernichtet werden sollten und vom Papst entsprechend gekennzeichnet waren. Aber er hatte das nicht getan, um sich zu bereichern, sondern aus einem Gefühl für die Missachtung der Loyalität heraus; er sorgte und beunruhigte sich über das Ausmaß, in dem Untergebene den Papst hinters Licht führten.
Die an die Öffentlichkeit gelangten Unterlagen brachten skandalöse Intrigen und interne Machtkämpfe ans Licht – Ehrgeiz und Arroganz, Gier und Ruhmsucht, Karrierismus und Korruption unter der Geistlichkeit, Geheimhaltung und sexuelle Vergehen in der Beamtenschaft des Vatikans. Und sie zeigten den Papst als einen Intellektuellen, der sich unwohl fühlte mit dem Tagesgeschäft der Kirche und darum nichts dagegen unternahm, dass er immer weiter in die Isolation geriet. Der Kammerdiener war weniger ein Verräter als vielmehr ein Whistleblower, ein Enthüller.
Die Geschichte, die da zum Vorschein kam, handelt von einem Papst, der von Menschen, die ihm eigentlich zu Diensten sein sollten, langsam ausmanövriert und ins Abseits gedrängt worden war. Das hatte mindestens fünf Jahre zuvor angefangen, als Benedikt sich dazu bringen ließ, einen Kurienreformer, Erzbischof Carlo Maria Viganò, den damals zweithöchsten Regierungsbeamten der Vatikanstadt, wegzuschicken und zum Apostolischen Nuntius in den Vereinigten Staaten zu machen. Viganò war resolut gegen die internationalen Verschwendungs- und Korruptionspraktiken vorgegangen, die den Heiligen Stuhl Millionen an höheren Lieferpreisen kosteten. Aufträge wurden gewohnheitsmäßig an dieselben Firmen vergeben – zur doppelten Höhe der handelsüblichen Kosten. Bei einem der an die Öffentlichkeit gelangten Briefe handelte es sich um die von Viganò an den Papst gerichtete Bitte, sein Amt so lange weiterführen zu dürfen und nicht eher versetzt zu werden, bis seine Arbeit getan sei. Viganò wurde jedoch Opfer einer Verleumdung vonseiten seiner Widersacher, die den Papst dazu brachten, ihn nach Washington zu versetzen, wo er ihnen nicht mehr im Wege war. Andere Dokumente, die im Zusammenhang mit der von den Medien „Vatileaks“ getauften Affäre veröffentlicht wurden, brachten die Bestrebungen bestimmter Interessensgruppen zutage, den Bemühungen zur Reformierung der Vatikanbank durch eine größere Transparenz der Finanzen und das Einhalten internationaler Normen für die Bekämpfung von Geldwäsche entgegenzuwirken. Es hieß auch, dass vermögende Personen und Organisationen hohe Summen gezahlt hätten, um sich eine päpstliche Audienz zu sichern.
Die Affäre machte dem Papst schwer zu schaffen. „Danach war er nicht mehr derselbe“, meinte einer seiner Vertrauten. Benedikt berief eine Untersuchungskommission von drei Kardinälen ein, die sich mit dem Fall befassen und die undichten Stellen ermitteln sollten. Am 17. Dezember 2012 händigten sie ihm ihren Bericht aus. Er verschloss ihn in seinen Wohnräumen in einem Safe und verwahrte ihn dort für seinen Nachfolger, damit der sich damit befasste. Dann besuchte der Papst den seit seiner Verurteilung im Oktober inhaftierten Kammerdiener im Gefängnis und vergab ihm. Drei Tage vor Weihnachten wurde Gabriele freigelassen.
Doch falls die eigennützigen Behördenvertreter des Vatikans geglaubt hatten, ihr fest verwurzelter Widerstand habe Benedikt XVI. in die Knie gezwungen, so irrten sie sich. Am Vormittag des 11. Februar 2013 versammelte sich kurz nach halb zwölf eine Gruppe von Kardinälen in der Sala del Concistoro im Apostolischen Palast, wo der Papst eine neue Kollektion von Heiligen bekanntgeben wollte. Er redete Lateinisch und viele der Kardinäle schweiften mit ihren Gedanken so weit ab, dass ihnen entging, was Benedikt außerdem noch sagte. Er hatte die 350 Wörter umfassende Erklärung selbst verfasst und die Grammatik durch einen Lateinspezialisten im Staatssekretariat auf ihre Richtigkeit hin prüfen lassen. Der Übersetzer war zu Verschwiegenheit verpflichtet worden. Nun las Benedikt die Wörter in der toten Sprache mit schwacher, aber doch fester Stimme. Um die Kirche leiten zu können, so hieß es, „ist sowohl die Kraft des Körpers als auch die Kraft des Geistes notwendig – eine Kraft, die in den vergangenen Monaten in mir derart abgenommen hat, dass ich mein Unvermögen erkennen muss, den mir anvertrauten Dienst weiter gut auszuführen“. Die Kardinäle tauschten stumme Blicke aus, unsicher über das Gehörte, während der Pontifex den Raum verließ.
Die Nachricht von Benedikts Rücktritt kam so überraschend, dass Kardinal Scola, der inzwischen nach Mailand befördert worden war, ihr keinen Glauben schenken wollte, als ein römischer Offizieller ihn von den Neuigkeiten telefonisch in Kenntnis setzte. Benedikt hatte beschlossen, dass im Vatikan Köpfe rollen sollten. Er war sich aber auch im Klaren darüber, dass er mit den operativen Abläufen nicht ausreichend vertraut war, um zu wissen, wie er sich der machiavellistischen Figuren entledigen konnte, die ihn seit Jahren hintergangen hatten. Also ließ er sich eine Antwort einfallen, die keiner von ihnen hätte vorausahnen können: Es sollte sein eigener Kopf sein, der rollen würde. Mit diesem Kunstgriff setzte er seine Gegner völlig außer Gefecht.
Es ist gut möglich, dass der Rücktritt Benedikts XVI. als die prägende Tat seines Pontifikats in die Geschichte eingehen wird – und als der größte Dienst, den er der Kirche erwiesen hat. Indem er zum ersten Papst der Neuzeit wurde, der zurückgetreten ist, definierte er das Papstamt neu und machte aus ihm statt einer Berufung eine Arbeit – eine Arbeit mit speziellen Aufgaben und Zielen, die mit Anstand niedergelegt werden kann, wenn die Zeit dafür da ist. Er hat einen Maßstab gesetzt, und zukünftige Päpste werden sich die Freiheit nehmen oder womöglich sogar unter Druck kommen zurückzutreten, wenn deutlich werden sollte, dass sie der Arbeit nicht gewachsen sind. Benedikts letzte Amtshandlung könnte sich als diejenige erweisen, mit der er das Amt am meisten modernisierte.
Hätten sich die Dinge anders entwickelt, wenn das Dossier, mit dem die Wahl Bergoglios verhindert werden sollte, nicht verschickt worden wäre? Vielleicht wäre ein Außenstehender der Kurie als Papst eher in der Lage gewesen, sich gegen die Machenschaften zur Wehr zu setzen. Ein Mann, der seine Erzdiözese mehr als ein Jahrzehnt lang auf die ihm eigene Art geleitet hatte, hätte durchaus erreichen können, was sich für einen Mann als unmöglich erwies, der Jahrzehnte damit zubrachte, als treu ergebener Stellvertreter eines charismatischen Oberhauptes wie Johannes Paul II. zu wirken. Jorge Mario Bergoglio war unterdessen von Erfolg zu Erfolg geeilt. Keine sechs Monate nach dem Konklave von 2005, aus dem er als zweiter Sieger hervorgegangen war, wurde er zum Vorsitzenden der argentinischen Bischofskonferenz gewählt. Zwei Jahre später bestimmte man ihn zum Leiter der Redaktionskommission der Vollversammlung aller Bischöfe seines Kontinents in Aparecida und übertrug ihm die Aufgabe, das Schlussdokument des Treffens zu verfassen. In diesem Dokument wird beklagt, dass der Glaube, der das Leben in Lateinamerika seit fünf Jahrhunderten beseelt und angetrieben habe, durch das Fortschreiten der Säkularisierung auf dem Rückzug sei. Nachdrücklich bekräftigt wird „die vorrangige Option für die Armen“, die ebenjene Bischöfe und ihre Vorgänger auf den wegweisenden Generalversammlungen der lateinamerikanischen Bischofskonferenz CELAM 1968 in Medellín und 1979 in Puebla beschlossen hatten. „Wir leben in dem von der allergrößten Ungleichheit geprägten Teil der Welt, der am meisten angewachsen ist, während das Elend am wenigsten gemindert wurde“, hielt Bergoglio fest. „Die durch die anhaltende Ungerechtigkeit bei der Verteilung der Güter heraufbeschworene Situation ist eine gesellschaftliche Sünde, die zum Himmel schreit – und so vielen unserer Brüder die Möglichkeit eines erfüllteren Lebens vorenthält.“
Gegen dieses Übel rief die Versammlung in ihrem Abschlussbericht dazu auf, „die Kultur der Armen“ in den Mittelpunkt zu stellen und all die „morsch gewordenen Strukturen, die der Weitergabe des Glaubens nicht mehr dienen, aufzugeben“. Die Menschen Südamerikas würden die Frohe Botschaft „nicht aus dem Munde trauriger und mutlos gemachter Verkünder hören, die keine Geduld haben und ängstlich sind“, sondern von Geistlichen, von „Dienern des Evangeliums, die als Erste[s] die Freude Christi in sich aufgenommen haben“. Damit waren Bischöfe gemeint, die die ihnen anvertrauten Menschen tagtäglich auf ihren Lebenswegen begleiten, Priester, die in ihren Gemeinden kein abgesondertes Leben führen, sondern auf den Straßen, in Suppenküchen, in Schulen und an all den zahllosen Orten zu finden sind, wo soziale und gemeinnützige Arbeit geleistet wird und wo sie tatsächlich in Berührung kommen mit dem Kampf der Menschen ums Fortkommen. „Allein in den konkreten Umständen des täglichen Lebens“, so schließt das Dokument, „kann man den Glauben an die lebendige Gegenwart Christi und die Freude an ihr teilen und nachempfinden.“
Die Konferenz dauerte drei Wochen, aber nur eine Predigt sorgte in dieser Zeit für Applaus. Er erklang an dem Tag, den Jorge Mario Bergoglio für seine Messfeier ausgewählt hatte. Während der Konferenzpausen fanden die anderen Teilnehmer heraus, dass der Kardinal sprechen werde, und sie richteten ihre Fotoapparate auf ihn, ganz so, wie man es von Auftritten Prominenter kennt. Allerdings trat hier kein Rockstar und keine Sportlegende in Erscheinung, sondern ein Mann, welcher der Kirche eine neue Vision beschert hatte – eine Kombination aus sozialer Gerechtigkeit, der Kultur der Armen und der Verkündigung der Frohen Botschaft an die Menschen außerhalb der Kirche. Gerade als Papst Benedikt die Kräfte verließen, eilte Bergoglio von Erfolg zu Erfolg.
Vielleicht war er insgeheim dankbar für die glückliche Fügung, dass nicht ihm der vergiftete Kelch Benedikts XVI. gereicht worden war. Vielleicht dachte er auch daran, wie anders alles gekommen wäre, wenn das Konklave von 2005 zu einem anderen Resultat geführt hätte. Seine Freunde sind sich da nicht so sicher. „Die Nachfolge Johannes Pauls II. anzutreten war alles andere als eine leichte Aufgabe“, sagte mir ein Kardinal. „Vielleicht hielt der Heilige Geist sich zurück, bis das Haus zusammenbrach und uns um die Ohren flog. Gott kann gut auf krummen Zeilen gerade schreiben.“
Während seiner weiteren Besuche in Rom logierte Bergoglio in der Klerikerunterkunft „Domus Internationalis Paulus VI“ in der Via della Scrofa im Herzen Roms, so, wie er es immer getan hatte. Die Böden dort sind aus Marmor, die Zimmer dagegen spartanisch eingerichtet. Das Haus liegt in einiger Entfernung zum Vatikan, doch dieser Weg gab Bergoglio die Möglichkeit, durch die kopfsteingepflasterten Seitenstraßen zu gehen, vorbei an den Geschäften und Bars, Wohnhäusern und Banken, Monumentalbauten und Kirchen, in denen die Menschen der Stadt und ihre Besucher ihr tägliches Leben lebten – mit seinen lästigen Pflichten und Plagen, den kleinen Gesten der Freundlichkeit und Liebe. Sein dunkler Mantel bedeckte sein Brustkreuz, und er vermied es, sein rotes Kardinalskäppchen zu tragen. Aber er war unter den Menschen. Wenn er von den Treffen im Vatikan zurückkehrte, aß er am gemeinsamen Tisch mit den anderen Geistlichen, die in der Stadt zu Besuch waren. Die meisten warfen ihm höchstens einen Blick zu. Sie wussten: Er war der knapp Gescheiterte, der 2005 im Alter von 68 Jahren seine Chance verpasst hatte. Man bekommt keine zweite Chance, ist es nicht so?
„Damals, 2005, das war nicht sein Moment“, stellte ein enger Freund in Buenos Aires fest, der jetzt jeden Sonntagnachmittag von Bergoglio aus Rom angerufen wird. „Die Dinge mussten noch viel schlechter werden für die Kirche, ehe sie mutig genug war, Bergoglio zu wählen. Gott weiß, was er tut.“