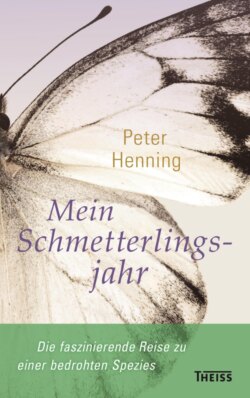Читать книгу Mein Schmetterlingsjahr - Peter Henning - Страница 10
ОглавлениеApostolos Fotakis ist für die Instandhaltung und die Reinigung und Pflege der Außenanlage des „Kerveli Village“ zuständig. Er trägt durchgewetzte, ausgebleichte Latzhosen, darunter ein helles T-Shirt. An den Füßen leichte, ebenfalls blaue Segeltuchschuhe, auf dem Kopf eine Schirmmütze, die sein faltiges Gesicht ein Stück weit verschattet. „Schmetterlinge machen mir Angst!“, sagt Apostolos und sieht mich skeptisch an, als ich ihm erzähle, was mich nach Samos geführt hat. „Ich mag ihr Geflatter nicht. Ist mir irgendwie unangenehm.“
„Aber wieso denn?“, erwidere ich. „Schmetterlinge sind die harmlosesten Wesen überhaupt.“
„Vielleicht. Ich finde sie ja auch schön, aber ich will nicht, dass sie mir zu nahe kommen! Außerdem heißt es, sie verkörpern die Seelen der Toten! Hab ich jedenfalls mal irgendwo gehört“, beharrt Apostolos auf seiner Sicht der Dinge.
„Die Mexikaner glauben das von den Monarchfaltern!“, sage ich und sofort treten mir die Millionen von schwarz-orangenen Danaus plexippus vor Augen, die alljährlich im Oktober, am Tag der Toten, in die mexikanische Sierra einfallen und dort ein einzigartiges Naturschauspiel vollführen.
Wenn die Falter im Bergwald von Mexiko eintreffen, haben sie eine bis zu 4000 Kilometer lange Reise hinter sich. Viele kommen nicht an, fallen unterwegs Stürmen und Wolkenbrüchen zum Opfer. Die meisten der kleinen Wanderer stammen aus dem Mittleren Westen, aus Neuengland und sogar aus Kanada. Lange hat man darüber gerätselt, wie die Falter Jahr um Jahr aufs Neue ihr Ziel finden. Ob sie irgendwelchen geheimen Navigationshilfen folgen. Oder ob ihnen die Route in die mexikanische Sierra Nevada womöglich seit Jahrtausenden in ihren genetischen Code eingeschrieben ist.
2014 gelang es dem Chicagoer Genforscher Marcus Kronfort, das Geheimnis der Monarchfalter teilweise zu entschlüsseln. Mithilfe aufwendiger Gen-Sequenzierungen entzifferten er und seine Mitarbeiter das Erbgut von 101 Faltern und blickten auf ihrer Suche nach Antworten zwei Millionen Jahre zurück, bis zu jenem Punkt, an welchem nach heutigem Stand der Forschung die Ahnen der Monarche erstmals aufgetreten sind, und zwar in Lateinamerika.
Was sie dabei herausfanden, ist ebenso faszinierend wie banal: Ausgestattet mit einem ureigenen Wandertrieb verfügen bestimmte, nicht sesshafte Exemplare über einen ganz erstaunlich belastbaren Muskelapparat, der es ihnen ermöglicht, extrem weite Strecken zurückzulegen. Da die Monarchfalter-Raupen ausschließlich Seidenpflanzen verspeisen, richteten diese Falter von einem gewissen Zeitpunkt an ganz selbstverständlich ihre Flugziele nach deren Standorten aus – und die Besiedlung pflanzenreicher Regionen wie etwa der amerikanischen Prärie begann.
Die Forscher verglichen nun Tiere an verschiedenen Orten. Dabei zeigte sich, dass ein sogenanntes Collagen-Gen eine wesentliche Rolle bei der Ausbildung ihrer Flugmuskeln spielt. Standorttreue Falter, so fand Kronfort heraus, flattern zwar kräftig, aber sehr energieaufwendig. Ihre wandernden Artgenossen dagegen gehen mit ihrer Energie deutlich sparsamer um. Ihr effizienter Flugstil ermöglicht es ihnen, riesige Strecken zurückzulegen. Wie die Tiere allerdings über mehrere Tausend Flugkilometer hinweg ihr Ziel finden, das ließ sich anhand des Erbguts nicht herausfinden. Wahrscheinlich folgen die Falter tatsächlich einer Art innerem Navi, einer ihrer Art offenbar fest einprogrammierten Reiseroute.
„Interessant, was Sie da erzählen, auch wenn ich nur die Hälfte verstanden habe!“ Apostolos schiebt seine Mütze ein Stück aus der glänzenden Stirn und stützt sich auf seinen Besen.
„Ja“, sage ich. „Sie sind wahre Meister der Navigation!“
„Scheint so“, bekennt er, zieht die Mütze wieder tiefer in das Gesicht, packt seinen Besen und stampft ungeduldig damit auf. Seine sonnengebräunte Haut ist durchzogen von winzigen Falten und seine Lippen sind aufgesprungen, als sei er lange Zeit durch hitzeflirrende Ebenen gewandert. Doch seine wasserblauen Augen lassen ihn seltsam alterslos erscheinen.
„Ich geh jetzt wieder raus in die Phrygana und schaue mich um. Und heute Abend erzähle ich Ihnen, was ich alles gesehen hab, okay?“, verspreche ich, als legte er Wert auf meine Berichte. „So, wie Vladimir Nabokov es immer gemacht hat, wenn er von seinen Fangzügen ins Montreux Palace zurückkehrte, in die Hotelbar La Rose d´Or ging und dem Barkeeper Antonio Triguero seine Fundstücke präsentierte.“
„Okay“, sagt Apostolos und lächelt verlegen.
„Kennen Sie Nabokov?“, frage ich noch.
„Nein“, gesteht Apostolos, „leider nicht.“
Ich ziehe die Krempe meines Panamas tiefer in die Stirn und laufe los. Es muss die Erinnerung an die italienische Riviera gewesen sein, an der Nabokov als Kind die Ferien verbrachte, die ihn dazu bewog, sich in den 1960er-Jahren am Genfer See niederzulassen. Nach zwanzigjähriger Lehrtätigkeit in den USA und dem Erfolg seines Romans Lolita, der ihm fortan eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit garantierte, war der am 23. April 1899 als ältester Sohn einer wohlhabenden St. Petersburger Familie geborene Schriftsteller 1961 seinen großen schreibenden Landsleuten gefolgt und wie Gogol, Dostojewski oder Tolstoi an die „Perle de la Riviera Suisse“ übergesiedelt. Die mediterrane Fauna versprach dem passionierten Schmetterlingssammler aufregende Stunden.
„Wenn er von seinen Ausflügen zurückkehrte, ließ er uns regelmäßig seine Fänge begutachten“, erinnerte sich Antonio Triguero vor Jahren in einem Gespräch mit mir an den mit Shorts, Bergstiefeln, Kniestrümpfen und einem Regencape bekleideten Nabokov, dessen Leben bis zuletzt im Zeichen der Schmetterlinge, des Schachspiels und des Schreibens stand.
Nabokov liebte die Schweiz, liebte ihre alpinen Wiesen mit den nur dort fliegenden Faltern und die spektakulären Sonnenuntergänge, die er vom Balkon seines Seeblickapartments aus beobachten konnte. In ihrem Verlangen nach Anonymität und Diskretion hatten die Nabokovs nach ruhelosen Jahren in Berlin, Paris und Amerika in Montreux einen Platz gefunden, der ihnen sowohl die Nähe zu ihrem einzigen Sohn Dmitri als auch jenes Umfeld bot, das Beschaulichkeit und Kontinuität versprach. Und sofort war der Dichter von den charakteristischen Gegensätzen der Region gefangen: hier die alpine Grandezza von Montreux und die Lieblichkeit der Schweizer Riviera, dort die Herausforderungen, die sich dem passionierten Lepidopterologen Nabokov auf stundenlangen Jagden stellten. Man kann sich leicht vorstellen, wie er entlang der Berghänge geschritten sein muss, auf der Jagd nach einem Schwarzen Apollofalter.
Die Sonne hat inzwischen fast wieder ihren höchsten Punkt erreicht. Zwischen den knorrigen Bäumen flattern mehrere Kleine Kohlweißlinge über die Blüten. Wenn ich Glück habe, zeigen sich wieder ein paar Falsche Apollos. Schön wäre auch die Begegnung mit einem Südlichen Zitronen- oder Kle-opatra-Falter (Gonepteryx cleopatra). Dieser ähnelt in Erscheinungsform, Spannweite (50 bis 55 Millimeter) und Größe sehr dem klassischen Zitronenfalter (Gonepteryx rhamni), wie wir ihn aus unseren Feldern und Wiesen kennen. Doch im Unterschied zu seinem nächsten Verwandten sind die Vorderflügel des Kleopatra-Falters leuchtend orange gefärbt.
Vorsichtig taste ich mich durch die Phrygana, denn im kniehohen Dickicht verborgen lauern Schlangen: Sandboas, Ringel- und Balkanspringnattern, aber auch sogenannte „Wurmschlangen“ wie das Blödauge, die allerdings nur nach starken Regenfällen an die Oberfläche kommen, um Ameisen zu jagen. Phrygana nennen die Griechen das niedrige, immergrüne Busch- und Strauchwerk, das große Teile von Samos und anderer Mittelmeeranrainer überzieht. Die hüfthohen holzigen Sträucher sind durchsetzt von zahlreichen Kräutern wie Wacholder, Oregano, Lavendel oder Majoran, deren intensive Düfte sich über den Hügeln halten. Vielen Schmetterlingsarten dienen die oft dornigen Büsche als Futterpflanzen.
Tatsächlich ist es wieder genauso, wie es der britische Schriftsteller John Fowles in seinem berühmten Roman Der Sammler, der in meinem Hotelzimmer auf dem Nachttisch liegt, beschrieben hat: „Und dann war es plötzlich soweit, so wie es einem mit den Schmetterlingen passiert. Man geht an eine Stelle, von der man weiß, es könnte dort höchst seltene Exemplare zu sehen geben, sieht aber nichts. Und wenn man gar nicht mehr darauf gefasst ist, stolpert man beinahe drüber.“ Denn auf einmal erscheint wie aus dem Nichts ein prächtiger Südlicher Schwalbenschwanz (Papilio alexanor) zwischen den Bäumen und ich halte wie elektrisiert in meiner Vorwärtsbewegung inne. Bislang kannte ich diesen Schmetterling nur aus Filmen und von Aufnahmen her.
Der Südliche Schwalbenschwanz ist einer, der es gern warm und trocken hat. Am liebsten besucht er sonnige, blumenreiche Hänge, durchsetzt mit schroffen Geröllflächen. In den frühen Morgenstunden kann man diesen am Tag schnell und unruhig fliegenden Falter starr und mit reglos ausgebreiteten Flügeln auf Blumen sitzend vorfinden. Dann sind beide Fühler in Verlängerung seines schlanken Körpers reglos und parallel zueinander wie Antennen ausgestreckt. Normalerweise fliegt der Falter nur in einer Generation zwischen Mai und Juli, weshalb es sich bei diesem Tier um ein Exemplar handeln muss, das überwintert hat und von der Wärme vorzeitig aus seinem Versteck gelockt wurde.
Genau betrachtet wirkt der Südliche Schwalbenschwanz wie eine Kreuzung aus dem weiter verbreiteten klassischen Schwalbenschwanz, wie wir ihn in Deutschland kennen, und dem Segelfalter, den man vereinzelt im Oberrheintal, an der Mosel, an der Nahe und im Raum Würzburg antreffen kann. Manchmal übrigens schon im März, wenn die Temperatur wohlige 20 Grad erreicht und der Schöngeist sich im warmen, offenen Gelände und am Rand von Steppenheidewäldern zeigt.
Auf den sonnengelben Flügeln des Alexanor finden sich sowohl die für den klassischen Schwalbenschwanz typischen gelben, schwarz abgesetzten Farbquadrate als auch die für den Segelfalter charakteristischen, keilförmigen schwarzen Längsstreifen, die seine Vorderflügel von ihren vorderen Außenrändern einwärts durchziehen.
Meinem ersten Schwalbenschwanz bin ich im Kinderheim in Stadtprozelten begegnet, wo ich meine ersten fünf Lebensjahre verbrachte. Es war 1963 und ich gerade vier Jahre alt. Doch die Erinnerung an den großen senfgelben Falter mit den langgezogenen Spitzen, die den Schwanzfedern von Schwalben ähneln, ist nun, da ich durch das Hinterland von Samos streife und seinen südlichen Verwandten betrachte, so präsent, als müsste ich mich nur kurz umdrehen und alles wäre wieder zum Greifen nah: der weißgetünchte langgestreckte Bau, mit den Schlafräumen, die zum Speisesaal hin abfallenden karminroten Treppenstufen, das durch die dichten Pinienkronen brechende Vormittagslicht eines Sommertages und natürlich die purpurfarbenen Veilchenrabatten, die den Treppenabgang säumten. Darauf saß der mir in meiner Erinnerung plötzlich riesig erscheinende Schwalbenschwanz – ein Wesen, wie mit Buntstiften auf ein violettes Stück Papier gemalt. Die reinste Schönheit! Müsste ich ein persönliches Wappentier benennen, wäre es zweifellos der Schwalbenschwanz.
Später las ich in Nabokovs Autobiografie Erinnerung, sprich, dass auch bei ihm alles mit einem Schwalbenschwanz begann, der sich in sein Zimmer in St. Petersburg verirrt hatte. Als seine Mutter eines Morgens eintrat und die schweren Vorhänge beiseitezog, um ihren Sohn zu wecken, flatterte der Schwalbenschwanz plötzlich aufgeregt durchs Zimmer und der zehnjährige Vladimir war spontan verzaubert von seinem stummen Gast.
Wenn ich im Kinderheim die Treppenstufen hinablief, den Falter im Augenwinkel registrierte und innehielt, war ich gebannt von so viel Anmut. Seither kehren mit schöner Regelmäßigkeit die Erinnerungen an damals zurück, sobald ich einem Schwalbenschwanz begegne.
Der handtellergroße Alexanor, nun keine Armlänge mehr von mir entfernt, besitzt die Nervosität aller Schmetterlinge der Gattung Papilio, die bei der leisesten Störung davonjagen. Anders als der Segelfalter, der gern die Thermik nutzt und sich nur unterstützt von gelegentlichen Flügelschlägen wie schwerelos hinab in die Ebenen tragen lässt, ist der Südliche Schwalbenschwanz ein schneller, hektischer Flieger. Zudem ist er ein überzeugter Einzelgänger.
Seine Raupe ernährt sich genau wie die des Papilio machaon von Dill, wildem Kümmel und Fenchel, weicht aber in ihrer Grundfärbung insofern von dieser ab, als sie deutlich blasser erscheint und manchmal sogar in gelben Varianten auftritt, allerdings ebenfalls durch die vom Machaon bekannten schwarzen Ringe segmentiert. Darin erinnert sie auch an ihre amerikanische Verwandte, die Raupe des in Süd- und Nordamerika beheimateten Schwarzen Schwalbenschwanzes (Papilio polyxenes), die ins Hellgrüne spielt und nur noch rudimentär die dunklen Segmentringflecken aufweist.
Kreuzt ein Weibchen die Flugbahn eines männlichen Südlichen Schwalbenschwanzes, lässt sich dieser gern spontan zu einem sonst vor allem für den Segelfalter typischen Balzverhalten verführen, das „Hilltopping“ genannt wird. Dabei umkreisen sich die gemeinsam schnell aufsteigenden Falter manchmal minutenlang, bis sie plötzlich voneinander ablassen, abzustürzen scheinen und in entgegengesetzte Richtungen schnell davonfliegen.
Ganz vorsichtig nähere ich mich dem Falter noch ein Stückchen. Durch die Überwinterung ist seine Färbung erkennbar ausgebleicht. Während er seinen langen fadendünnen Rüssel in die Blütenkelche taucht, geht immerzu, wie durch schwache elektrische Impulse verursacht, ein rhythmisches Zucken durch seinen Leib.
In seinen stecknadelkopfgroßen schwarzen Facettenaugen spiegelt sich die hoch stehende Sonne als winziger Lichtreflex, so als lenke sie jede seiner Bewegungen wie der Leitstrahl ein Passagierflugzeug beim Landeanflug. Dann streicht ein kurzer Hauch warmer Luft über die Hügel und der Falter hebt ab und lässt sich weitertragen.
In den Besitz meiner ersten Schwalbenschwanz-Puppe gelangte ich durch einen fragwürdigen Handel, der erfreulicherweise unentdeckt blieb: Ich stahl ein paar alte und wahrscheinlich ziemlich wertvolle Thurn-und-Taxis-Briefmarken aus dem Album meines kurz zuvor gestorbenen Großvaters und überließ sie einem älteren Freund, der ebenfalls sammelte und sich genau wie ich für Schmetterlinge und Raupen interessierte. Im Gegenzug händigte er mir seine Schwalbenschwanzpuppe aus, um die ich ihn tagelang beneidet hatte. Ein schlechtes Geschäft, wie sich bald herausstellen sollte, denn die Puppe war ausgetrocknet. Es würde nie ein Falter aus ihr schlüpfen.
Jahrzehnte später habe ich in der Schweiz ein intensives Studium dieser Art von der Raupe bis zum Falter betrieben. Die Raupen des Schwalbenschwanzes, die von den Schweizern verniedlichend „Rübli-Raupen“ genannt werden, sind dort noch in vergleichsweise großer Zahl zu finden, während in Deutschland die Bestände stark zurückgegangen sind. Wenige Wochen nachdem ich in einer Großgärtnerei in Untersiggental, einem Dorf unweit der Kurstadt Baden, ein gutes Dutzend „Rübli-Raupen“ von Fenchelsetzlingen abpflücken durfte, entließ ich gemeinsam mit meinen beiden kleinen Töchtern die ersten frisch geschlüpften Schwalbenschwänze vom Balkon unserer Wohnung in die Freiheit. Meine Töchter hatten stundenlang gemeinsam vor den Zuchtbehältern gesessen und zugesehen, wie die Raupen sich verpuppten. Inzwischen sind die beiden fast erwachsen, die Schwalbenschwänze aber sind, wie sie mir erst kürzlich wieder versicherten, ein unauslöschlicher Teil ihrer Erinnerungen an die Schweiz.
Nach einem anstrengenden Fußmarsch durch die küstennahen Pinienwälder setze ich mich auf einer weitläufigen Lichtung ins kniehohe Gestrüpp, esse eine Kleinigkeit und trinke Wasser. Über mir kreisen kleinere Greifvögel in engen Schleifen, um jeden Moment hinabzustoßen und ihre Beute zu packen. Von der schmalen Schotterstraße, die sich landeinwärts durch die Hügel zieht, dröhnt gedämpft das Brummen eines LKW herüber und vom Meer, das stellenweise blau zwischen den dicht stehenden Baumstämmen aufleuchtet, strömt ein salziger Hauch herauf.