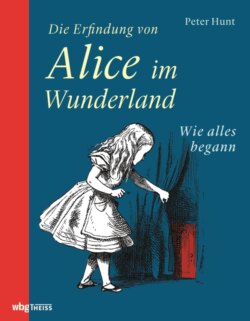Читать книгу Die Erfindung von Alice im Wunderland - Peter Hunt - Страница 8
ОглавлениеVORWORT
„Würdest du mir bitte sagen, wie ich von hier aus weitergehen soll?“
Und doch bedeuten Wörter, wie ihr wisst, mehr, als wir damit
ausdrücken wollen, wenn wir sie verwenden: Ein ganzes Buch sollte also
schon um einiges mehr bedeuten, als der Autor im Sinn hatte.
– Charles Dodgson über Die Jagd nach dem Schnatz1
Im Dezember 1865 brachte der Londoner Verleger Macmillan das Buch eines 33-jährigen Mathematikdozenten aus Oxford, Charles Dodgson, heraus. Es war zu einer gewissen Verzögerung gekommen, da die Qualität des ersten Drucks, für den Dodgson selbst aufgekommen war – was ihn fast ein Jahresgehalt gekostet hatte –, nicht seinen peniblen Ansprüchen genügte. Es war ein Kinderbuch, aber ein eher eigenartiges, denn es war vom seinerzeit berühmtesten Illustrator und Satiriker, John Tenniel, illustriert, und seltsamer noch: Es unterschied sich von fast jedem bisher erschienenen Kinderbuch darin, dass dahinter keine moralische Aussage zu stehen schien. Das Buch hieß Alice’s Adventures in Wonderland (dt.: Alice im Wunderland) und 153 Jahre später war es – zusammen mit seiner Fortsetzung Through the Looking-Glass (1872, dt.: Alice hinter den Spiegeln) – so sehr Teil einer weltumspannenden Kultur geworden, dass der russische und der britische Botschafter bei den Vereinten Nationen im Streit über die mutmaßliche Vergiftung eines Spions in Großbritannien Zitate daraus austauschten.
Die „Alice“-Bücher gehören zu den meistzitierten, am häufigsten angeführten, bekanntesten (wenn auch vielleicht nicht immer tatsächlich gelesenen) Büchern in englischer Sprache, denen zudem nachgesagt wird, sie hätten den Lauf der Kinderliteratur geändert – durch eine bis zur Anarchie reichende Parteiname für den kindlichen Leser und die kindliche Leserin. Aber das ist es nicht, was sie für die Fans so faszinierend macht und für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Tausende von Artikeln und Hunderte von Büchern darüber hervorgebracht haben. Sie unterscheiden sich von den meisten Kinderbüchern, die vor ihnen kamen (und den meisten, die nach ihnen kamen) durch ihre schiere Dichte: Es gibt kaum einen Satz, der nicht mehrere Bedeutungen, vielerlei Scherze, verschlüsselte Anspielungen auf intellektuelle, politische und persönliche Dinge transportieren würde. Da gibt es keine Überlänge, kein Beiwerk, keine Nebensächlichkeiten, kaum irgendeine Abweichung von einer auf das Kind ausgerichteten Erzählstimme: Wir haben es hier mit Büchern zu tun, in denen ein erstaunlich beweglicher, komplexer und spielerischer Geist unmittelbar und emphatisch mit seinem Publikum kommuniziert. Außerdem war Dodgsons Geist ganz der eines in sich widersprüchlichen Menschen aus der mittleren Periode des Viktorianischen Zeitalters – man sollte nicht vergessen, dass die Entstehungszeit von Wunderland und Hinter den Spiegeln fast genau in die Mitte der Regierungszeit von Queen Victoria fällt.
Der übergenaue Charles Dodgson nahm Anteil an jedem Aspekt der Gestaltung seiner Bücher – sogar am Entwurf der Titelseite. Dies war wahrscheinlich der erste Versuch, irgendwann im Jahr 1864: Die Illustration und die Falschschreibung von Tenniels Namen blieben nicht bis zur endgültigen Version erhalten. Die Zunahme der Anzahl der Illustrationen auf die mystische Zahl von 42 (siehe Kap. 5) stand noch bevor.
Die Entstehungsgeschichte der Bücher zu enträtseln, ist ein besonders gefährliches Unterfangen: So undurchsichtig sind die Spiele, die der Autor treibt, dass jeder, der nach den Bausteinen der Bücher sucht, mit einem Gewebe aus Möglichkeiten, Wahrscheinlichkeiten, Spekulationen und sehr oft auch Dingen zurückbleibt, die auf so geniale Weise psychedelisch sind, dass wir wünschten, sie wären wahr. Diese Bücher sind der Traum eines jeden Verschwörungstheoretikers!
Das Ganze wird dadurch nicht gerade einfacher, dass es vier „Alice“-Bücher gibt: Da ist eine handschriftliche Version, Alice’s Adventures Under Ground, die Dodgson seiner kindlichen Freundin Alice Liddell zueignete. Er entwickelte dieses Material dann zur letztlich publizierten Fassung Alice’s Adventures in Wonderland (dt.: Alice im Wunderland) weiter. Dann, nach fünf Jahren sporadischer Arbeit daran, kam die Fortsetzung Through the Looking-Glass (dt.: Alice hinter den Spiegeln). Wunderland und Hinter den Spiegeln sind im Bewusstsein der Leserinnen und Leser so miteinander verschmolzen, dass selbst glühende Verehrerinnen und Verehrer der Bücher (und sicherlich der britische Botschafter) sich damit schwer täten, zu sagen, welche Figur in welchem Buch vorkommt. Außerdem war, während Under Ground und in geringerem Maße Wunderland für ein Kind verfasst waren, Hinter den Spiegeln für Kinder geschrieben, wobei es aber paradoxerweise einen unverkennbar persönlichen und elegischen Ton hat, der das verlorene Kind aus dem ersten Buch heraufbeschwört. Und schließlich ist da The Nursery „Alice“ (dt.: Die kleine Alice), Dodgsons ebenso radikale wie sentimentale (und für einen Großteil der modernen Leserschaft hochgradig peinliche) Neufassung aus dem Jahr 1890, die ganz offenkundig auf ein jüngeres Publikum abzielte.
Winston Churchills berühmter Ausspruch über Russland aus dem Jahr 1939 ließe sich auch auf die „Alice“-Bücher übertragen: Sie sind „ein Rätsel, umgeben von einem Mysterium, das in einem Geheimnis steckt; aber vielleicht gibt es einen Schlüssel.“ Dieses Buch begibt sich auf die Suche nach einem Schlüssel – auch wenn die Aufgabe nicht minder schwierig zu bewältigen ist als der Versuch von Alice, in dem großen Saal von Wunderland den goldenen Schlüssel zu fassen zu bekommen. Wir werden allerhand Schrumpf- und Wachstumsprozesse und Herumgeplantsche über uns ergehen lassen müssen.
Dodgson war trotz des Bildes, das uns oft vermittelt wird, nämlich das eines zurückgezogenen Dozenten, der ein beschauliches Leben zwischen den verträumt daliegenden Turmspitzen von Oxford führt, ganz ein Mann seiner Zeit. Er war sich nicht nur überdeutlich sozialer, kultureller und religiöser Fragen bewusst, sondern er war, wie das Viktorianische Zeitalter selbst, ein Bündel von Widersprüchen. Folgt man seiner eigenen Darstellung, so wurden seine Bücher nach und nach entwickelt: Als er die erste Geschichte zu Papier gebracht habe, so merkte er an, habe er „viele neue Ideen hinzugefügt, die ganz von selbst aus dem ursprünglichen Material zu wachsen schienen.“
Dieses Buch unterzieht die verschiedenen Schichten von Ideen einer näheren Betrachtung, die in die Entstehung der „Alice“-Bücher einflossen. Zuerst ist da die Welt, die die ursprüngliche Alice und ihre Geschwister wiedererkannt hätten: Under Ground und Wunderland sind voller privater Scherze und Anspielungen. Dann ist da die Welt, in der Dodgson lebte: die Welt von Oxford, die Welt der großen und kleinen Politik, die Welt viktorianischer religiöser und intellektueller Scharmützel, die sich über den Köpfen der Kinder abspielten. Und dann ist da die private Welt in Charles Dodgsons Kopf. Humphrey Carpenter beschrieb Charles Kingsley, den Mann, der ein anderes berühmtes Kinderbuch (vielleicht das neben Alice berühmteste) dieser Zeit, The Water Babies (dt.: Die Wasserkinder), schrieb, als „den ersten Schriftsteller Englands, vielleicht den erstenweltweit mit Ausnahme von Hans Christian Andersen, der entdeckt hat, dass ein Kinderbuch das perfekte Vehikel für die persönlichsten und privatesten Belange eines Erwachsenen sein kann.“2 Charles Dodgson hätte dem sicher zugestimmt, aber als ein Meister der intellektuellen Verhüllung tendierte er, anders als Kingsley, nicht dazu, sein Herz auf der Zunge zu tragen.
Charles Dodgson, Mathematikdozent in Christ Church im Alter von 26 Jahren – ein „unterstütztes Selbstporträt“, 2. Juni 1857. Er schrieb in sein Tagebuch: „Verbrachte den Morgen im Dekanat … Die zwei lieben kleinen Mädchen, Ina und Alice, waren den ganzen Morgen über bei mir. Um die Linsen auszuprobieren, machte ich ein Bild von mir selbst, für das Ina den Kameradeckel abnahm und natürlich alles für ihr Werk hielt.“
„Meine ideale kindliche Freundin.“ Ein liebevolles Porträt der rätselhaften Alice Liddell, im Sommer 1858 im Alter von sechs Jahren. Dodgson wandte die sogenannte Kollodium-Nassplatten-Technik an, woraus Glasplattennegative (und reichlich Flecken auf den Händen des Fotografen) resultierten.
Bevor wir beginnen, sind ein paar warnende Worte angebracht. Manche Kritiker stimmen mit dem ersten Kinderbuchhistoriker, F. J. Harvey Darton, überein, wenn er sagt, es gebe „von Anfang bis Ende keinen verborgenen Gedanken, kein tieferes Motiv in den ‚Alice‘-Büchern.“3 Aber die meisten würden Derek Hudsons Ansicht teilen, dass „die ‚Alice‘-Bücher … bis zu einem gewissen Grad ein autobiografisches Sammelsurium [sind], das mit außergewöhnlichem Können ineinander verwoben ist: eine Odyssee des Unterbewussten.“4 Andere sind, wie Martin Gardner, Herausgeber von The Annotated Alice (dt.: Alles über Alice), vorsichtiger:
Der springende Punkt freilich ist, daß jedes beliebige Nonsens-Werk von einladenden Symbolen nur so wimmelt, so daß man dem Autor ganz nach Belieben irgendetwas unterstellen kann und dafür dann zuhauf Belege beibringen kann … [Die Sache ist die,] daß Bücher mit phantastischen Nonsens-Geschichten nicht so ein fruchtbarer Quell psychoanalytischer Einsichten sind, wie man das zunächst annehmen möchte. Sie sind nämlich überreich an Symbolen. Die Symbole ziehen zu viele Erklärungen nach sich.5
So werden wir also zwischen den Polen des allzu Einfachen und Wortwörtlichen und des zu Komplizierten und Spekulativen navigieren müssen … was uns zu einem historischen Moment bringt: ein gewisses Boot auf einem gewissen Fluss an einem bestimmten Tag eines bestimmten Jahres.