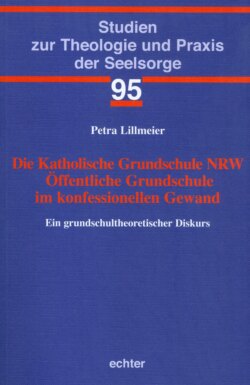Читать книгу Die Katholische Grundschule NRW Öffentliche Grundschule im konfessionellen Gewand - Petra Lillmeier - Страница 15
2.1Die Grundschule der Weimarer Verfassung
ОглавлениеDer Blick und das Hauptaugenmerk gelten zunächst der „Gründungsphase“ der Grundschule innerhalb der Weimarer Republik und den damit einhergehenden Auseinandersetzungen um ihre Bestimmung und Ausrichtung, dem Für und Wider einer auf ein Bekenntnis ausgerichteten „grundschulischen“ Bildung und Erziehung.
Bis zum Ende des Deutschen Kaiserreiches 1918 waren die Schulen hinsichtlich ihrer Organisationsstruktur und ihrer inhaltlichen Programmatik an eine durch Klassen und Stände bestimmte Sozialordnung gebunden. Die meisten Kinder besuchten die einklassige Volksschule. Daneben gab es private oder öffentliche, häufig in eine weiterführende Schule integrierte Vorschulen oder auch Privatunterricht.40
Auf die Entwicklung dieser Volksschule wirkten sich nach den Erfahrungen der Revolution von 1848 vornehmlich die stark regulativen Maßnahmen des preußischen Königs Friedrich Wilhelm IV,41 prägend aus. Dabei kam namentlich der religiösen Erziehung eine besondere Bedeutung zu. Einen eindrucksstarken Einblick gewährt diesbezüglich Friedrich Paulsen in seiner „Kritik an einer Landschule um 1850“: „Hatte sich einer in ein, zwei Jahren, es konnten auch drei oder vier und mehr werden, durch die Tabellen[42] durchgearbeitet, dann kam er in den Katechismus, zuerst den kleinen, hierauf den großen, um endlich die Frucht der Lesekunst zu genießen, das Auswendiglernen.“43 Und 1908 schreibt er: „Wie sie war? Sie war in ihrem Ursprung Bekenntnisschule. […] Was sie ist? Ein Mittelding zwischen der alten Bekenntnisschule und der neuen Volkserziehungsanstalt. […] Immerhin so, dass das kirchliche Bekenntnis noch als der anerkannte Maßstab aller Wahrheit gilt, dass das alte Ziel: bekenntnisfeste Glieder der Kirche zu erziehen, an keinem Punkt aufgegeben ist.“44
Dieses Zitat verdeutlicht exemplarisch, dass die am Bekenntnis ausgerichtete „Volksschule“ längst schon vor „Weimar“ infrage gestellt wurde. Die Problematik einer an einem Bekenntnis orientierten Grundschule kann also durchaus als „pränatales“ Erbe betrachtet und interpretiert werden, als eine Art „Mitgift“, die sie in ihre eigentliche Gründungsphase bereits mit einbrachte.
Nach der Novemberrevolution von 1918 trat am 06.02.1919 in Weimar die im Januar 1919 gewählte Weimarer Nationalversammlung (kurz: W.N.) zusammen. Sie war in erster Linie mit der Aufgabe betraut, eine Reichsverfassung zu kreieren und zu erlassen sowie den von den Siegermächten vorgelegten Versailler Vertrag zu verhandeln. Parteipolitisch bildeten in der W.N. die SPD, das Zentrum und die linksliberale DVP die Mehrheitskoalition, Parteien also, die schulpolitisch und religiös unterschiedlich verortet und motiviert waren. Die Weimarer Verfassung wurde schließlich am 31.07.1919 verabschiedet. Am 21.05.1920 löste sich die W.N. auf und wurde nach den Reichstagswahlen im Juni 1920 vom Reichstag abgelöst. Die „Weimarer Koalition“ verlor bei diesen Wahlen bereits die Mehrheit, konnte sich in Preußen allerdings bis 1932 halten.45 In dieser kurzen Zeitspanne zwischen der W.N. und den Reichstagswahlen zum deutschen Reichstag liegt die Gründungsphase der Grundschule als Bekenntnisschule, denn in eben jener Periode ihrer Geschichte wurden die einschneidenden Entscheidungen für ihre weitere Entwicklung getroffen. Dabei traten unterschiedliche Vorstellungen und Vorschläge zur Ausgestaltung der Schullandschaft zutage. In den Ländern und im Reich überschlugen und entluden sich teils heftige und kontrovers geführte Diskussionen. So heißt es in einem programmatischen Aufruf der preußischen Regierung vom 13.11.1918: „Ausbau aller Bildungsinstitute, insbesondere der Volksschule, Schaffung der Einheitsschule, Befreiung der Schule von jeglicher Bevormundung, Trennung von Staat und Kirche.“46 Im Gefolge dieser Programmatik sind dann die Verfügungen der preußischen Minister Haenisch und Hoffmann zu lesen, wonach:
•die Schulaufsicht künftig nicht mehr bei den Kirchen liegt, sondern auf staatliche „Kreisschulinspektoren“ übertragen wird (Verordnung vom 27.11.1918),47
•die Verpflichtung der Lehrer zur Erteilung von Religionsunterricht entfällt48 und
•die Verpflichtung zum Schulgebet aufgehoben wird (Verordnung vom 29.11.1918).49
Diese Verordnungen führten im Raum der Katholischen Kirche zu einem Sturm der Entrüstung und zu apologisierender Widerrede. Im gemeinsamen Hirtenschreiben vom 20.12.1918 wandten sich die preußischen Bischöfe postwendend an die Gläubigen. Sie beklagten eine drohende Trennung von Staat und Kirche, befürchteten finanzielle Einbußen, Enteignung, Macht- und Einflussverluste. „Aus den Schulen schwindet jegliche Religion. Lehrer und Lehrerinnen werden für ihr hohes Amt vorbereitet ohne Religions- und ohne Glaubensbekenntnis.“50 Dabei richteten die Bischöfe ihren Appell besonders auch an die Vertreter der Vereine und Organisationen und riefen zum offenen Widerstand auf. Betrachtet, befragt und analysiert man nun die inhaltliche Seite der Auseinandersetzung, so muss resümierend festgehalten werden, dass seitens des Episkopats zwar ein ideeller und substanzieller Mehrwert einer katholischen Erziehung und Bildung eingeklagt wurde, ohne ihn allerdings explizit zu benennen. Es wurde verteidigt, gerungen und gestritten, ohne tatsächlich substanziell zu benennen, worin nun genau das Proprium christkatholischer schulischer Bildung und Erziehung liegt. Schließlich führte der massive Widerstand breiter Kreise innerhalb der Katholischen Kirche dazu, dass die Verordnungen zur Ausübung der Schulaufsicht rund zwei Monate später wieder außer Kraft gesetzt und die Verordnung vom 29.11.1918 gänzlich zurückgenommen wurde.51
Diese Auseinandersetzung veranschaulicht, dass und warum die Episkopate fortan den staatlichen schulpolitischen Bestrebungen mit hoher Skepsis und großem Misstrauen begegneten.52 Die Katholische Kirche fürchtete deutlich um ihren gesellschaftlichen Einfluss vor allem im Raum von Schule und Erziehung.
Dieser schulpolitische Streit trug sich nicht nur auf der Ebene von Staat und Kirche zu; er war auch Teil parteipolitischer Auseinandersetzungen im Rahmen divergierender schulpolitischer Auffassungen und der damit verbundenen kontroversen Debatten innerhalb der Mehrheitskoalition der W.N. Die SPD trat für die Aufhebung der Vorschulen und die Einführung nichtkonfessioneller Gemeinschaftsschulen ein, die Vertreter der Zentrumspartei forderten die Konfessionsschule und lehnten eine Einheitsschule ab, und die DVP, die sich offen zeigte in Bezug auf die Konfessionsschule, trachtete danach, das bestehende Schulsystem beizubehalten.53
Letztlich gelang mit der Verabschiedung der Weimarer Verfassung von 1919 ein schulpolitischer Kompromiss:
•Das „Elternrecht und die Elternpflicht zur Erziehung“ fanden im Artikel 120 der Weimarer Reichsverfassung ihre Grundlegung.54
•Die Schulaufsicht wurde unter staatliche Aufsicht gestellt, allerdings mit der Option, die politischen Gemeinden daran zu beteiligen.
Besondere Beachtung soll nun dem Artikel 146 der Weimarer Verfassung geschenkt werden:
„(1) Das öffentliche Schulwesen ist organisch auszugestalten. Auf einer für alle gemeinsamen Grundschule baut sich das mittlere und höhere Schulwesen auf. Für diesen Aufbau ist die Mannigfaltigkeit der Lebensberufe, für die Aufnahme eines Kindes in eine bestimmte Schule sind seine Anlage und Neigung, nicht die wirtschaftliche und gesellschaftliche Stellung oder das Religionsbekenntnis seiner Eltern maßgebend.
(2) Innerhalb der Gemeinden sind indes auf Antrag von Erziehungsberechtigten, Volksschulen ihres Bekenntnisses oder ihrer Weltanschauung einzurichten, soweit hierdurch ein geordneter Schulbetrieb […] nicht beeinträchtigt wird. Der Wille der Erziehungsberechtigten ist möglichst zu berücksichtigen. Das Nähere bestimmt die Landesgesetzgebung nach den Grundsätzen eines Reichsgesetzes.“55
Mit Blick auf die Fragestellung sind drei Aspekte entscheidend, die bis heute Rechtsbzw. Diskussionsgrundlage einer auf das Bekenntnis ausgerichteten Grundschule sind, wie noch in Kapitel 3 zu sehen sein wird:
a)Die „Grundschule“ wird eine für alle Kinder gemeinsame Grundstufe des Schulwesens.
b)Das „Religionsbekenntnis“ der Eltern ist für die Aufnahme eines Kindes in eine Schule nicht maßgebend.
c)Bekenntnisschulen sollen auf Antrag der Eltern eingerichtet werden können, soweit dies einen geordneten Schulbetrieb möglich macht. Der Elternwille hat möglichst Berücksichtigung zu finden.
Was bedeutete dies nun für das preußische Schulsystem, in dessen Rechtsnachfolge das Land NRW steht, mit Blick auf die Fragestellung dieser Arbeit? Landé, preußischer Ministerialrat, unterscheidet in seinem Kommentar zur Reichsverfassung aus dem Jahr 1929 drei territoriale Rechtsgebiete. Preußen gehörte mit wenigen regionalen Ausnahmen zum „Bekenntnisschulgebiet“. Eine Bekenntnisschule – so Landé – kann dann als eine solche bezeichnet werden, wenn „grundsätzlich nur Lehrer eines und desselben Bekenntnisses angestellt und Schüler des gleichen Bekenntnisses aufgenommen werden“.56 Folgt man also Landé, ist die Konfessionalität der Lehrer- und Schülerschaft ein Erkennungsmerkmal für eine Bekenntnisschule und nicht ein Zugangsmerkmal. An anderer Stelle schreibt er: „In Gebieten dagegen, in denen eine Konfession stark überwiegt, ist vielfach schwer zu bestimmen, ob, bei Fehlen einer ausdrücklichen Bezeichnung, eine Bekenntnisschule vorliegt.“57 Die Konfessionalität von Lehrern und Schülern definiert die Schulart. (Dazu: Kap. 3.1.1.)
Bevor die Frage um die innere Ausgestaltung einer Bekenntnisschule in Preußen bearbeitet werden kann, ist es notwendig, einen kurzen Blick auf die Kompetenzverteilung zwischen den Ländern und dem Reich zu werfen, da nur auf diesem Hintergrund die nachfolgenden Auseinandersetzungen verständlich werden:58
•Dem Reich oblag die Grundsatzgesetzgebung auf dem Gebiet des Schulwesens. Aufgabe der Länder blieb der Bereich der Schulaufsicht, des Verordnungs- und Verwaltungsrechts.
•Reich, Länder und Gemeinden sollten in der Organisation der Schulen zusammenarbeiten.
•Die Lehrerausbildung und die schulstrukturelle Organisation des Bildungswesens – wie beispielsweise die der Gliederung der Volksschule – standen im Kompetenzbereich der Länder.
Auf dieser Grundlage und mit dem Auftrag zur Zusammenarbeit versammelten sich im Oktober 1919 die Kultusminister der Länder sowie Referenten und Vertreter des Reichsinnenministeriums, um die Gründung des Reichsschulausschusses als Bindeglied zwischen Reich und den Ländern zu beschließen. Dieser Reichsschulausschuss verabredete im Zuge seiner Sitzungen die Bildung einer „Reichsschulkonferenz“ mit dem Auftrag, konkrete Vorschläge zu einer einheitlichen Ausgestaltung des deutschen Schulwesens zu erarbeiten. Mit der beachtlich hohen Zahl von insgesamt 600 Delegierten aus dem Reich und den Ländern tagte die Reichsschulkonferenz erstmals im Juni 1920. Die meisten Delegierten waren zugleich auch Interessenvertreter von Vereinen und Verbänden, auch dies erschwerte die Verhandlungen zusehends. Um die ohnehin schon schwierigen Beratungen nicht noch weiter zu erschweren, wurde schließlich die, wie Christoph Führ herausstellt, „hochpolitisch aufgeladene Frage der konfessionellen Gliederung der Volksschule“59 ausgeklammert.
Welche Auswirkungen hatte die Kompetenzverteilung zwischen Reich, Land und Gemeinde auf die Klärung der Bekenntnisschulfrage?
Die Reichsverfassung erwies sich in ihren Aussagen zu „Bildung und Schule“ als uneindeutig. Durch diese ihre Indifferenz stritt man u. a. um die Frage, ob die Bekenntnisschule oder die Simultanschule60 als „Regelschule“ anzusehen sei. Die Katholische Kirche drängte vehement auf die Bewahrung einer Schule religiöser Erziehung und katholischen Gedankengutes. Der Bildungshistoriker Christoph Führ sieht in dieser Phase Argumente „der alten Tendenz bekenntnismäßiger Absonderung“61 am Werk. Auf der anderen Seite, so schreibt er weiter, „drängten Liberalismus und Einheitsschulbewegung auf Einführung der für alle verbindlichen Simultanschule.“62 Auf diesen widerstreitenden Positionen also und unter starker Beobachtung und Intervention des katholischen Episkopats und verschiedener Interessengruppen – in erster Linie des „Deutschen Lehrervereins“ und der „Katholischen Schulorganisation“63 – galt es, ein Reichsschulgesetz zu erlassen, das die Frage der konfessionellen Ausrichtung („Bekenntnisschule versus Simultanschule“) rechtlich und allgemein regeln sollte. Diese Bestrebungen scheiterten. Es kam in der Zeit von Weimar zu keiner weiter reichenden Schulgesetzgebung, die die Frage der Bekenntnisschule für ganz Deutschland geklärt hätte: Der so genannte Sperrparagraph, der Artikel 174 der Weimarer Verfassung, erlaubte es den Ländern, die Bestimmungen des Artikels 146 bis zum Erlass eines neuen Reichsschulgesetzes unberücksichtigt zu lassen. Weil nun aber keine Einigung möglich war, blieb § 33 des Preußischen Volksschulunterhaltungsgesetzes von 1906 gültig: Öffentliche Volksschulen „sind in der Regel so einzurichten, dass der Unterricht evangelischen Kindern durch evangelische Lehrkräfte, katholischen Kindern durch katholische Lehrkräfte erteilt wird“64.
Da es in dieser Untersuchung um die Fragestellung einer profilierten Ausrichtung einer Grundschule als Katholische Grundschule geht, muss hier noch auf die Rolle und Programmatik der Partei „Das Zentrum“ als der politischen Kraft eingegangen werden, die weite Teile des katholischen Deutschlands vertrat, weil sich dabei Hinweise auf eine an der Substanz einer Bekenntnisschule orientierten Argumentation ausmachen lassen.65 So findet sich etwa ein Hinweis auf Möglichkeiten einer inhaltlichen Ausgestaltung und Abgrenzung zwischen Gemeinschaftsschule einerseits und Katholischer Bekenntnisschule andererseits in dem 1924 diskutierten eigenen Reichsschulgesetzentwurf der Zentrumspartei. Nachfolgendes Zitat verdeutlicht eine angedachte, inhaltlich substanziell begründete Definition und Beschreibung der Ausrichtung einer Volksschule als Bekenntnisschule: „Die Gemeinschaftsschule (allgemeine Volksschule) erteilt den Unterricht auf religiös sittlicher Grundlage ohne Berücksichtigung der Besonderheiten einzelner Bekenntnisse. […] Die Bekenntnisschulen sind entweder evangelische oder katholische oder jüdische Volksschulen und als solche zu bezeichnen. […] Die dem Bekenntnis eigenen religiösen Übungen und Gebräuche, soweit sie für die Schule herkömmlich sind, werden gepflegt, ohne daß dadurch der Unterrichtsbetrieb im ganzen beeinträchtigt werden darf.“66 Hier wird also im gesetzlichen Rahmen eine kurze Umschreibung dessen versucht, was zuvor als „Unterricht und Erziehung im Geiste des Bekenntnisses“ bezeichnet wurde. Die Pflege eines konfessionell geprägten Brauchtums und die für das Bekenntnis konstitutiven religiösen Übungen sind Ausdruck einer konfessionsgebundenen Schule.
Auch zur Fragestellung der Teilnahme von Kindern anderer Bekenntnisse, die „ausnahmsweise oder vorübergehend“ die Bekenntnisschule besuchen, macht die Vorlage einen Vorschlag: Sie sollen nicht zur Teilnahme an den religiösen Übungen verpflichtet werden. Die Bekenntnisschule verliere dadurch aber nicht ihre Eigenart.67 Eine personelle Verzahnung zwischen der Schule und der „Bekenntnisgemeinschaft“ soll dadurch unterstrichen werden, dass der zuständige Vertreter im Schulvorstand68 mit Sitz und Stimme vertreten ist.69
Teile dieser inhaltlichen Programmatik einer Bekenntnisschule finden sich später im Entwurf eines Reichsschulgesetzes des Reichsinnenministers Walter von Keudell (1884-1973) wieder.70 Die Bekenntnisschule, so formuliert er, „erfüllt die Unterrichts- und Erziehungsaufgaben der deutschen Volksschule gemäß dem Glauben, in dem die Kinder erzogen werden“71. Aufschlussreich sind für uns folgende sog. „Keudell’schen“ Merkmale einer Bekenntnisschule, die sich teilweise auch in den oben skizzierten Vorschlägen der Zentrumspartei wiederfinden:
•Aufnahme in eine Bekenntnisschule finden die Kinder des entsprechenden und verwandten Bekenntnisses. Durch eine Aufnahme von Kindern anderer Bekenntnisse verliert die Schule nicht ihren Bekenntnischarakter. Damit wird einer stärker werdenden konfessionellen Mischung der Bevölkerung Rechnung getragen. Konfessionsschulen sind nicht zwangsläufig konfessionshomogen.
•Lehrkräfte gehören dem entsprechenden Bekenntnis der Kinder an; zur Erteilung des Religionsunterrichts eines anderen Bekenntnisses sind Lehrer dieses Bekenntnisses anzustellen.
•Die Lehrpläne, Lehr- und Lernbücher sind dem Bekenntnis anzupassen.
•Die dem Bekenntnis eigenen religiösen Übungen und Gebräuche sind zu pflegen.
•Die dem Bekenntnis eigenen Feier- und Gedenktage sind zu berücksichtigen.72
Zusammenfassend lässt sich aus diesen Vorlagen mit von Keudell folgende substanzielle Umschreibung vornehmen: Eine Bekenntnisschule ist eine Schule, die sich der Einübung in die dem Bekenntnis eigene Fest- und Feierkultur verschreibt und die in ihrer inneren Gestaltung Orientierung nimmt an den Festen und Feiern des Kirchenjahres und der Pflege religiöser Übungen und Bräuche.
Schon bald entbrannte innerhalb des Gesetzgebungsverfahrens allerdings ein Streit zwischen dem Zentrum und dem Entwurf von Keudells: Sind die drei Schularten als gleichberechtigt nebeneinander zu bewerten, oder gilt die Gemeinschaftsschule im Sinne einer Simultanschule als „Regelschule“, so dass die Bekenntnisschule als Ausnahme von der Regel anzusehen ist? Das Zentrum beharrte auf einem gleichberechtigten Nebeneinander und damit faktisch auf einem Fortbestand der geltenden Zustände. Die Zahlen gaben ihm Recht: Von den 1 647 462 katholischen Schülerinnen und Schülern Preußens besuchten im Schuljahr 1926-1927 insgesamt 1 522 477 Kinder katholische Volksschulen.73 Dennoch ist festzuhalten, dass die Festschreibung einer inhaltlichen Programmatik und „Kurzdefinition“ dessen, was unter Erziehung und Unterricht im Geiste eines Bekenntnisses aus Sicht der Zentrumspartei einerseits und im Rahmen des „Keudell’schen Entwurfs eines Reichsschulgesetzes“ andererseits zu verstehen sei, dass also eine gesetzliche Umschreibung dessen, was genau unter einer Bekenntnisschule zu verstehen sei, durchaus im Bereich des Möglichen lag – letztlich aber an der Frage scheiterte, welche Schulart die Regel und welche die Ausnahme darstellt.
Zusammenfassend kann nun folgendes Resümee gezogen werden: In der Zeit von Weimar wurde öffentlich vehement besonders um die Frage der Konfessionalität der Volksschule gestritten, deren „Grundschule“, wie aufgezeigt, die unterste für alle Kinder gemeinsame Grundstufe der Bildung war. Dieser Disput um die Bekenntnisschule prägte die Weimarer Republik, konnte aber nicht gelöst werden. Dies gilt nicht nur für die organisatorische Ausrichtung des Volksschulwesen sondern insbesondere auch für die inhaltliche Ausgestaltung. So stellt Grünthal fest: „[…] obgleich die Bekenntnisschule in den meisten Ländern als regelmäßige Schulform gesetzlich anerkannt war, gab es […] keine juristische Kennzeichnung der inneren Merkmale der Konfessionsschule.“74
Die Auseinandersetzungen um eine auf ein Bekenntnis ausgerichtete Volksschule (und damit eine Grundschule) für alle Kinder sind politisch auf dem Hintergrund eines schmalen historischen Zeitfensters zu lesen und zu verstehen. Die in diesen Fragen parteipolitisch zerstrittene Regierung und der föderale Zuschnitt der Verantwortlichkeiten in Fragen des Bildungssystems zeigen eine in ihren Wurzeln ungeklärte pädagogische Ausrichtung der „Grundschule“ in einer Zeit großer pädagogischer Entwürfe75.
Was unter einer konfessionellen Ausrichtung der Grundschule – als der untersten allgemeinen Grundstufe des Bildungswesens – zu verstehen ist, lässt historisch keine eindeutige Antwort zu. Die widerstreitenden Positionen machen deutlich, dass die „Konfessionsfrage“ wenig substanziell befeuert war und viel um die Frage kreiste, wem die Erziehung und Bildung denn nun eigentlich „gehörten“, wer also zu bestimmen habe, in welcher Weise und auf welcher Grundlage Kinder im öffentlichen Raum der Grundschule unterrichtet und erzogen werden. Der Blick „back to the roots“ zeigt also auf, dass die Grundschule als Bekenntnisschule ein „Zankapfel“ parteipolitischer und machtpolitischer Interessengruppen war; die entschiedene Ausrichtung am Kind und seinen Interessen blieb sie schuldig.
Was die religiöse Gestaltung des Schullebens in ihrer konkreten Ausgestaltung betrifft, lässt sich mit Geißler zusammenfassen: „Zwar als Pflichtveranstaltungen hinfällig geworden, so bleiben die tägliche Morgenandacht, das Schulgebet, die Schulandacht zu Beginn und Ende der Woche, der sonntägliche Kirchenbesuch der Schüler […] doch sämtlich zulässig und üblich.“76
Die meisten öffentlichen Volksschulen blieben Konfessionsschulen, nicht selten waren jedoch die Grenzen zur Gemeinschaftsschule in Bezug auf eine konfessionelle Homogenität fließend, wie Geißler feststellt,77 denn manchmal ließen die örtlichen Verhältnisse gar nichts anderes zu.
Nachfolgend steht die Frage nach der Rolle der Katholischen Kirche in der Auseinandersetzung um eine konfessionelle Ausrichtung der Volksschule im Fokus. Dabei wird primär nach Motiven, Zielen und konkreten Ausprägungen des auf Konfessionalität ausgerichteten Schulstreits zu fragen sein.