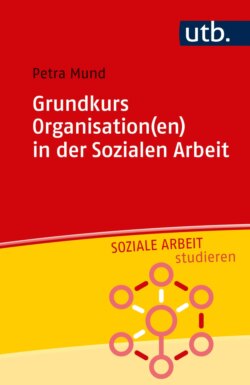Читать книгу Grundkurs Organisation(en) in der Sozialen Arbeit - Petra Mund - Страница 8
Оглавление2 Leistungen der Organisationen der Sozialen Arbeit
Die Hilfe- und Unterstützungsleistungen für Individuen, Familien und Gruppen in sozialen Notlagen können grundsätzlich in Geld-, Sach- und Dienstleistungen differenziert werden. In den Organisationen der Sozialen Arbeit erbringen die Fachkräfte individuelle und persönliche Hilfen, die von einer zwischenmenschlichen Interaktion gekennzeichnet sind. Daher werden die Leistungen der Sozialen Arbeit, wie die stationäre Betreuung in der Kinder- und Jugendhilfe oder ambulante Beratungsangebote, auch als personenbezogene soziale Dienstleistungen bezeichnet. Die Auseinandersetzung mit dem Begriff der personenbezogenen sozialen Dienstleistungen und den damit verbundenen Herausforderungen ist für die organisationsbezogene Gestaltung wichtig. Andernfalls laufen die Organisationen der Sozialen Arbeit Gefahr, sich bei der Gestaltung und Strukturierung ihrer Abläufe nicht auf die Besonderheiten ihres Gegenstandes zu beziehen, sondern ausschließlich allgemeine organisationstheoretische Überlegungen in den Vordergrund zu stellen.
Welche unterschiedlichen Leistungen der Organisationen der Sozialen Arbeit kennen Sie? Wie würden Sie diese systematisieren?
2.1 Leistungen der Organisationen der Sozialen Arbeit: Dienst-, Sach- und Geldleistungen
Zunächst ist die Frage zu beantworten, welche Leistungen von den Organisationen der Sozialen Arbeit für Einzelpersonen, Familien und Gruppen generell zur Verfügung gestellt werden. Daran anknüpfend ist zu klären, wie innerhalb dieses Leistungskanons die unterschiedlichen und vielfältigen Angebote der Sozialen Arbeit verstanden werden können.
Grundsätzlich können die unterschiedlichen wohlfahrtsstaatlichen Leistungen in Dienst-, Sach- und Geldleistungen differenziert werden (Ortmann 2012). Innerhalb dieses Dreiklangs werden die Leistungen und Angebote der Sozialen Arbeit zu den Dienstleistungen gerechnet.
Dieser Dreiklang findet sich auch im Sozialgesetzbuch. Im Sozialrecht, genauer gesagt in § 11 SGB I sind unter dem Oberbegriff Sozialleistungen die vielfältigen Hilfe- und Unterstützungsleistungen, die basierend auf dem Sozialstaatsprinzip (Kap. 1) in sozialen und individuellen Problemlagen zur sozialen Sicherung von staatlicher Seite dem / der Einzelnen zur Verfügung gestellt werden, zusammengefasst und ebenfalls in Dienst-, Sach- und Geldleistungen differenziert. In diesem rechtlichen Kontext dienen Dienstleistungen der Verwirklichung sozialer Rechte.
„Sie sind Teil des wohlfahrtstaatlichen Sozialleistungssystems und stellen eine besondere Art (oder Form) rechtlich verbürgter Sozialleistungen dar“ (Bauer 2001, 29).
Sozialleistungen sind nach § 11 SGB I die im Sozialgesetzbuch für die soziale Sicherung vorgesehenen Dienst-, Sach- und Geldleistungen. Auf diese Sozialleistungen haben die jeweils Leistungsberechtigten bei Bestehen der Anspruchsvoraussetzungen einen Leistungsanspruch.
Beispiele für Geldleistungen sind die von der Rentenversicherung gezahlten Altersrenten (laufende Geldleistungen) oder die von der gesetzlichen Krankenversicherung gezahlten Zuschüsse zum Zahnersatz (einmalige Geldleistungen). Mit Sachleistungen ist die Bereitstellung von Gegenständen wie Arzneimitteln oder Pflegehilfsmitteln, etwa Rollatoren oder Pflegebetten, gemeint. Die vielfältigen Leistungen und Angebote in den verschiedenen Feldern der Sozialen Arbeit, wie beispielsweise Hilfe zur Erziehung gem. §§ 27 ff. SGB VIII, sind Beispiele für Dienstleistungen.
Das Verhältnis zwischen Geld- und Sachleistungen wird immer wieder kritisch diskutiert. Ein Beispiel hierfür ist die Regelung in § 3 Abs. 1 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), nach der der persönliche Bedarf der Leistungsberechtigten, das „Taschengeld“ für Fahrtkosten, Kommunikationsmittel u.Ä. anstelle durch Geldleistungen durch Sachleistungen gedeckt werden sollen, sofern dies mit vertretbarem Verwaltungsaufwand möglich ist. Dadurch kann sich die Situation ergeben, dass neu ankommende Asylsuchende als Leistungsberechtigte über kein Bargeld verfügen. Hiergegen wird die Kritik vorgebracht, dass diese Bedarfe sehr persönlicher Natur seien und daher mit Barmitteln individuell und frei befriedigt werden können sollten. Zudem seien Sachleistungen und das Fehlen von Bargeld in hohem Maße mit Stigmatisierung verbunden.
Ein Großteil der nach dem Sozialgesetzbuch vorgesehenen Sozialleistungen wird in Form von Geldleistungen wie beispielsweise Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende, Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung oder Elterngeld gewährt. In der Praxis ist die Abgrenzung der einzelnen Leistungsarten nicht immer einfach (Dahme / Wohlfahrt 2015). In der Sozialen Arbeit finden sich auch Mischformen, bei denen unterschiedliche Sozialleistungsarten miteinander kombiniert werden.
So umfasst die Unterbringung eines Jugendlichen in einer Jugendwohngemeinschaft neben der sozialpädagogischen Betreuung als Dienstleistung auch den notwendigen Unterhalt des Jugendlichen. Dabei soll gem. § 39 Abs. 2 SGB VIII der regelmäßig wiederkehrende Bedarf durch laufende Geldleistungen gedeckt werden. Darüber hinaus werden auch einmalige Geldleistungen, beispielsweise bei wichtigen persönlichen Anlässen oder für Urlaubs- und Ferienreisen, gewährt.
Der Schwerpunkt der Sozialen Arbeit und damit auch ihrer Organisationen liegt jedoch nicht auf der Auszahlung von Geldleistungen oder der Zurverfügungstellung von Sachleistungen. Entsprechend ihres Gegenstandsbereiches, der ganz allgemein mit der Bewältigung individueller und sozialer Problemlagen beschrieben werden kann (Schilling / Klus 2018), liegt der Schwerpunkt der Angebote und Leistungen der Sozialen Arbeit auf der Erbringung von individuellen Hilfe- und Unterstützungsleistungen. Diese Leistungen können als beruflich gerahmte und institutionalisierte Handlungen (Dienste) gegenüber anderen Personen und damit als Dienstleistung verstanden werden. Dabei sind charakteristische Merkmale des sozialarbeiterischen Handelns die persönliche Hilfe und zwischenmenschliche Interaktion (Bötticher / Münder 2011; Bommes / Scherr 2012). Dementsprechend werden die Leistungen und Angebote der Sozialen Arbeit auch als personenbezogene soziale Dienstleistung bezeichnet.
„Unter Sozialer Arbeit verstehen wir eine personenbezogene soziale Dienstleistung, die im sozialstaatlichen Rahmen zur Bearbeitung sozialer Probleme eingesetzt wird, damit AdressatInnen im gesellschaftlichen Interesse bei der Bewältigung von Lebensproblemen [...] unterstützt werden“ (Hammerschmidt et al. 2017, 13 f.).
2.2 Personenbezogene soziale Dienstleistungen: Begriff
Die vielfältigen, im Rahmen einer professionellen Tätigkeit erbrachten sozialarbeiterischen Leistungen und Angebote werden also auch als personenbezogene soziale Dienstleistungen bezeichnet. Um genauer zu klären, was damit gemeint ist, ist eine Auseinandersetzung mit dem schillernden und in vielen Disziplinen unterschiedlich diskutierten Begriff der Dienstleistung (Bauer 2001) sowie mit den Adjektiven „personenbezogen“ und „sozial“ geboten.
Erste Hinweise, was mit den Begriffen Dienstleistung und personenbezogene soziale Dienstleistung gemeint sein könnte, liefert eine alltagswissenschaftliche Herangehensweise. Überlegen Sie: Was fällt Ihnen ein, wenn Sie über diese Begriffe bzw. die jeweiligen Bestandteile nachdenken? Reflektieren und diskutieren Sie die Bedeutungsinhalte der Begriffe bzw. der einzelnen Bestandteile.
Vor einer begrifflichen Klärung ist jedoch darauf hinzuweisen, dass nicht nur der Begriff der personenbezogenen sozialen Dienstleistung verwendet wird, sondern im Kontext der Leistungen der Sozialen Arbeit oftmals auch von sozialen Dienstleistungen (Cremer et al. 2013) oder sozialen Diensten (Heinze 2011) gesprochen wird. Diese Begriffe werden synonym verwendet. Dabei können soziale Dienstleistungen und personenbezogene soziale Dienstleistungen als deckungsgleich betrachtet werden. Bei der Begrifflichkeit soziale Dienste hingegen ist zu berücksichtigen, dass diese zwar einerseits tatsächlich synonym zur personenbezogenen sozialen Dienstleistung und damit ebenfalls für die Charakterisierung der unterschiedlichen Leistungen und Angebote der Sozialen Arbeit verwendet wird. Andererseits wird mit sozialen Diensten gleichzeitig die organisationale Ebene angesprochen. Mit dem Begriff soziale Dienste kann also in vielen Fällen auch die organisatorische Bündelung personenbezogener sozialer Dienstleistungen etwa in der Struktur einer Einrichtung gemeint sein (Kap. 4.1).
Ein Beispiel für einen solchen mit einer breiten Aufgabenstellung versehenen sozialen Dienst ist der Allgemeine Soziale Dienst (ASD). Der ASD, mancherorts auch Bezirkssozialdienst (BSD) oder Kommunaler Sozialdienst (KSD) genannt, ist meist den Jugendämtern zugeordnet. Mit seinem breiten Aufgabenspektrum sichert dieser Dienst auf kommunaler Ebene die soziale Grundversorgung der BürgerInnen (Kap. 4.5.4).
Damit kann eine inhaltliche Differenz zwischen sozialen Diensten auf der einen und sozialer personenbezogener Dienstleistung auf der anderen Seite benannt werden: soziale Dienste als Organisationen der Leistungserbringung und personenbezogene soziale Dienstleistungen als sich auf die Interaktion zwischen SozialarbeiterIn und AdressatIn beziehend (Flösser et al. 2018).
Was mit personenbezogenen sozialen Dienstleistungen im Fachdiskurs bezeichnet wird, soll nun mit Hilfe einer begrifflichen Annäherung geklärt werden. Da der Begriff der Dienstleistung in unterschiedlichen Disziplinen diskutiert wird, kann keine allgemeingültige Definition herangezogen werden. Dies hat zur Folge, dass auch personenbezogene soziale Dienstleistungen nicht eindeutig definiert werden können (Bauer 2001; Dahme /Wohlfahrt 2015). Im Folgenden werden unterschiedliche disziplinäre Perspektiven auf Dienstleistungen dargestellt, auf die in der Sozialen Arbeit Bezug genommen wird.
Eine erste Annäherung an den Begriff kann der Volkswirtschaftslehre entnommen werden. Aus dieser Perspektive bilden Dienstleistungen das
„Ensemble aller Leistungen, die weder der Gewinnung von Nahrungsmitteln (primärer Sektor) noch der Verarbeitung von Rohstoffen (sekundärer Sektor) dienen“ (Grunwald 2013a, 243).
Der Begriff der Dienstleistung nimmt hier die Funktion einer Restkategorie (tertiärer Sektor) ein, mit der alle Wirtschaftstätigkeiten umfasst werden, die weder im primären noch im sekundären Sektor berücksichtigt werden (Dahme / Wohlfahrt 2015).
Eine weitere Perspektive auf Dienstleistungen, die ebenfalls in der Sozialen Arbeit zur Begriffsklärung herangezogen wird, ist die der Wirtschaftswissenschaften (Finis Siegler 2009; Cremer et al. 2013). Hier gehören Dienstleistungen ganz allgemein zu den wirtschaftlichen Gütern. Güter meint in diesem Zusammenhang alles, was der menschlichen Bedürfnisbefriedigung dienen kann. Wirtschaftliche Güter werden in Realgüter und in Nominalgüter (Geld oder ein in Geld ausgedrückter Nennwert) unterschieden. Realgüter wiederum können in materielle (dann werden sie auch als Sachgüter bezeichnet) und immaterielle Güter unterschieden werden. Während materielle Güter wie Autos, Maschinen oder Nahrungsmittel körperlich vorhanden sind, sind immaterielle Güter nicht gegenständlich. Dienstleistungen sind eine wichtige Gruppe der immateriellen Güter. Daneben sind Rechte (z. B. Patente, Lizenzen, Urheberrechte) und Informationen (z. B. Nachrichten über einen bestimmten Sachverhalt, ein Ereignis oder eine Entscheidung) weitere Teilbereiche immaterieller Güter. Dienstleistungen als immaterielle Güter sind ebenfalls oft vielgestaltig und können in persönliche und automatisierte Dienstleistungen unterschieden werden. Persönliche Dienstleistungen zeichnen sich dadurch aus, dass der Erstellungsprozess durch menschliche Leistung dominiert wird. Bei automatisierten Dienstleistungen überwiegt die Leistung von Automaten bzw. Maschinensystemen, wie z. B. Datenbanken. Sowohl persönliche als auch automatisierte Dienstleistungen können sich auf Objekte (sachbezogene Dienstleistungen) und Menschen (personenbezogene Dienstleistungen) beziehen (Arnold 2009).
Diese Unterscheidung in sach- und personenbezogene Dienstleistungen ist auch für die Dienstleistungserbringung von Bedeutung: Bei sachbezogenen Dienstleistungen muss, damit die Dienstleistung erbracht werden kann, lediglich das Objekt der Dienstleistung zugänglich gemacht oder zur Verfügung gestellt werden.
Beispielsweise sind Reparaturarbeiten im Haushalt sachbezogene Dienstleistungen. Damit eine Reparatur der Waschmaschine als Dienstleistung erbracht werden kann, bedarf es eines Zugangs zur Waschmaschine. Bei der Reparatur an sich ist keine aktive Mitwirkung des / der Auftraggeberln erforderlich.
Personenbezogene Dienstleistungen hingegen werden an einer Person oder zusammen mit einer Person erbracht. Sie können nur durch eine direkte, aktive wie passive Beteiligung dieser Person als DienstleistungsempfängerIn realisiert werden.
Der Haarschnitt beim Friseur, die Untersuchung beim Arzt oder die Fahrt im öffentlichen Nahverkehr sind Beispiele für personenbezogene Dienstleistungen.
Entsprechend dieser Systematisierung sind die Leistungen und Angebote der Sozialen Arbeit personenbezogene Dienstleistungen. Sie werden als persönliche Hilfe- und Unterstützungsleistungen von Fachkräften der Sozialen Arbeit erbracht und richten sich an Individuen (Einzelne, Paare, Familien oder Gruppen) Dabei ist eine Mitwirkung der AdressatInnen erforderlich.
Die skizzierte Bandbreite personenbezogener Dienstleistungen, vom Friseurbesuch über die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs bis hin zu den Angeboten der Sozialen Arbeit macht jedoch deutlich, dass die Bezeichnung „personenbezogene Dienstleistung“ im Kontext der Sozialen Arbeit zu unscharf wäre. Die erforderliche Eingrenzung auf die Leistungen und Angebote der Sozialen Arbeit leistet das Adjektiv „sozial“. Im Kontext der Sozialen Arbeit können in Anlehnung an Cremer et al. 2013 alle Leistungen und Angebote als personenbezogene soziale Dienstleistungen verstanden werden, die die Soziale Arbeit in ihren unterschiedlichen Praxisfeldern Einzelnen, Paaren, Familien und Gruppen zur Lösung sozialer Probleme und Überwindung problematischer Lebenslagen zur Verfügung stellt. Personenbezogene soziale Dienstleistungen sind damit das Ergebnis eines gesellschaftlichen Willensbildungsprozesses darüber, welche Leistungen und Angebote der Sozialen Arbeit als gesellschaftlich notwendig und unhintergehbar betrachtet werden und damit in hohem Maße normativ bestimmt(Galuske 2001).
Personenbezogene soziale Dienstleistungen werden in einem beruflichen und entlohnten Kontext erbracht. Leistungen, die außerhalb eines solchen institutionalisierten Kontextes, beispielsweise im familiären oder ehrenamtlichen Bereich, erbracht werden, sind mit dem Begriff der personenbezogenen sozialen Dienstleistungen nicht gemeint (Grunwald 2013a, Cremer et al. 2013).
Die vorangegangenen Überlegungen zu personenbezogenen sozialen Dienstleistungen im Kontext der Sozialen Arbeit lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:
Leistungen und Angebote der Sozialen Arbeit können, wie auch die Leistungen und Angebote des Gesundheits- und Pflegebereiches, als personenbezogene soziale Dienstleistungen klassifiziert werden. Sie werden persönlich und interaktiv in den unterschiedlichen Praxisfeldern der Sozialen Arbeit im Rahmen einer professionellen und institutionalisierten Tätigkeit erbracht und zielen darauf, das Wohlergehen der jeweiligen AdressatInnen zu gewährleisten und / oder (wieder-) herzustellen bzw. zu verbessern.
2.3 Personenbezogene soziale Dienstleistungen: typische Merkmale
In der Auseinandersetzung mit Dienstleistungen können typische Merkmale identifiziert werden. Diese gelten mit einigen Modifikationen auch für personenbezogene soziale Dienstleistungen. Sie weisen auf die Besonderheiten bei der Leistungserstellung hin. Dies bleibt auch für die Organisationen, von denen sie erbracht werden, nicht folgenlos. Insbesondere ist dabei u. a. zu beachten, dass sich die Arbeit dieser Organisationen im Gegensatz zu anderen Organisationen, die etwa Güter produzieren, auf Subjekte bezieht. Dies bedeutet, dass mit allen Handlungen dieser Organisationen immer auch (Be-) Wertungen und Kategorisierungen verbunden sind, beispielsweise wenn Personen den Status von AdressatInnen der Sozialen Arbeit erhalten (Klatetzki 2010).
Insgesamt können die Merkmale personenbezogener sozialer Dienstleistungen und die damit verbundenen Herausforderungen wie folgt zusammengefasst werden (Arnold 2009; Cremer et al. 2013; Dahme / Wohlfahrt 2013; Klatetzki 2010):
Immaterialität / Intangibilität: Dienstleistungen sind in ihrem Kern immateriell und intangibel, d. h. sie sind nicht sichtbar und auch nicht greifbar. In den Erbringungsprozess können zwar auch Sachleistungen einfließen, die eigentliche Dienstleistung ist jedoch nicht gegenständlich. Das Ergebnis der Dienstleistung wiederum kann, muss aber nicht, immateriell sein. Es kann auch materiell sein bzw. materielle Bestandteile enthalten.
Die Beratungen, die in einer Suchtberatungsstelle zu den möglichen Formen stoffgebundener und stoffungebundener Süchte angeboten werden, sind immateriell und intangibel. Der für die Beantragung einer Entwöhnungsbehandlung z. B. bei der Deutschen Rentenversicherung erforderliche Sozialbericht, der die Ergebnisse der Beratungen zusammenfasst, Rehabilitationsformen empfiehlt und ggf. auf bei der Therapie zu beachtende Besonderheiten hinweist, ist das materielle Ergebnis des immateriellen Beratungsprozesses.
Aufgrund der fehlenden Gegenständlichkeit der zentralen Leistung kann im Vorfeld lediglich eine ungefähre Vorstellung von der Dienstleistung entwickelt werden, genau ist sie jedoch nicht bekannt. Eine vorherige Prüfung der Dienstleistung und ihrer Qualität sind somit im Gegensatz zu einem materiellen Gut wenn überhaupt nur sehr eingeschränkt möglich. Die Entscheidung über die Inanspruchnahme der Dienstleistung ist dadurch von einer Unsicherheit geprägt. Es bedarf eines Vertrauensvorschuss auf Seiten der nachfragenden Person, dass eine für die eigene individuelle Situation passende und effiziente Dienstleistung angeboten wird.
Im Vorfeld einer Suchtberatung ist es zwar möglich, sich den Ablauf und die Beratungsgespräche vorzustellen. Eventuell können auch Menschen zu ihren Erfahrungen mit dieser Suchtberatung befragt werden. Die Frage, ob die Suchtberatung auch für die eigene individuelle Situation die passende ist und ob die in einem anderen Fall erlebte Qualität der Leistung auch im konkreten Fall gegeben sein wird, kann im Vorfeld nicht abschließend beantwortet werden.
Einbeziehung der NachfragerInnen in die Dienstleistungserstellung: Dienstleistungen können nur erstellt werden, wenn die nachfragende Person oder ein ihr gehörendes Objekt in den Prozess der Dienstleistungserstellung einbezogen werden. Bei den personenbezogenen sozialen Dienstleistungen der Sozialen Arbeit wird in diesem Zusammenhang auch von der Koproduktion gesprochen: Gelingende Soziale Arbeit ist nicht das Resultat von einseitigen, ausschließlich durch die Fachkräfte geplanten Prozessen. Vielmehr entstehen Soziale Arbeit und ihre Ergebnisse durch die Interaktionen und die Einbeziehung und Beteiligung der AdressatInnen in die jeweiligen Hilfe- und Unterstützungsprozesse. Da es sich bei den AdressatInnen der Sozialen Arbeit oftmals um Menschen handelt, die zumindest zeitweise nicht aktiv für ihre Belange eintreten können, haben die Fachkräfte eine besondere Verantwortung, z. B. die Bedingungen so zu gestalten, dass die erforderlichen Interaktionen möglich werden (Spiegel 2018). Diese erforderliche Mitwirkung der AdressatInnen bei der Leistungserstellung einerseits und die Verantwortung der Fachkräfte andererseits haben sowohl Auswirkungen auf das Ergebnis der Dienstleistung, als auch auf ihre Qualität. Damit hängen Erfolg und Qualität der personenbezogenen sozialen Dienstleistungen in der Sozialen Arbeit auch davon ab, wie die Beziehung zwischen Leistungserbringenden und Nachfragenden gestaltet ist. Auch hier, bei dem Aufbau einer förderlichen Arbeitsbeziehung, liegt die Verantwortung für die Gestaltung der dazu erforderlichen Bedingungen bei den Fachkräften der Sozialen Arbeit.
In der Sozialen Arbeit ist bei der Erstellung von Dienstleistungen meist ein aktives Zusammenwirken von NachfragerInnen und SozialarbeiterIn erforderlich: Eine Suchtberatung wird ohne eine aktive Beteiligung der betroffenen Person, die über eine reine Anwesenheit hinausgeht, schwer möglich sein. Der Erfolg des Beratungsprozesses hängt zu einem nicht unwesentlichen Teil davon ab, ob sich die betroffene Person auf den Prozess eingelassen hat. Dabei sind die Fachkräfte der Suchtberatungsstelle dafür verantwortlich, die Bedingungen so zu gestalten, dass es für die betroffene Person auch tatsächlich möglich wird, sich auf den Prozess einzulassen und diesen mitzubestimmen.
Uno-actu-Prinzip: Bei personenbezogenen sozialen Dienstleistungen erfolgen die Produktion, also die Leistungserstellung, und der Konsum, also die Inanspruchnahme der Leistung, gleichzeitig. In dem Moment, in dem die Dienstleistung erstellt wird, wird sie auch verbraucht. In diesem Zusammenhang wird auch von dem Uno-actu-Prinzip gesprochen.
In dem Moment, in dem die Sozialarbeiterin über die Möglichkeiten in der Suchttherapie berät, nimmt der / die zu Beratende diese Informationen auf.
Konsequenz des Uno-actu-Prinzips ist es, dass die Dienstleistung an einen Standort gebunden ist. Dies gilt auch für die Soziale Arbeit: Die personenbezogene soziale Dienstleistung ist nicht transportfähig, sondern kann in den meisten Fällen nur dort erbracht werden, wo sich auch die AdressatInnen befinden. Nur in wenigen Ausnahmen, etwa im Bereich der Beratung, kann eine räumliche Distanz technisch überbrückt werden.
Beispiele für eine technische Überbrückung der räumlichen Distanz sind die Online-Beratungsangebote, die in verschiedenen Praxisfeldern (Suchtberatung, Suizidprävention, Erziehungsberatung) zunehmend neben den standortgebundenen Beratungsangeboten etabliert werden.
Fehlende Lagerfähigkeit: Durch ihre Immaterialität und die Gleichzeitigkeit von Produktion und Konsum sind Dienstleistungen vergänglich. Daher können sie nicht auf Vorrat produziert und auch nicht gelagert werden. Auch personenbezogene soziale Dienstleistungen wie die Suchtberatung können nicht auf Vorrat erstellt werden, um z. B. krankheits- oder urlaubsbedingte personelle Engpässe zu überbrücken. Nachtdienste in einer stationären Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe können ebenfalls nicht auf Vorrat erbracht werden. Dies muss bei der Koordination, Planung und Finanzierung der Arbeit und ihrer Abläufe berücksichtigt werden.
Begrenzte Standardisierbarkeit: Dienstleistungen und insbesondere personenbezogene soziale Dienstleistungen zeichnen sich durch Individualität aus. Sie können zwar standardisierte Bestandteile enthalten, wie z. B. den generellen Ablauf einer Erstberatung im Suchtbereich. Letztlich jedoch sind personenbezogene soziale Dienstleistungen Unikate, da sie koproduktiv und damit in Abhängigkeit vom Einzelfall jeweils individuell und neu erstellt werden. Sie weisen daher mit hoher Wahrscheinlichkeit in Ausführung und Ergebnis unterschiedliche Qualitäten auf.
„Aus den jeweils einzigartigen, in genau derselben Form nicht vollständig reproduzierbaren Produktionsbedingungen ergeben sich wiederum unterschiedliche Ergebnisqualitäten“ (Dahme /Wohlfahrt 2015, 27).
Diese nur begrenzte Standardisierung und das Merkmal der Koproduktion stellen hohe Anforderungen an die Vergleichbarkeit personenbezogener sozialer Dienstleistungen und die Überprüfung ihrer Effektivität.
Diskutieren und reflektieren Sie die typischen Merkmale personenbezogener sozialer Dienstleistungen und ihre möglichen Auswirkungen auf konkrete Leistungen und Angebote der Sozialen Arbeit in unterschiedlichen Praxisfeldern.
2.4 Personenbezogene soziale Dienstleistungen: Diskurslinien und Spannungsfelder
Die Perspektive der personenbezogenen sozialen Dienstleistungen ist eng mit dem Diskurs um die Dienstleistungsorientierung in der Sozialen Arbeit verknüpft. Diese Debatte, die bereits seit längerer Zeit geführt wird, ist eine der zentralen der Sozialen Arbeit (Oechler 2018). Sie schwankt zwischen den Extremen Reduzierung der Leistungen der Sozialen Arbeit durch Ökonomisierung und Neoliberalisierung einerseits und Professionalisierung der Sozialen Arbeit durch eine stärkere Subjektorientierung andererseits. Um zu verdeutlichen, welche Herausforderungen mit dieser Debatte verbunden sind, soll sie in ihren Grundzügen skizziert werden.
Grundsätzlich lassen sich innerhalb dieser Debatte sowohl sozialwissenschaftliche als auch ökonomische Bezugspunkte ausmachen (Olk et al. 2003; Oechler 2018): Zunächst war der Diskurs um personenbezogene soziale Dienstleistungen insbesondere sozialwissenschaftlich geprägt. Den Ausgangspunkt in diesem Zusammenhang bildete die in den 1950er Jahren aufgestellte Theorie des Ökonomen Jean Fourastié zum gesellschaftlichen Strukturwandel (Fourastié 1954). Von seinen Überlegungen zum zukünftigen Verhältnis von primärem, sekundärem und tertiärem Sektor ausgehend, wurde unter makroökonomischer Perspektive die Bedeutung von Dienstleistungen und des Dienstleistungssektors für die Sicherung und Optimierung der Gesellschaft und ihres Fortschrittes diskutiert (Grunwald 2013b). Nachdem diese Debatte auch in Deutschland zunächst ohne expliziten Bezug zur Sozialen Arbeit stattfand, setzte Mitte der 1970er ein mikrosoziologischer Diskurs über staatliche Strategien zur Bewältigung von sozialen Problemen und die Rolle von sozialen Dienstleistungen in diesem Kontext ein (Badura / Gross 1976). Ein Fokus lag dabei auf den charakteristischen Merkmalen und der damit verbundenen spezifischen Eigenlogik von sozialen Dienstleistungen (Kap. 2.3). Diese Diskursphase, die in einer Zeit des wirtschaftlichen Wachstums und des Ausbaus staatlicher Leistungen stattfand, fokussierte insbesondere die Bedeutung, die Funktion und das Interaktionsgeschehen von personenbezogenen sozialen Dienstleistungen generell und in der Sozialen Arbeit.
Eine weitere Diskursphase setzte zu Beginn der 1990er Jahre ein. Seitdem wird vor dem Hintergrund schwindender finanzieller Handlungsspielräume einerseits und staatlicher Ausgabensteigerung andererseits nicht nur in Deutschland der Um- und Abbau sozialer Sicherungssysteme und sozialer Dienstleistungen diskutiert und auch realisiert. Ausgangspunkt der Reformen bildete dabei das Modell des „New Public Management“, das als Oberbegriff die international entstandenen Reformkonzepte zur Verwaltungsrationalisierung zusammenfasst. Kerngedanke all dieser Konzepte ist, die als unzureichend angesehene Effizienz und Effektivität in der Erbringung öffentlicher Leistungen durch eine stärkere Orientierung an den Gesetzen des Marktes und mit Hilfe von privatwirtschaftlichen Unternehmen zu optimieren und grundlegend neu zu strukturieren. Die Folge des New Public Management, das in Deutschland unter der Bezeichnung „Neues Steuerungsmodell“ eingeführt wurde, waren umfassende Umstrukturierungen im Bereich der öffentlichen Verwaltungen und ihrer sozialstaatlichen Leistungen. Neben einer Optimierung und Straffung der Mittelverwendung sollte eine grundlegende Neuorientierung des Handelns innerhalb des öffentlichen Sektors eingeleitet werden. Seitdem wird zunehmend versucht, marktförmige und unternehmerische Prinzipien auf die öffentliche Verwaltung und damit auch auf die Soziale Arbeit zu übertragen. In der Sozialen Arbeit herrschen jedoch keine marktförmigen Bedingungen. So gibt es in den wenigsten Fällen eine aktive Nachfrage der AdressatInnen nach den Angeboten und Leistungen der Sozialen Arbeit. Vielmehr bestehen viele Angebote gerade weil die Menschen oftmals nicht über ausreichende Ressourcen verfügen. Daher ist der KundInnenbegriff, der auch in der Sozialen Arbeit verwendet wird, problematisch (Galuske 2001).
„Wer bestimmt beispielsweise, was die Ergebnisqualität einer intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung mit einem mehrfachstraffälligen Jugendlichen ausmacht? Die Öffentlichkeit, die morgens ihre Autos und Autoradios unversehrt vorfinden will? Die Politik, der Öffentlichkeit durch Wahlen verpflichtet und durch die Finanzkrise in ihren Handlungsmöglichkeiten begrenzt? Die Jugendamts- bzw. Sozialverwaltung als Geldgeber [...]? Der Anbieter der Hilfen, d. h. der kommunale, freie oder privatgewerbliche Träger, der sich einer bestimmten Tradition, einer bestimmten Philosophie, einem bestimmten Menschen- und Gesellschaftsbild verpflichtet fühlt [...]? Die SozialpädagogInnen, die mit ihrem Wissen und Können „vor Ort“ die Arbeit erledigen? Die Personensorgeberechtigten, im Regelfall die Eltern, die laut Gesetz Adressat „erzieherischer Hilfen“ sind? Oder gar der Jugendliche selbst? Wer ist also der Kunde, dessen „Bedarf“ die Soziale Arbeit zu befriedigen hat?“ (Galuske 2001, 357 f.)
Die nicht bestehenden Marktbedingungen und die mit dem KundInnenbegriff verbundenen Schwierigkeiten werden ganz besonders deutlich im Kontext von Leistungen, die in einem Zwangskontext wie dem Strafvollzug oder in Kinderschutzfällen stattfinden. Hier haben die betroffenen Menschen in den meisten Fällen weder die Möglichkeit, sich gegen die Inanspruchnahme einer Leistung zu entscheiden, noch zwischen verschiedenen Leistungen souverän zu wählen. Beides wäre im Rahmen eines klassischen Kundenverständnisses möglich.
Parallel zu diesem ökonomisch motivierten Diskursstrang findet seit den 1990er Jahren in der Sozialen Arbeit zudem auch eine fachpolitisch motivierte Dienstleistungsdebatte statt (Oechler 2018). Ausgangspunkt des Diskurses hier war der 9. Jugendbericht der Bundesregierung, durch den das Prinzip der Dienstleistungsorientierung auf die fachpolitische Agenda der Kinder- und Jugendhilfe gesetzt wurde. Dabei geht es der Theorie der Dienstleistungsorientierung darum,
„den professionellen Erbringungszusammenhang, den sie auf beschreibender Ebene als Kern der Sozialen Arbeit definiert, so zu verändern, dass die Souveränität derjenigen Personen gestärkt wird, welche die als „Soziale Arbeit“ erbrachten Leistungen in Anspruch nehmen“ (Sandermann / Neumann 2018, 106).
Vor dem Hintergrund dieser nur in Ansätzen skizzierten Vielschichtigkeit, Ausdifferenzierung und Verwendung des Dienstleistungsbegriffs in der Sozialen Arbeit ist es nicht verwunderlich, dass die damit verbundenen Debatten kontrovers geführt werden, da sie in ihrem Kern auch das Selbstverständnis der Sozialen Arbeit berühren. Dies unterstreicht das Erfordernis der weiteren Auseinandersetzung. Diese muss jedoch an anderer Stelle geleistet werden. An dieser Stelle standen mit der Orientierung auf personenbezogene soziale Dienstleistung nicht die Debatten um das Selbstverständnis der Sozialen Arbeit im Vordergrund. Vielmehr sollten die Herausforderungen verdeutlicht werden, vor denen die Organisationen der Sozialen Arbeit bei der Organisation ihrer Leistungen und Angebote stehen.
Reflektieren Sie anhand unterschiedlicher Praxisfelder der Sozialen Arbeit die Begriffe personenbezogene soziale Dienstleistungen und KundInnen. Welche Unterschiede und Herausforderungen können Sie erkennen?
Cremer, G., Goldschmidt, N., Höfer, S. (2013): Soziale Dienstleistungen. Ökonomie, Recht, Politik. Mohr Siebeck, Tübingen
Scheu, B., Autrata, O. (2018): Das Soziale: Gegenstand der Sozialen Arbeit. Springer, Wiesbaden