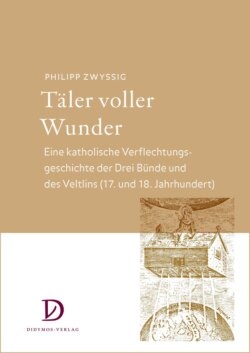Читать книгу Täler voller Wunder - Philipp Zwyssig - Страница 3
Inhalt
Оглавление1.1. Täler voller Wunder? Thematische Annäherung
1.3. Katholische Verflechtungsgeschichte: Entwurf eines integrativen Erklärungsmodells
1.4. Der rätische Alpenraum als Fallbeispiel: Inhalt, Quellengrundlage und Aufbau der Studie
2. Translokaler Katholizismus: Akteure und kommunikative Praktiken
2.1. Translokaler Katholizismus: Begriffliche Annäherung
2.2.1. Politisch-symbolische Verflechtung: Königliche Stifter und Schenker
2.2.2. Finanzielle Verflechtung: Die rätische Mission
2.2.3. Kulturelle Verflechtung: Ländliches Schulwesen und volkssprachliche Schriftkultur
2.2.4. Institutionelle Verflechtung: Missionsfakultäten und Bruderschaftsprivilegien
2.2.5. Fazit: Intensivierte Verflechtung
2.3.1. Informanten und Agenten
2.3.1.1. Netzwerke der römischen Amtskirche
2.3.1.3. Landsmannschaftliche Netzwerke und Agenten in Rom
2.3.2. Diskurse und Semantiken
2.3.2.1. Vormauer und Einfallstor nach Italien: Semantiken des konfessionellen Grenzraums
2.3.2.2. Häretische Seuche und Hexerei:Semantiken der religiösen Vielfalt
2.3.2.3. Das Schisma der Bündner Katholiken: Semantiken lokaler katholischer Kirchlichkeit
2.3.3. Fazit: Verdichtete Kommunikationszusammenhänge
2.4. Segen und Fluch der Verflechtung: Neue Handlungsspielräume, neue Konflikte
2.4.2. Verfluchte Verflechtung? Blutige Konflikte um fremde Kapuziner und heimische Weltpriester
2.4.3. Fazit: Zwischen Autonomie und Abhängigkeit
2.5. Der translokale Katholizismus an der Grenze zu Italien: Ein Fazit
3. Barocke Gnadenlandschaften: Aneignungen und Deutungen eines konfessionellen Grenzraums
3.1. Barocke Gnadenlandschaften: Begriffliche Annäherung
3.2. Praktiken der Sakralisierung: Sakrale Durchdringung von Raum und Zeit
3.2.1. Bau und Ausstattung von Kirchen
3.2.1.1. Mit den eigenen Händen: Akteure des Kirchenbaus
3.2.1.3. Gott als Architekt? – Sakralisierung durch Kirchenbau
3.2.2. Transfers von Reliquien, Gnadenbildern und Heilsmitteln
3.2.2.1. Wege in die Alpentäler: Grenzüberschreitende Bezugssysteme sakraler Objekte
3.2.2.2. Das Ausgreifen in die Lebenswelt: »Fremde« Objekte als Mittel der Sakralisierung
3.2.3. Die Erforschung einer geheiligten Vergangenheit
3.2.3.1. Von Apostel Petrus gegründet: Die Diözese Chur als terra sancta
3.2.4. Prozessionen und Bittgänge
3.2.5. Fazit: Sakralisierung im rätischen Alpenraum
3.3. Strategien der Sakralisierung: Die kirchliche Heilsvermittlung sicht- und erlebbar machen
3.3.1. »Sie sind jenen in Städten ebenbürtig«: Kirchenbau als Missionsstrategie
3.3.2. Türme bis zum Himmel: Gnadenorte als konfessionelle Grenzmarker und Orte der Bekehrung
3.3.3. Rom in den Alpen: Das Gnadenterritorium der römisch-katholischen Kirche
3.3.4. Das Heilige Land in den Alpen: Wo das Heilige heimisch ist
3.3.5. Fazit: Aneignung und Deutung eines konfessionellen Grenzraums
3.5. Sakrale Verdichtung – Verstärkte Grenze: Ein Fazit
4. Ökonomien des (Un)Heils: Religiöse Erfahrungswelten und Ambivalenzen im Umgang mit dem Sakralen
4.1. Von religiösen Märkten zu Ökonomien des Heils: Begriffliche Annäherung
4.2. Ökonomien des Heils: Gnadenerfahrungen und die lebensweltliche Immanenz des Sakralen
4.2.1. An den Himmel appellieren: Heils- und Heilungsbedürfnisse in der alpinen Lebenswelt
4.2.2. Dem Himmel darbieten: Die Ökonomie der Gnade
4.2.3. Vom Himmel erhört: Gnadenerfahrungen der Laien
4.2.4. Fazit: Ökonomien des Heils – Das Sakrale in der Lebenswelt
4.3. Ökonomien des Unheils: Dynamiken und Ambivalenzen des Sakralen
4.3.1. Lokale Kultaneignung: Rivalität auf dem Markt der Wunder und neue Handlungschancen für Laien
4.3.1.1. Die Verehrung des seligen Luigi Gonzaga in Sazzo und die Heilkraft des Lampenöls
4.3.1.2. Die Statue der Mater Dolorosa von Disentis und die Wiederbelebung totgeborener Kinder
4.3.3. Fazit: Die Ökonomie des Unheils – Entgrenzung und Einhegung des Sakralen
4.4. Vielfältige katholische Glaubenswelten: Ein Fazit
5. Schlussbetrachtung: Die verflochtene Logik der Wunder
Glossar
Quellen- und Literaturverzeichnis
1. Archivquellen
Tafeln