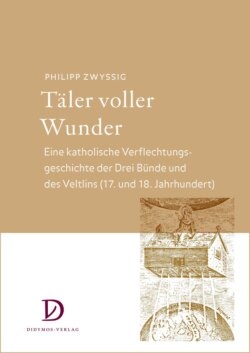Читать книгу Täler voller Wunder - Philipp Zwyssig - Страница 5
1. Einleitung 1.1. Täler voller Wunder? Thematische Annäherung
ОглавлениеIm Jahr 1654 lag die Frau von Giovanni Pietro Toscano aus Mesocco mit schweren Geburtswehen im Bett, ohne dass sie entbinden konnte. Weil sie sich bereits dem Tod nahe wähnte, ließ sie den Priester Antonio Maria Laus († 1664) zu sich rufen, der ihr die Beichte abnahm und sie dem heiligen Filippo Neri empfahl. Augenblicklich danach gebar sie Zwillinge, was von den Zeugen als wahres Wunder gedeutet wurde.1 Ob auch der Kapuziner Francesco Maria da Vigevano († 1692) zu Lebzeiten solche Wunder bewirkt hat, ist nicht bekannt. Sicher ist dagegen, dass nur ein Tag nach seinem Tod am 10. Juni 1692 in Savognin ein bis dahin blindes Mädchen wie durch ein Wunder wieder sehen konnte, was auf die himmlische Fürsprache des Kapuziners zurückgeführt wurde.2 Den Erkenntnissen der volkskundlichen Grundlagenforschung zufolge waren dies nur zwei von unzähligen Wundern, die sich im 17. und 18. Jahrhundert in den Drei Bünden zugetragen haben sollen. Die von 1938 bis 1955 schweizweit durchgeführte Inventarisierung von Votivgaben hat nämlich ergeben, dass es in Graubünden vergleichsweise viele Kirchen und Kapellen gab, für die wundersame Gebetserhörungen dokumentiert sind.3 Und tatsächlich legen die in der vorliegenden Arbeit aus einem breiten Quellenfundus zusammengetragenen Hinweise auf mirakulöse Begebenheiten den Schluss nahe, dass es sich bei den Tälern der Drei Bünde mitsamt ihren Untertanengebieten im Süden um Täler voller Wunder gehandelt haben muss (siehe die Karte, Abb. 1).
Wie kam es, dass im rätischen Alpenraum des 17. und 18. Jahrhunderts so viele Wunder geschahen? Auf diese Frage möchte die vorliegende Studie eine Antwort geben. Gleichwohl sollen nicht diese Wunder an sich im Zentrum der Untersuchung stehen. Welche Arten von Wundern die frühneuzeitlichen Menschen kannten, welche Weltbilder ihnen zugrunde lagen und wie sich der Umgang mit ihnen vom Mittelalter bis zum Beginn der Moderne veränderte, hat die Forschung in den letzten Jahrzehnten akribisch herausgearbeitet.4 Dass Wunder, verstanden als »mit der Naturkausalität nicht erklärbare Ereignisse«5, eine zentrale Rolle spielten in einer Welt, die als von Gott erschaffen und gelenkt verstanden wurde,6 ist weder überraschend noch fehlt eine Fülle an Forschungsliteratur, die dies belegt.7 Blickt man aber etwas genauer auf die Gesellschaften, in denen sich Wunder ereigneten, so stellt man fest, dass die Existenzgrundlage beziehungsweise der Wahrheitsgehalt von Wundern doppelt verankert war: einmal im Himmel und einmal auf der Erde. Im Himmel, weil Wunder Ausdruck des göttlichen Eingreifens in die Welt waren; auf der Erde, weil sich kirchliche Institutionen ausbildeten, die den Menschen Mittel und Wege zur Wundererfahrung aufzeigten (Sakramente, Sakramentalien, Gebete etc.), weil sich kulturelle Praktiken der Interpretation und Dokumentation von mirakulösen Ereignissen etablierten (Votivgaben, Mirakelbücher, Prodigiensammlungen etc.) und weil Kriege, Hungersnöte, Krankheiten und andere prekäre Alltagserfahrungen die Menschen stark auf ein wundertätiges Eingreifen einer höheren Macht hoffen ließen.8 Es brauchte also bestimmte irdische Rahmenbedingungen, damit sich die Wundertätigkeit Gottes in einer gewissen Regelmäßigkeit offenbaren konnte: Es brauchte Kirchen, die sich als Vermittler der »Gnaden- und Wunderkraft«9 Gottes in Szene setzten, ebenso wie für Wunder empfängliche Laien, und es brauchte außerdem eine religiöse Kultur, die die individuelle Wundererfahrung ins Zentrum stellte. Vor dem Hintergrund dieser Zusammenhänge wird verständlich, dass eine historische Untersuchung, die Wunder und Wundererfahrungen zum Ausgangspunkt nimmt, weit mehr leisten kann als eine bloße Geschichte des Wunderglaubens: Sie vermag das Gesamtbild einer auf religiösen Grundsätzen und Denkmustern beruhenden (vormodernen) Gesellschaft zu schärfen.10
Genau darum soll es in der vorliegenden Arbeit gehen: Um das differenzierte Gesamtbild einer katholischen Gesellschaft im Alpenraum, genauer gesagt in den Drei Bünden und den ihnen unterstellten Talschaften Veltlin, Bormio und Chiavenna. Dieses Bild blieb in der bisherigen Forschung ziemlich einseitig auf den lokalen historischen Kontext sowie auf die kirchenrechtlichen Besonderheiten eingeschränkt.11 Nur am Rande wurde auf personelle, kulturelle und kirchenpolitische Beziehungen zu Frankreich, Österreich, dem Herzogtum Mailand und der Eidgenossenschaft hingewiesen,12 der Einfluss der römischen Kurie blieb fast ganz ausgeklammert.13 Dies erstaunt umso mehr, als außer Frage steht, dass die katholische Kirche im nachtridentinischen Verständnis eine über territoriale Grenzen hinweg verflochtene und von der römischen Kurie maßgeblich mitbestimmte Kultgemeinschaft sein wollte. Dass dieses Selbstverständnis nicht ohne Auswirkungen auf Kultur und Religiosität einer lokalen katholischen Gesellschaft blieb, ist plausibel, wurde in der neueren historischen Forschung aber kaum thematisiert.14 Angesichts dessen setzt sich die vorliegende Arbeit zum Ziel, am Beispiel des rätischen Alpenraums eine katholische Verflechtungsgeschichte zu schreiben, das heißt auf die für eine katholische Gesellschaft der Frühen Neuzeit so typischen Formen der großräumigen Vernetzung hinzuweisen.
Dass eine solche Verflechtungsgeschichte gerade für die Eigenheiten der katholischen Gesellschaft der Drei Bünde großes Erklärungspotenzial haben kann, zeigen die beiden eingangs erwähnten Wundertäter. Antonio Maria Laus und Francesco Maria da Vigevano wiesen zwar ganz unterschiedliche Hintergründe auf: Der eine war ein Weltpriester, der andere gehörte dem Orden der Kapuziner an; der erste stammte aus dem Bündner Südtal Misox, der zweite war Italiener und somit ein Landesfremder. Dennoch gab es ein Element, das die beiden Figuren miteinander verband: Beider Leben war geprägt vom Wechsel zwischen unterschiedlichen Lebenswelten und dem Versuch, eine Mittlerposition zwischen verschiedenen kulturellen, kirchlichen und politischen Einflusssphären einzunehmen. Antonio Maria Laus studierte ab 1636 am Collegio Urbano in Rom, trat dort dem Oratorium des Filippo Neri bei, wurde danach von der Propagandakongregation als »apostolischer Missionar« in seine Heimat beordert und wurde schließlich zum Domherrn des Churer Hochstifts ernannt.15 Er pflegte regelmäßige Briefkontakte mit dem päpstlichen Nuntius in Luzern, mit dem Sekretär der Kurienkongregation de Propaganda Fide sowie mit dem Vorsteher des römischen Oratoriums und reiste mehrere Male nach Rom, um an der Kurie persönlich die Erfolge seiner Mission im Misox zu schildern. Francesco Maria da Vigevano aus der Mailänder Kapuzinerprovinz war seit den 1630er-Jahren bis zu seinem Tod 1692 als Missionar im Oberhalbstein tätig, reiste aber zeitweilig in seine Heimatprovinz sowie nach Innsbruck und Rom, wo er an den Höfen die Anliegen der Kapuzinermission und der Bündner Katholiken zur Sprache brachte.16 Diese biografischen Fakten wären für die Fragestellung dieser Arbeit nicht weiter relevant, hätten die beiden Figuren mit ihren Vermittlungsleistungen nicht einen entscheidenden Einfluss auf die Frömmigkeitskultur in den von ihnen betreuten Gemeinden beziehungsweise Talschaften ausgeübt. Francesco Maria da Vigevano ließ in fast allen Ortschaften im Oberhalbstein neue Kirchen errichten, die er dank Spenden aus Mailand kostbar ausstattete. Er beschaffte Heiligenreliquien bei italienischen Bischöfen, gründete Laienbruderschaften und übersetzte den italienischen Katechismus von Roberto Bellarmino (1542–1621) ins Rätoromanische17. Schon zu Lebzeiten von den Oberhalbsteinern als eine heiligmäßige Person angesehen, stand er nach seinem Tod aufgrund der ihm zugeschriebenen Wunder im Mittelpunkt eines lokalen Gnadenkultes; und noch heute zeugt eine an der Frontseite der Kirche St. Martin in Savognin angebrachte Gedenktafel (Abb. 28) von der großen Verehrung, die der Kapuziner genoss. Nicht minder beliebt dürfte Antonio Maria Laus bei den Katholiken im Misox gewesen sein. Auch ihm wurde ein Lebenswandel eines Heiligen bescheinigt.18 Die Frömmigkeitskultur prägte er entscheidend mit, indem er Oratorien nach römischem Vorbild gründete, Kirchen erbaute sowie in Rom Reliquien und die beim Volk äußerst beliebten, vom Papst gesegneten und mit einem Ablass versehenen Devotionalien (Rosenkränze, Kreuzchen, Agnus Dei etc.) besorgte. Damit nahm Laus Einfluss nicht nur auf die kirchengebundene Glaubenspraxis, sondern ebenso auf die alltägliche, in den eigenen vier Wänden praktizierte Laienfrömmigkeit. Die Religiosität der Bündner Katholiken, ihre lokalspezifischen Kulte und selbst ihre individuellen religiösen (Wunder-)Erfahrungen waren folglich zu einem guten Teil mitbestimmt von den grenzübergreifenden Austausch- und Transferprozessen, welche Francesco Maria da Vigevano, Antonio Maria Laus und andere Protagonisten in Gang setzten. Anders als es die kirchenrechtliche Autonomie der Bündner und Veltliner Kirchgemeinden a priori vermuten lässt,19 machten sich auf der Ebene der gelebten Religiosität womöglich bisher nicht beachtete, weit über den lokalen Kontext hinausreichende kulturelle, institutionelle und finanzielle Verflechtungen bemerkbar. Sie und ihre Auswirkungen auf die lokale Glaubenswelt im 17. und 18. Jahrhundert sollen im Zentrum der vorliegenden Studie stehen. Ihre Untersuchung setzt eine Zusammenführung verschiedener Forschungsfelder voraus, die sich in der neueren Forschung zum frühneuzeitlichen Katholizismus etabliert haben, bisher aber weitgehend ohne gegenseitige Bezugnahme geblieben sind.