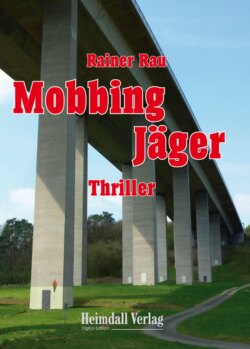Читать книгу Mobbing Jäger - Rainer Rau - Страница 5
2. Der Fall Kowalski.
ОглавлениеZeitsprung zurück.
Marion Kowalski war schon immer ein ruhiges und sehr introvertiertes Mädchen. In ihrer Kindheit hatte sie, gerade weil sie alles über sich ergehen ließ, sehr viel Spott einstecken müssen. Das fing schon im Kinderhort an. Man lachte sie oft aus und zeigte mit den Fingern auf sie, wenn sie wiedermal ihr Kleidchen mit heißer Schokolade bekleckert hatte. Zur Schulzeit wurde sie ebenso sehr oft geärgert. Einmal lästerten die Jungs über ihren kleinen Busen, das andere Mal war es ihr großer Hintern, über den sie sich Witze anhören musste. Ein weiteres Mal wurde sie einfach ignoriert oder ihre Schulfreunde ließen sie am Tages geschehen nicht teilhaben. Es kam auch schon mal vor, dass sie einfach zu einer Party oder einer Veranstaltung nicht eingeladen wurde. So fühlte sie sich ausgegrenzt, was sie im Prinzip dann auch war.
Ihr Selbstwertgefühl fiel in die Tiefe und sie suchte den Fehler bei sich selber.
Sie ergab sich dann immer in ihr Schicksal und erklärte es sich so, dass es Leute gibt, die im Mittelpunkt stehen und Leute, die als Verlierer geboren werden. So zumindest hatte es mal Onkel Karl bei einer Geburtstagsfeier ihrer Mutter und ihr erklärt.
»Das ist so, Marion. Da kannst du gar nichts gegen machen. Es muss ja auch Menschen geben, die sich unterordnen können. Wie um alles in der Welt sollten andere sonst die Ordnung in unserem Lande herstellen? Und so schlimm ist es ja auch nicht, wenn du nicht auf der Gewinnerseite stehst. Glaube mir, das ist auch nicht so einfach wie es aussieht. Um zu gewinnen, muss man sich hart durchbeißen. Sag einfach zu allem ja und geh den anderen aus dem Weg. Dann kommst du gut durchs Leben.«
Marion hatte ihm geglaubt. Sie war noch ein Kind und der Glaube zu den Verlierern im Leben zugehören, nistete sich für lange Zeit in ihren Kopf ein.
Wäre sie mal aus sich herausgegangen und hätte den Lästerern die Stirn gezeigt, wäre es vielleicht nicht so weit gekommen, wie es letztendlich kam.
Das lag jedoch nicht in ihrer Art. Sie schluckte allen Ärger und zeigte eine immer gleichbleibende, ja fast freundliche Miene.
»Es geht schon vorbei«, war ihre Devise. Sie hielt auch allen Ärger von ihren Eltern fern. Die hätten sich sonst große Sorgen gemacht. Insbesondere ihren Vater regte es fürchterlich auf, wenn sie unglücklich war. Er wollte seinen Engel immer glücklich sehen und konnte es nicht ertragen, wenn sie traurig war oder eine melancholische Phase durchmachte. Dann ging es ihm immer schlecht.
Die Zeit, in der sie zur Uni ging, war noch die schönste in ihrem Leben. Zwar wurde sie auch dort von einigen Kommilitonen gemobbt, sie hatte sich aber im Laufe der Jahre ein dickes Fell zugelegt und so nahm sie es gelassen. Nur ab und zu war das Leben doch sehr hart für sie. Beispielsweise wenn ein Student sie um ein Date bat, sie gerührt darauf einging, sich Hoffnung machte und er dann im Hörsaal eine Stunde später laut verkündete, dass sie sich unbedingt mit ihm treffen wollte und er das absolut nicht verstehen könne.
Einer der Studenten meinte es wirklich nicht gut mit ihr. Er machte lautstark Witze auf ihre Kosten.
»Wie sagte schon Sokrates: So frage ich euch, Ihr Gelehrten und Mitfühlenden, warum sollte ich mich mit einem solchen unästhetischen Anblick belasten, an dem mein Augenlicht Schaden nimmt?«
Er hatte es laut und deutlich gesprochen und alle auf den Rängen fielen in ein kollegiales Lachen ein. Keiner machte sich Gedanken darüber, dass Sokrates diesen Satz nie gesagt hatte. Es interessierte sie nicht. Es interessierte sie auch nicht, wie sich Marion Kowalski fühlte bei solchen Attacken.
Hätte sie die Kraft besessen und ihm eine Ohrfeige verpasst oder ihn zumindest verbal als Idioten beschimpft, hätte sie sich sicherlich Respekt verschafft.
So aber verließ sie den Hörsaal mit hochrotem Kopf und stieß am Eingang mit einem Dozenten der Uni zusammen. Sie ließ ihn stehen und Tränen rannen ihre Wangen herunter, als sie von dem Gelände lief.
Der Dozent vermutete, dass man nicht nett zu ihr gewesen war und stellte im Hörsaal die Gretchenfrage: »Was war eben hier los?«
Der Student, der diese Situation herbeigeführt hatte, ergriff das Wort: »Na ja. Sie wissen ja, wie Frauen so sind. Man kann es ihnen manchmal nicht recht machen.«
Das allgemeine Gelächter zeigte dem Dozenten, dass er die Sache nicht so schnell aufklären würde. Am Ende würde er wohl nicht ernst genommen werden.
Er schaute verärgert in die Runde und knirschte mit den Zähnen.
Damit war der Fall erledigt, zumal die Zeit drängte, die nächste Klausur bevorstand und der Lehrstoff noch lange nicht abgearbeitet war.
Ein anderes Mal schüttete ihr eine Studentin heißen Tee auf die Hose, genau dorthin, wo die Hosenbeine zusammengenäht waren. Es war zwar verboten, Getränke mit in den Hörsaal zu nehmen, kontrollieren konnte und wollte das aber keiner. Als dann der Ruf von weit unten erschall: »Oh, schaut nur. Marion Kowalski hat sich in die Hose gemacht!« und ein anderer rief durch den Saal: »Das war nicht notwendig. Der neue Professor ist doch schon verheiratet«, lachte wieder der gesamte Hörsaal.
Marion Kowalski konnte auch dieses Mal an der Vorlesung nicht teilnehmen.
Dann gab es Tage und Wochen, in denen man sie in Ruhe ließ. In dieser Zeit war sie für ihre Kommilitonen einfach Luft. Man sprach nicht über sie, man sprach aber auch nicht mit ihr.
Sie wusste nicht, was schlimmer war. Sie hatte kein Vertrauen zu anderen Menschen und zog sich ganz zurück.
In dieser Zeit, kurz vor ihrem Examen, reifte in ihr der Gedanke, einen Beruf zu wählen, in dem sie autorisiert war, auch eine gewisse Autorität zu zeigen. Ursprünglich wollte sie mit ihrem Lehramtsstudium auch den Weg in das Lehramt einschlagen. Dann aber stellte sie sich eine pubertierende Schulklasse vor, die ihr pausenlos Schwierigkeiten bereiten, sie nicht ernst nehmen und mit ihren Gefühlen spielen würde.
Nein, das ging gar nicht.
»Aber mit einer Uniform erhält man unaufgefordert Respekt«, redete sie sich Mut zu.
Sie bewarb sich bei der Polizei.
Marion Kowalski hatte Glück und konnte die Probe- und Anlernzeit bei der Bereitschaftspolizei einer Dienststelle in Frankfurt antreten. Danach wurde eine Planstelle in einem Präsidium der Schutzpolizei in Berlin frei. Das hatte zur Folge, dass sie auch dorthin ziehen musste. Sie wechselte von Hessen nach Berlin.
Sie fand relativ schnell eine Einzimmerwohnung, die in U-Bahnnähe lag und zog dort ein.
Ihre Rechnung ging auf, was die Mitmenschen auf der Straße betraf. Sie begegneten ihr mit Respekt und Höflichkeit.
Ihre Kollegen allerdings nahmen auf die Frauen in der Dienststelle keine große Rücksicht. Die meisten Frauen sahen darüber hinweg und nahmen es mit den verbalen Wortspielereien der männlichen Kollegen auf. Eine Polizistin hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, dem Kollegen, der sie anmachte, den Stinkefinger zu zeigen. Das hielt denjenigen nicht davon ab, bei nächster Gelegenheit wieder einen derben Spruch zur Frauenfront zu schießen, die Wirkung aber verblasste mit der Zeit.
Derbe und frauenfeindliche Witze waren in der Dienststelle an der Tagesordnung.
Ein Kollege hatte es besonders auf Marion Kowalski abgesehen.
Kai Hübner ließ keine Gelegenheit aus, sie mit anzüglichen Fragen zu verunsichern. Er stellte ihr nach und suchte sie unter einem Vorwand auch in ihrer kleinen Wohnung auf. Als er sie begrabschte, warf sie ihn hinaus. Das hatte zur Folge, dass sie von ihm belästigt wurde, wo immer er sie traf. Dies stellte er so geschickt an, dass es kein Außenstehender bemerkte.
Eines Morgens überraschte er sie im Umkleideraum als sie gerade ihre kugelsichere Weste anlegen wollte, riss ihren Kopf an den Haaren zurück und spuckte ihr ins Gesicht.
»Ich krieg dich noch. Warte nur ab. Dann bist du reif!«
Dann war er wieder verschwunden. Als eine ältere Kollegin in den Umkleideraum kam, saß Marion Kowalski auf der Bank und weinte.
»He, Marion. Was ist denn los? Hat er dich verlassen? Scheiß auf die Männer. Nimm’s nicht so schwer.«
Es war unmöglich, der Kollegin den richtigen Sachverhalt zu erklären.
Marion hielt es in dieser Dienststelle nicht länger aus. Sie schrieb schließlich ein Versetzungsgesuch. Sie hatte gehört, dass in ihrem Heimatort eine Planstelle frei wurde. Sie war der Meinung, hier in der Nähe ihres Vaters würde sie den Nachstellungen des Kollegen entgehen. Warum sie sich dies einbildete, war nur soweit logisch erklärbar, dass sie eine größere Distanz zwischen sich und den jetzigen Kolleginnen und Kollegen bringen wollte. Ihre Mutter verstarb früh, aber weder mit ihr noch mit ihrem Vater hatte sie über ihre Probleme mit anderen Menschen gesprochen. Sie gab sich selbst zum Teil eine Mitschuld an der Situation. Zum anderen konnte sie es nicht ertragen, ihren Vater leiden zu sehen, wenn es ihr schlecht ging. Sie redete auch mit keinem anderen Menschen über ihre Probleme. Abends schrieb sie alles in ihr kleines rotes Tagebuch. Nur ihm vertraute sie sich an.
Sie bekam die Stelle in der Provinz nach einem halben Jahr, kündigte ihre Wohnung in Berlin und zog wieder ins Haus ihrer Eltern, in ihr altes Jugendzimmer ein. Später wollte sie sich eine eigene Wohnung in der Nähe mieten.
Dazu sollte es jedoch nicht mehr kommen.
Sie kam mit ihren neuen Kolleginnen und Kollegen recht gut klar und die Arbeit fing an, ihr zum ersten Mal richtig Spaß zu machen. Bis zu dem Donnerstag im Oktober, als der Dienststellenleiter einen Neuzugang ankündigte. Mit Beginn der normalen Schicht am Morgen betrat Kai Hübner den Raum.
Es war allgemein bekannt, dass neue Kollegen ihren Dienst antreten sollten. Doch wer von welcher Dienststelle wechselte, wusste man nicht. Es hatte sich lediglich herumgesprochen, dass der Neue aus Berlin sein sollte.
So erfuhr Marion Kowalskis erst in diesem Augenblick davon, dass es der Mann war, der sie in Berlin massiv bedrängt hatte.
Ihr Herz setzte aus, als sie ihn sah. Hübner lachte ihr frech ins Gesicht.
Der Chef stellte ihn kurz vor. Dann sagte er beiläufig zu Kowalski gewandt: »Sagen Sie, Frau Kowalski. Sie müssten sich doch eigentlich aus Berlin her kennen? Waren Sie nicht im gleichen Revier tätig?«
Kowalski wollte schon verneinen, da fiel ihr Hübner ins Wort: »Klar kennen wir uns. Wir waren schließlich mal so gut wie zusammen.«
Auch das wollte sie dementieren, nun fiel ihr aber ihr Vorgesetzter ins Wort: »Na. Das wird aus Sicht der Chefetage eigentlich nicht gerne gesehen. Es soll den Dienstablauf stören. Ich sehe das nicht so eng. Hauptsache, Sie kommen gut miteinander aus und die Kollegen stört es nicht. Also, im Dienst keine Intimitäten.«
Hübner legte schnell den Arm um Kowalskis Schulter und beeilte sich zu sagen: »Sicher kommen wir gut miteinander aus!«
Marion Kowalski entzog sich seiner Umarmung. Ihr war schlecht.
Sie konnte es bei der folgenden Einsatzbesprechung einrichten, dass sie nicht mit Hübner in einem Wagen fahren musste, was dem Dienststellenleiter nur recht war. Laut Dienstplan war sie weiterhin einem Kollegen zugeteilt, mit dem sie schon seit geraumer Zeit fuhr. Dies blieb auch die nächsten Tage und Wochen so.
Hübner jedoch ließ in dieser Zeit keine Gelegenheit aus, sie bei den Kollegen schlecht zu machen und ihren Charakter ins negative Licht zu stellen. So erzählte er jedem, der es hören wollte und es wollten fast alle hören, dass Kowalski es in Berlin ja so gut wie mit jedem getrieben hätte.
»Einmal bin ich in den Besprechungsraum gekommen, da lag sie mit unserem ältesten Kollegen auf dem Boden. Nicht, dass es ihr peinlich gewesen wäre. Nein, sie hatte mich genau gesehen und trotzdem die Beine weit von sich gestreckt. Die schreckt vor nichts zurück.«
Einer, der das nicht glauben konnte, äußerte seine skeptische Meinung laut.
»Aber sie ist doch eher der ruhige Typ. Das kann ich gar nicht glauben.«
»Das ist auch nur Show. Sprich sie doch mal darauf an, wenn du mit ihr alleine bist. Oder geh gleich aufs Ganze und leg sie flach. Dann siehst du, ob sie still hält oder nicht. Glaub mir, die will es so!«
Einen Monat später war es genau das, was zwei Kollegen vorhatten. Sie hatten den Lügen Hübners wohl Glauben geschenkt.
Zum Ende der Spätschicht lauerten sie Kowalski im Umkleideraum auf.
Man konnte zwar in Dienstkleidung den Weg zur Dienststelle antreten, doch die meisten Kollegen zogen es vor, sich im ersten Untergeschoss des Gebäudes umzuziehen.
So auch Marion, da sie nach Dienstende oft im Park spazieren ging, was sie sehr gerne tat.
Angestachelt durch die permanente Zerstörung des guten Rufes von Kowalski hatten sie den Mut, nun das mit ihr zu tun, was ja laut Erzählung von Hübner bei ihr an der Tagesordnung sein sollte.
Sie flachzulegen.
Es befand sich außer ihnen niemand im Umkleideraum. Als Marion ihre Spindtüre öffnete, sprangen die beiden Kollegen hervor. Einer der beiden hielt sie fest, der andere riss ihr die Bluse auf und öffnete ihre Hose. Als sie schreien wollte, schlossen sich Finger um ihren Mund. Kowalski wehrte sich heftig. Als der Mann vor ihr ihre Hose und den Slip herunterzog, biss sie dem Mann, der sie festhielt, kräftig in die Hand. Der ließ sie sofort los und fluchte. Auch der andere war sich nun seines Tatendrangs nicht mehr so sicher. Er beschimpfte Kowalski.
»Warum stellst du dich hier so an? Sind wir dir nicht gut genug? In Berlin hattest du damit ja wohl keine Probleme. Da sollst du alles gefickt haben, was dir begegnet ist!«
Marion Kowalski sank auf den Boden und weinte, was die beiden total aus dem Konzept warf.
»Nun hör schon auf mit dem Geheul. Es ist ja nichts passiert. Und dem Chef brauchst du erst gar nichts zu sagen. Der glaubt dir sowieso nicht. Du hast hier nämlich nicht den besten Ruf.«
Während einer der Kollegen den Raum verließ, drehte sich der andere noch einmal um.
»Aber glaub mir, wir sind noch nicht fertig mit dir. Nur für jetzt. Wir kriegen dich noch. Und dann werden wir dir’s schon zeigen, egal ob du dann rumzickst. Heute Abend besuchen wir dich in deiner Wohnung. Du entkommst uns nicht.«
Dann schlug er die Tür zu.
Marion Kowalski beruhigte sich langsam. Sie setzte sich mit dem Rücken an einen Spind. Ihre Gedanken waren nun ganz klar. Ihre Hände aber zitterten. Sie zog ihren Slip und die Hose wieder hoch und steckte ihre Bluse hinein.
Dann nahm sie ihre Waffe, die sie im Spind abgelegt hatte und zog sie aus dem Holster.
Die Walther PPS, eine Selbstladepistole, wurde erst seit 2007 produziert und in der Dienststelle war sie erst vor kurzem gegen das Vorgängermodell, die Walther PPK, ausgetauscht worden. PPS steht für Polizei Pistole Schmal. Sie hat aufgrund des größeren Kalibers eine größere Durchschlagskraft. Dringt eine der 9 mm-Patronen aus kurzer Entfernung in den Brustbereich ein, so ist sie sehr wahrscheinlich tödlich.
Marion Kowalski wusste über die Wirkung eines abgefeuerten Schusses Bescheid. Sie hatte es oft genug beim Schießen auf dem Schießstand gesehen. Sie wusste genau, was passieren würde, wenn sie ihr Vorhaben ausführte. Dicke Tränen rannen ihre Wangen hinunter. Sie weinte lautlos.
Sie lud durch, entsicherte die Waffe, steckte sich den Lauf in den Mund und richtete ihn schräg nach oben. Sie schloss die Augen und drückte ab.
Marion Kowalski war sofort tot.
Die Kugel drang durch den Gaumen, das Kleinhirn und durch die linke Großhirnhälfte. Als sie am Hinterkopf austrat, riss sie einen Teil der Schädeldecke weg, die mit der hellen Gehirnmasse gegen die Blechtür des Spindes geschleudert wurde. Im Spind blieb auch die Kugel stecken.
Ihr Gesicht aber blieb unverletzt. Ihr Vater sollte sie nicht mit entstelltem Gesicht sehen.