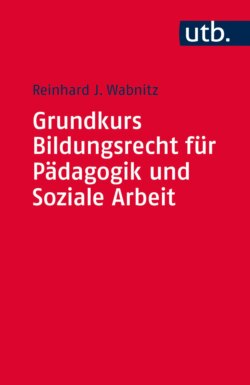Читать книгу Grundkurs Bildungsrecht für Pädagogik und Soziale Arbeit - Reinhard J. Wabnitz - Страница 8
Оглавление2 Verfassungsrechtliche Grundlagen
2.1 Staatsprinzipien des Grundgesetzes
Gemäß Art. 20 Abs. 1 GG ist die Bundesrepublik Deutschland „ein demokratischer und sozialer Bundesstaat“, und gemäß Art. 20 Abs. 3 GG ist die Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ordnung und sind die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung an Gesetz und Recht gebunden. Aus diesen wenigen Verfassungsnormen ergeben sich fünf Staatsprinzipien des Grundgesetzes (GG) (siehe Übersicht 9 sowie Näheres bei Wabnitz 2014a, Kap. 8.2; Hömig/Antoni 2013, Erläuterungen zu Art. 20; Kievel et. al. 2013, 2.1; Trenczek et. al. 2014, Kap. I. 2.1).
Staatsprinzipien des Grundgesetzes (GG)
1. Republik
2. Demokratie
3. Bundesstaat
4. Rechtsstaat
5. Sozialstaat
2.1.1 Republikanisches Prinzip und Demokratieprinzip
Das republikanische Prinzip (Hömig/Antoni 2013, Art. 20 Rz. 2) wird in Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG sowie dadurch zum Ausdruck gebracht, dass an mehreren Stellen im Grundgesetz von „Bundesrepublik“ Deutschland die Rede ist. Dies bedeutet, dass es in Deutschland mit dem Bundespräsidenten ein gewähltes Staatsoberhaupt gibt – im Gegensatz zu Monarchien mit Fürsten, Königen oder Kaisern und Thronfolgeregelungen kraft Vererbung.
Das Wort „Demokratie“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet Herrschaft des Volkes. Die Demokratie nach der Konzeption des Grundgesetzes ist gemäß Art. 20 Abs. 2 Satz 1 und 2 GG eine mittelbare parlamentarische Demokratie (Hömig/Antoni 2013, Art. 20, Rz. 3): auf der Bundesebene erfolgen Wahlen zum Deutschen Bundestag, der die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler wählt und auf deren/dessen Vorschlag hin die BundesministerInnen vom Bundespräsidenten ernannt und entlassen werden. Entsprechendes gilt auf der Ebene der Länder (Wahl der Landtage, MinisterpräsidentInnen, LandesministerInnen).
2.1.2 Bundesstaatsprinzip und Rechtsstaatsprinzip
Die Bundesrepublik Deutschland ist, ähnlich wie die Republik Österreich, ein Bundesstaat (Hömig/Antoni 2013, Art. 20, Rz. 6). In Kapitel 2.2 wird dargestellt, was das Bundesstaatsprinzip konkret bedeutet.
Neben dem Bundesstaatsprinzip ist das Rechtsstaatsprinzip das älteste Staatsprinzip in Deutschland (Hömig/Antoni 2013, Art. 20 Rz. 10 ff.; Kievel et. al. 2013, 2.1.3; Trenczek et. al. 2014, I 2.2.2; Wabnitz 2014a, 8.2.4); siehe dazu Übersicht 10:
Das Rechtsstaatsprinzip bedeutet:
1. Machtdekonzentration durch Gewaltenteilung (Art. 20 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 GG) wie folgt:
1.1 Legislative = Gesetzgebung durch die Parlamente
1.2 Exekutive = Regierung und Verwaltung
1.3 Judikative = Rechtsprechung: Kontrolle der übrigen Gewalten anhand von Recht und Gesetz
2. Sicherung des Rechtsstaates durch:
2.1 allgemein geltende Grundrechte (Art. 1 bis 19 GG),
2.2 justizielle Grundrechte (Art. 101, 103, 104 GG),
2.3 Unabhängigkeit der Gerichte und Richter (Art. 97 GG)
2.4 Rechtsweggarantie (Art. 19 IV GG).
3. Geltung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes wie folgt:
3.1 Geeignetheit einer Maßnahme, um Zweck zu erreichen?
3.2 Erforderlichkeit einer Maßnahme, um Zweck zu erreichen? (Oder gibt es ein „milderes Mittel“?)
3.3 Angemessenheit der Nachteile zum erstrebten Vorteil? (Abwägung unter Gewichtung von Nachteilen und Vorteilen.)
2.1.3 Sozialstaatsprinzip
Eines der jüngeren Staatsprinzipien ist schließlich das Sozialstaatsprinzip, das in Art. 20 Abs. 1 sowie Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG seinen Ausdruck gefunden hat, wenn auch nur in jeweils einem einzigen Wort: „sozialer“ (Bundesstaat) bzw. „sozialen“ (Rechtsstaates) (Hömig/Antoni 2013, Art. 20, Rz. 4; Kievel et. al. 2013, 2.1.5; Trenczek et. al. 2014, I 2.2.3; Wabnitz 2014a, 8.2.5). Zum Sozialstaatsprinzip siehe Übersicht 11:
Sozialstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 1, Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG)
1. Der Staat ist zur Herstellung und Erhaltung von sozialer Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit verpflichtet, und zwar u. a. wie folgt:
1.1 Legislative:
1.1.1 Schaffung eines sozialen Mindeststandards
1.1.2 Gewährleistung des Existenzminimums
1.2 Exekutive:
1.2.1 bei Ermessen: Wahl der sozial gerechteren Maßnahme
1.2.2 Legitimation für Leistungen in Notfällen
1.3 Judikative: Wahl der sozial gerechteren Alternative
2. Das Sozialstaatsprinzip stellt eine „Generalklausel“ dar, die durch den Gesetzgeber konkretisiert werden muss (Ansätze dazu bereits im GG: Art. 6 Abs. 4, 9 Abs. 3, 14 Abs. 2, 15 GG).
3. Das Sozialstaatsprinzip wird konkretisiert in verschiedenen Politikbereichen, z. B. in der:
3.1 Sozialpolitik
3.2 Bildungspolitik
3.3 Gesundheitspolitik
3.4 Wohnungspolitik
3.5 Familienpolitik
3.6 Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik
Die wichtigste Konkretisierung des Sozialstaatsprinzips ist durch das Sozialgesetzbuch (SGB) erfolgt (Kap. 4.1). Zum Sozialstaatsprinzip existiert eine umfangreiche Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (z. B. BVerfGE 1, 105; 5, 198; 10, 370; 22, 204; 35, 235 f.; 52, 346; 82, 85; 94, 263; 100, 284; 110, 445; 123, 363).
2.2 Bildungsrecht und Föderalismus
2.2.1 Bund und Länder im deutschen Föderalismus
In Übersicht 12 wird dargestellt, was das Bundesstaatsprinzip (Näheres bei Hömig/Antoni 2013, Art. 20, Rz. 6; Kievel et. al. 2013, 2.1.5; Trenczek et. al. 2014, I 2.2.3; Wabnitz 2014a, 8.2.5) bedeutet:
Bundesstaatsprinzip
1. Begriff: Ein Bundesstaat ist ein Gesamtstaat, bei dem die Ausübung der Staatsgewalt auf einen Zentralstaat (Bund) und mehrere Gliedstaaten (16 Länder) aufgeteilt ist.
2. Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern:
2.1 Grundprinzip (Art. 30 GG): Grundsätzlich sind die Länder für die Erfüllung der staatlichen Aufgaben zuständig, soweit das GG keine andere Regelung trifft oder zulässt.
2.2 Zuständigkeitszuweisungen im Einzelnen:
2.2.1 durch Spezialregelungen, z. B. Art. 32 GG (Auswärtige Beziehungen: Bund) oder Art. 104a ff. GG (Finanzwesen: Bund),
2.2.2 oder nach Staatsfunktionen:
– Art. 70 ff. GG: Gesetzgebung (überwiegend Bund)
– Art. 83 ff. GG: Verwaltung (überwiegend Länder),
– Art. 92 ff. GG: Rechtsprechung (überwiegend Länder).
Das – historisch gewachsene – Bundesstaatsprinzip ist für die Staatspraxis der Bundesrepublik Deutschland von herausragender Bedeutung, da alle Staatsgewalten bzw. Zuständigkeiten entweder auf den Gesamtstaat Bundesrepublik Deutschland oder auf die 16 Bundesländer als Gliedstaaten aufgeteilt sind.
2.2.2 Kompetenzen im Schulrecht
Da das Grundgesetz dem Bund im Bereich des Schulwesens und des Schulrechts keine Kompetenzen zuweist, ist dieser wichtige Aufgabenbereich heute fast der einzige, den die Länder alleine gestalten können, sowohl was die Gesetzgebung und die Verwaltung als auch die immer wieder heftig umstrittene Schulpolitik anbelangt. Und dementsprechend unterschiedlich sind Schulrecht und Schulorganisation in den 16 Bundesländern ausgestaltet, vielfach zum Leidwesen von Schülern und Eltern, die in ein anderes Bundesland umziehen, wo „vieles ganz anders ist“ (Kap. 9 und 10).
2.2.3 Kompetenzen im Sozial- und Hochschulrecht
Völlig anderes stellt sich die Situation im Bereich des Sozialrechts dar. Dieses ist heute fast ausschließlich durch Bundesgesetze geregelt (Kap. 4 bis 8, 10 und 11); dies vor allem deshalb, damit alle Bürgerinnen und Bürger im gesamten Bundesgebiet dieselben Sozialleistungen erhalten können. Die Länder haben hier nur geringe legislative Gestaltungsspielräume im Bereich von Landesausführungsrecht zum Bundesrecht. Die Verwaltung obliegt teilweise Sozialversicherungsträgern auf Bundes- und Landesebene, teilweise Landes- oder Kommunalverwaltungen.
Im Bereich des Hochschulrechtes wiederum überwiegen Landeskompetenzen: sowohl im Bereich der Hochschulgesetzgebung als auch mit Blick auf die Organisation der Hochschulen, denen dabei wiederum grundgesetzlich geschützte Selbstverwaltungsrechte zustehen (gemäß Art. 5 Abs. 3 GG). Gesetzgebungskompetenzen des Bundes bestehen u. a. im Bereich der Ausbildungsförderung und der Beruflichen Bildung (Kap. 8 und 10) sowie der (Mit-) Finanzierung von Hochschulen, Forschung und Wissenschaft (vgl. Art. 91a ff. GG).
2.3 Wichtige Grundrechte nach dem Grundgesetz
Die Bundesrepublik Deutschland ist nicht zuletzt deshalb ein Rechtsstaat (Kap. 2.1.2), weil sie ihren Bürgerinnen und Bürgern Grundrechte gewährleistet. Die Grundrechte nach Art. 1 bis 19 GG beinhalten subjektive Rechte gegenüber dem Staat. Sie sind weitgehend Abwehrrechte, zum Teil aber auch auf Teilhabe und auf Leistungen des Staates gerichtet (Näheres zu den Grundrechten: Hömig/Antoni 2013, Vorbemerkungen zu den Grundrechten vor Art. 1 GG; Wabnitz 2014a, Kap. 8.3; Kievel et. al. 2013, 2.2; Trenczek et. al. 2014, Kap. I. 2.2). Die Übersicht 13 vermittelt einen Überblick über die einzelnen Grundrechte.
Grundrechte nach Art. 1 bis 19 GG
1. Art. 1 Abs. 1 und 2: Menschenwürde, Menschenrechte
2. Freiheitsgrundrechte
2.1 Art. 2 Abs. 1 – Freie Entfaltung der Persönlichkeit
2.2 Art. 2 Abs. 2 Satz 1 – Leben, körperliche Unversehrtheit
2.3 Art. 2 Abs. 2 Satz 2 – Freiheit der Person
2.4 Art. 4 – Glaubens-, Gewissens- und Religionsfreiheit, Kriegsdienstverweigerung
2.5 Art. 5 – Meinungs- und Pressefreiheit, Rundfunk, Film, Kunst, Wissenschaft, Forschung und Lehre
2.6 Art. 6 – Ehe, Familie
2.7 Art. 7 – Schulwesen
2.8 Art. 8 – Versammlungsfreiheit
2.9 Art. 9 – Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit
2.10 Art. 10 – Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis
2.11 Art. 11 – Freizügigkeit
2.12 Art. 12 – Beruf
2.13 Art. 13 – Wohnung
2.14 Art. 14 – Eigentum, Erbrecht; Art. 15 – Sozialisierung
2.15 Art. 16 – Staatsbürgerschaft, Auslieferung
2.16 Art. 16a – Asyl
2.17 Art. 17 – Petition
3. Gleichheitsrechte
3.1 Art. 3 Abs. 1 – Allgemeiner Gleichheitssatz
3.2 Art. 3 Abs. 2 – Gleichberechtigung von Männern und Frauen
3.3 Art. 3 Abs. 3 – Differenzierungsverbote
2.3.1 Art. 1, 2 und 3 GG
Aufgrund der Erfahrungen mit der nationalsozialistischen Diktatur stehen an der Spitze der Grundrechtsartikel des Grundgesetzes (Art. 1 Abs. 1 Satz 1 und 2 GG) die beiden folgenden Sätze: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt“; das deutsche Volk bekennt sich darum gemäß Art. 1 Abs. 2 GG „zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.“ Das Grundgesetz sieht mithin die Menschenwürde und zudem die freie Entfaltung der Persönlichkeit als oberste Rechtswerte und tragende Konstitutionsprinzipien des GG an (BVerfGE 6, 36; 12, 53; 109, 149).
Art. 1 Abs. 1 und 2 GG ist von der Rechtsprechung insbesondere als Auslegungsmaßstab für die folgenden Grundrechtsbestimmungen und für Regelungen in Gesetzen zur Anwendung gebracht worden. In diesem Zusammenhang hat das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel auf die Bedrohung der Menschenwürde durch moderne Entwicklungen in Wissenschaft und Technik (etwa durch Abhörgeräte, Gentechnologie, Datenspeicherung und -übermittlung) reagiert oder festgestellt, dass auch Gefangene im Strafvollzug Anspruch auf menschenwürdige Behandlung haben (BVerfGE 33, 1). Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts besteht aufgrund von Art. 1 Abs. 1 GG auch ein Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums (BVerfGE 125, 175).
Das „klassische“ Freiheitsgrundrecht ist in Art. 2 Abs. 1 GG verankert: „Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.“ Die Rechtsprechung hat auf der Grundlage von Art. 2 Abs. 1 sowie Art. 1 Abs. 1 GG u. a. ein allgemeines Persönlichkeitsrecht entwickelt (dazu: Hömig/Antoni 2013, Art. 1, Rz. 10 ff.) oder ein Grundrecht des Einzelnen auf informationelle Selbstbestimmung im Bereich des Datenschutzes (BVerfGE 65, 1).
Der dritte fundamentale Verfassungsgrundsatz ist der der Gleichheit vor dem Gesetz gemäß Art. 3 Abs. 1 GG: „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.“ Der Gleichheitsgrundsatz hat große praktische Bedeutung u. a. in der Leistungsverwaltung, insbesondere im Sozialrecht, im Wahlrecht oder im Steuerrecht (Näheres dazu: Hömig/Antoni 2013 Art. 3, Rz. 2 ff.). Auf der Grundlage von Art. 3 Abs. 1 GG sind durch das Bundesverfassungsgericht wiederholt Regelungen einzelner Gesetze wegen Verstoßes gegen das Gleichheitsgebot für verfassungswidrig erklärt und aufgehoben worden (vgl. BVerfGE 3, 58; 18, 38; 71, 39; 81, 1; 82, 126; 84, 239; 93, 121, 165; 93, 335, 408).
Art. 3 Abs. 2 und 3 GG enthalten spezielle Gleichheitsrechte betreffend Männer und Frauen (Abs. 2) sowie Diskriminierungsverbote wegen des Geschlechtes, der Abstammung, der Rasse, der Sprache, der Heimat und Herkunft, des Glaubens, der religiösen oder politischen Anschauungen (Abs. 3). Seit Inkrafttreten des Grundgesetzes hat das Bundesverfassungsgericht zahlreiche gesetzliche Bestimmungen wegen Verstoßes insbesondere gegen den Grundsatz der Gleichberechtigung von Männern und Frauen (Art. 3 Abs. 2 Satz 1 GG) für verfassungswidrig erklärt (z. B. BVerfGE 43, 213; 84, 9; 89, 276).
2.3.2 Art. 6 und 7 GG
Für den Bereich der Bildung, der Pädagogik und der Sozialen Arbeit von besonderer Bedeutung sind Art. 6 und 7 GG. Gemäß Art. 6 Abs. 1 GG stehen Ehe und Familie unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Dies beinhaltet ein „Abwehrrecht“ gegenüber ungerechtfertigten Eingriffen des Staates in die Privatsphäre von Ehe und Familie, aber auch eine grundsätzliche Verpflichtung des Staates, Ehe und Familie zu fördern, etwa im Steuerrecht und im Sozialrecht (Wabnitz, 2014b, Kap. 1.2).
Gemäß Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG sind Pflege und Erziehung der Kinder das natürliche Recht der Eltern und die „zuvörderst“ – also: in erster Linie – ihnen obliegende Pflicht (dazu: BVerfGE 6, 55; 24, 119; 56, 363; 72, 122; 75, 201). Der Staat darf sich also grundsätzlich nicht in die Kindererziehung „einmischen“ – es sei denn, es droht eine Gefährdung des Wohls des Kindes. Dann ist der Staat – konkret: das Familiengericht und ggf. das Jugendamt – berechtigt und ggf. sogar verpflichtet, in Ausübung des sog. „staatlichen Wächteramtes“ gemäß Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG mit dem Ziel des Schutzes des Kindes ggf. auch in Elternrechte einzugreifen (Kap. 3.3.2 und 5.2.1 sowie bei Hömig/Antoni 2013, Art. 6, Rz. 15 ff.; Wabnitz 2014b Kap. 1.2.2; Trenczek et. al. 2014, Kap. I. 2.2.6). Allerdings gibt es gemäß Art. 6 GG kein allgemeines Erziehungsrecht des Staates im Bereich der Familie.
Anders ist dies im Bereich des Schulwesens. Ab Beginn der Schulpflicht (vgl. Art. 7 Abs. 1 GG; dazu Kap. 9.1.1) stehen Bildungs- und Erziehungsrechte von Eltern und Staat aus verfassungsrechtlicher Sicht „gleichrangig“ nebeneinander, und es kommt darauf an, dass sowohl Eltern als auch Schulen die Bildung von Kindern und Jugendlichen ab dem Schulalter gemeinsam auf möglichst optimale Weise gewährleisten (Hömig/Antoni 2013, Art. 6, Rz. 15). Das Bundesverfassungsgericht spricht in diesem Zusammenhang von der Notwendigkeit eines sinnvoll auf einander bezogenen Zusammenwirkens von Eltern und Schule (BVerfGE 34, 183; 47, 74; 52, 236).
2.3.3 Art. 12 GG
Von großer Bedeutung auch für die Bildung und Erziehung von jungen Menschen ist schließlich Art. 12 GG (Freiheit der Berufswahl und -ausübung). Danach haben alle Deutschen das Recht, Beruf und Arbeitsplatz sowie Ausbildungsstätte frei zu wählen (dazu: BVerfGE 7, 377; 78, 179). Allerdings unterliegt dieses Grundrecht – wie zum Teil auch andere Grundrechte – Einschränkungen durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes, auch etwa im Falle von Zulassungsbeschränkungen an den Hochschulen (dazu: BVerfGE 33, 303; 39, 371; 43, 45; 85, 54; BVerwGE 56, 40; 70, 319; Hömig/Hömig 2013, Art. 12, Rz 21).
Literatur
Hömig, D. (Hrsg.) (2013): Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. 10. Aufl.
Kievel, W., Knösel, P., Marx, A. (2013): Recht für soziale Berufe. Basiswissen kompakt. 7. Aufl.
Luthe, E.-W. (2003): Bildungsrecht. Leitfaden für Ausbildung, Administration und Management. Kap. B
Trenczek, T., Tammen, B., Behlert, W., Boetticher, A. von (2014): Grundzüge des Rechts. Studienbuch für soziale Berufe. 4. Aufl.
Wabnitz, R. J. (2014a): Grundkurs Recht für die Soziale Arbeit. 4. Aufl.
2.4 Fall: Bund und Länder
1. Gesundheitsminister G des Bundeslandes B ärgert sich seit langem darüber, dass das System der gesundheitlichen Versorgung in seinem Bundesland so „zersplittert“ sei und es völlig unterschiedliche und nicht miteinander „verzahnte“ Kompetenzen für die ambulante ärztliche Versorgung, die Krankenhäuser und die zahnärztliche Versorgung usw. gebe – und zudem auch noch eine Fülle von Krankenkassen. Dies alles sei unübersichtlich und kostentreibend. Er plant deshalb für sein Bundesland eine Zusammenführung dieser Strukturen in einem staatlichen Gesundheitsversorgungssystem.
2. Zwecks „Effektivitätssteigerung“ des deutschen Schulwesens plant die Bundesministerin für Bildung und Wissenschaft die Einrichtung eines Bundesschulamts auf der Grundlage eines neu zu schaffenden Bundesschulorganisationsgesetzes.
Wie wäre dieses Vorhaben verfassungsrechtlich zu beurteilen?
3. Einmal angenommen, der Deutsche Bundestag würde ein solches „Bundesschulorganisationsgesetz“ beschließen, weil es sich hier um eine „nationale“ Aufgabe handele, könnte die Landesregierung des Bundeslandes X dagegen etwas unternehmen?