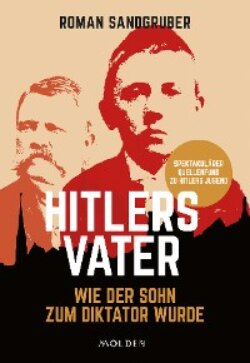Читать книгу Hitlers Vater - Roman Sandgruber - Страница 11
Aus Schicklgruber wird Hitler
ОглавлениеIm Jahr 1876 trat jenes Ereignis ein, das Adolf Hitler später einmal als die beste Entscheidung bezeichnet haben soll, die sein Vater Alois jemals getroffen hätte, seine Namensänderung. »Keine Maßnahme seines alten Herrn befriedigte ihn so vollkommen wie diese«, erinnerte sich Hitlers Jugendfreund Kubizek: »Schicklgruber erschien ihm so derb, zu bäurisch und außerdem zu umständlich und unpraktisch. Hiedler erschien ihm zu langweilig, zu weich. Aber Hitler hörte sich gut an und ließ sich leicht einprägen.«50 Das klingt zwar logisch. Aber diese Passage ist von Kubizek und seinen Koautoren mit ziemlicher Sicherheit erfunden worden. Denn Adolf Hitler wusste als Jugendlicher nichts von dieser Namensänderung, die erst 1932 öffentlich bekannt gemacht und thematisiert worden war, als der Wiener Journalist János Békessy in einer Extraausgabe des Wiener Sonn- und Montagsblatts mit der groß aufgemachten Meldung herauskam: »Hitler heißt Schicklgruber!«51 Hätte Hitler auch unter dem Namen Schicklgruber eine politische Karriere starten können? Wie hätte ein »Heil Schicklgruber!« wohl geklungen? Oder hätte eine Schicklgruber-Partei ähnlichen Zulauf gefunden wie eine Hitler-Partei? Und wäre Hüttler wie sein Ziehvater oder Hiedler wie sein Stiefvater nicht doch ein bisschen zu proletarisch oder zu weich gewesen? Solche Fragen sind berechtigt. In Deutschland war 1932 Reichspräsidentenwahl. »Es berühre sonderbar«, schrieb der Bayerische Kurier am 12. März 1932, einen Tag vor dem ersten Wahlgang, »dass der gesprächige Adolf Hitler über seine Ahnenreihe und über seinen Familiennamen sich so schweigsam erweist«.
In seinen 1954 erschienenen Lebenserinnerungen erzählt János Békessy alias Hans Habe, dass er 1932 die Beweise und Dokumente für den Namenswechsel am Pfarramt und Gemeindeamt Braunau gefunden hätte und er die dunklen Gestalten, die ihn daraufhin auf ihren Motorrädern verfolgten, nur nach einer abenteuerlichen Autojagd über 200 km auf nächtlichen Straßen bis Amstetten abschütteln konnte – das ist jedoch richtiges Reporterlatein, weil es in Braunau dazu nichts zu finden gibt und auch nie gab.52 Denn der Namenswechsel spielte sich nicht in Braunau, sondern in Weitra und Döllersheim ab: Am 6. Juni 1876 war es auf dem Weitraer Notariat zu einem merkwürdigen Zusammentreffen gekommen, im Rahmen dessen der Notar Josef Penkner zu Protokoll nahm, dass Alois Schicklgruber der legitime Sohn des längst verstorbenen Johann Georg Hiedler sei. Beim Notar waren drei angesehene Männer erschienen, die auch als Zeugen fungierten: Josef Romeder, der Schwiegersohn von Johann Nepomuk Hüttler, ferner Johann Breiteneder, ein Verwandter, und Engelbert Paukh, ein Nachbar oder ebenfalls Verwandter.53 Die drei bezeugten vor dem Notar die Vaterschaft des Johann Georg Hiedler mit ihren Unterschriften und ließen sich das auch gar nicht so niedrige Entgelt für den Notar und die 50 Kreuzer für die Stempelmarken kosten. Dass Johann Nepomuk persönlich dabei gewesen war, der eigentlich der einzige noch lebende Hauptzeuge gewesen wäre und meist als Anstifter des Ganzen genannt wird, oder Alois Schicklgruber als eigentlich Betroffener, wird in der Urkunde nicht erwähnt. Sie waren wahrscheinlich wirklich nicht anwesend. Und derjenige, der zum Vater erklärt wurde, war ohnehin schon zwanzig Jahre lang tot.
Für einen Notariatsakt ist das Schriftstück überraschend fehlerhaft und schlampig: Es fehlt das Geburtsdatum des angeblichen Vaters Johann Georg, sein Sterbedatum ist falsch (statt 9. 2. 1857 steht 5./6. 1. 1857), sein Vorname ist mit Georg und nicht Johann Georg nur verkürzt wiedergegeben, ganz abgesehen von einer etwaigen Anwesenheitsliste und der nicht gerechtfertigten neuen Schreibweise Hitler statt Hiedler oder Hüttler. Ob die Version, die vom Notar gewählt wurde, nur ein Hör- oder Schreibfehler oder ein ausdrücklicher Wunsch der Anwesenden oder gar eine bewusste Festsetzung des neuen Namensträgers Alois Hitler war, der damit vielleicht auch eine deutliche Differenzierung zu seiner ländlichen Verwandtschaft erreichen wollte, kann nicht beantwortet werden.
Am folgenden Tag nahm der Pfarrer im 20 Kilometer entfernten Döllersheim das notarielle Protokoll zur Kenntnis und trug »Georg Hitler« als legitimen Vater in das Taufbuch seiner Pfarre ein, wobei er die drei Zeugen mit drei Kreuzerln vermerkte. Wer dem Pfarrer das notarielle Protokoll überbracht hatte, ist nicht ganz klar. Dass es die drei Zeugen waren, ist unwahrscheinlich, sonst hätten sie, die nachweislich schreiben konnten, doch nicht wie Analphabeten unterzeichnet. Viel wahrscheinlicher ist, dass nur ein Bote zu dem Pfarrherrn geschickt worden war, der aufgrund des notariellen Schriftstücks den Namen »Schicklgruber« im Taufbuch durchstrich und durch »Hitler« ersetzte.
Wer wirklich die treibende Kraft hinter dem ganzen Vorgang war, ist unklar. War es Alois Schicklgruber selbst, der auf diese nachträgliche Legitimierung drängte, oder war es Johann Nepomuk Hüttler, der seinerzeit als Ziehvater fungiert hatte und nun seinen Namen fortgeführt sehen wollte, aber in anderer Schreibweise? Oder gab es andere, die daran Interesse haben konnten? Ian Kershaw sieht wie viele andere Forscher Alois als Motor, der damit den Makel, ohne Vater dazustehen, oder die Zweifel und Unklarheiten, die ihn plagten, im reifen Alter loswerden wollte. Karrierehindernis war die uneheliche Herkunft für ihn in den 1870er Jahren als Beamter sicher keines mehr und eine soziale Deklassierung oder Diskriminierung wohl auch nicht, da sowohl im Waldviertel wie im Innviertel und auch in Wien die Quoten unehelicher Geburten nahezu 50 Prozent erreicht hatten und fast einen Normalfall darstellten. Umgekehrt konnte Alois aber auch nicht voraussehen, dass ihm zehn Jahre später durch diese Legitimierung bei seiner dritten Eheschließung mit der damit zur Großnichte gewordenen Klara Pölzl eherechtliche Probleme entstehen würden. Auf eine gesetzliche Erbberechtigung nach Johann Nepomuk oder eine steuerliche Begünstigung dabei konnte er mit diesem Vorgang jedenfalls nicht hoffen.
Wenn Johann Nepomuk die treibende Kraft war, um Alois zum legitimen Anwärter auf sein Erbe zu machen und die dafür fällige Erbschaftssteuer gering zu halten, wie etwa Anna Sigmund meint, so fehlt dafür überhaupt jegliche Logik.54 Warum hätte er dann seinen Bruder vorgeschoben, wenn Alois doch sein Sohn wäre und er ihn zum Erben haben wollte? Der nun zum rechtmäßigen Vater erklärte Johann Georg war schon zwanzig Jahre tot und hätte auch damals nichts zu vererben gehabt und erst recht nicht zwanzig Jahre später. Und auf das Vermögen nach Johann Nepomuk, der zwar sicherlich nicht arm war, weder zum Zeitpunkt der Legitimierung noch zwölf Jahre später, zum Zeitpunkt seines Todes, eröffnete diese Legitimierung keine Ansprüche. Denn als Neffe wäre Alois keineswegs bevorzugter Erbe gewesen, solange noch leibliche Kinder, in diesem Fall die drei Töchter, vorhanden waren. Die nationalsozialistische Erbhof-Erbregelung, die Adolf Hitler 1935 einführen würde und die den männlichen Onkeln und Neffen gegenüber leiblichen Töchtern einen Erbvorrang einräumte, war ja 1876 mit bestem Willen nicht vorauszuahnen. Auch das steuerrechtliche Argument ist aus der Luft gegriffen, weil die 1876 geltenden Erbschaftssteuerregelungen keine derartige Staffelung der Steuersätze nach Verwandtschaftsgraden vorsahen. Und dass Derartiges später einmal kommen würde, konnten weder Alois noch Johann Nepomuk voraussehen. Wenn Johann Nepomuk tatsächlich sein ehemaliges Ziehkind Alois am Erbe teilhaben lassen wollte, hätte er es zum eigenen Sohn und nicht zum Sohn seines Bruders erklären lassen müssen. Wenn Alois von Johann Nepomuk später Vermögen erhielt, insbesondere die angeblichen 5000 fl, die er für den Kauf eines Bauernhauses in Wörnharts verwendete, so war es eine Schenkung vor Eintreten des Erbfalls.
Von anderen Autoren wird ebenfalls Johann Nepomuk als treibende Kraft hinter der Namensänderung gesehen, aus Stolz auf seinen Verwandten und Ziehsohn, der es so weit gebracht habe: »Der Anstoß zu dieser dörflichen Intrige ist zweifellos von Johann Nepomuk Hüttler ausgegangen«, schreibt John Toland: »Denn er hatte Alois erzogen und war begreiflicherweise stolz auf ihn. Alois war gerade erneut befördert worden, er hatte geheiratet und es weiter gebracht als je ein Hüttler oder Hiedler zuvor: nichts war verständlicher, als dass Johann Nepomuk das Bedürfnis empfand, den eigenen Namen in dem seines Ziehsohnes zu erhalten.«55 Das ist nicht auszuschließen, aber angesichts der geänderten Schreibweise des Familiennamens nicht sehr logisch. Es könnte aber für die tatsächlich Beteiligten, nämlich die drei beim Notar erschienenen Zeugen, insbesondere für Josef Romeder als Schwiegersohn Johann Nepomuks, das wirkliche Motiv für ihre Aussage gewesen sein: Man wollte damit einer vielleicht von diesem tatsächlich beabsichtigten Anerkennung der Vaterschaft zuvorkommen, indem dessen längst toter Bruder amtlich zu Alois Vater erklärt und Alois als Konkurrent bei einer Erbschaft nach Johann Nepomuk als nicht direkter Nachkomme ausgeschaltet wurde.
Mit der Eintragung in das Taufbuch war Alois Schicklgrubers Namensänderung amtlich. Noch im Juni, kaum zwei Wochen nach den Ereignissen in Weitra und Döllersheim, hatte der Braunauer Pfarrer von seinem dortigen Amtsbruder erfahren, dass Alois Schicklgruber nunmehr Alois Hitler heißt. Natürlich erforderte diese Änderung auch bürokratische Schritte bei den staatlichen Stellen. Nachweisbar ist, dass die für Döllersheim zuständige Bezirkshauptmannschaft Mistelbach, als sie von der Legitimierung erfuhr, deswegen mit der Braunauer Finanzdirektion korrespondierte und sich sowohl beim bischöflichen Sekretariat in St. Pölten als auch bei der Wiener Statthalterei über die Rechtmäßigkeit der Vorgangsweise des Döllersheimer Pfarrers informierte. Am 6. Oktober 1876 erhielt sie von der Statthalterei einen bestätigenden Bescheid, dass der k.k. Zollamtsoffizial Alois Schicklgruber nunmehr den Namen »Alois Hitler« führen dürfe. Als die Bezirkshauptmannschaft Mistelbach immer noch zweifelte und am 8. Dezember bei der Statthalterei nochmals nachfragte, ob nunmehr auch die Dokumente des Alois Schicklgruber »auf Hitler« umgeschrieben werden müssten, wurde ihr am 27. Dezember mitgeteilt: »Zurück mit dem Bemerken, dass die mit dem Berichte vom 8. Dezember 1876 … wiederholt gestellte Anfrage schon … (am) 30. November 1876 … ihre Beantwortung gefunden hat.« 56
Über den gesellschaftlichen Diskurs im kleinbürgerlichen Braunau, der durch so einen Schritt ausgelöst worden sein muss, bei seinen Arbeitskollegen, am Stammtisch, im Tratsch auf dem Kirchenplatz, in der Nachbarschaft und in den Vereinen, wissen wir nichts. Im Innviertel waren der Umgang mit unehelichen Kindern und die damit verbundenen Namensänderungen ohnehin alltäglich.
Dienst unter dem Doppeladler: Mit der neuen Brücke über den Inn gewann das »Nebenzollamt erster Klasse« in Braunau weiter an Bedeutung. Hier begann Alois 42 Hitler 1871 seine Arbeit als Zollbeamter.