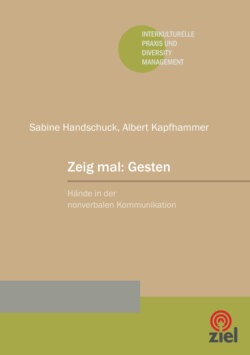Читать книгу Zeig mal: Gesten - Sabine Handschuck - Страница 9
Оглавление„Küss die Hand, gnä’ Frau“.
Inzwischen veraltete österreichische Begrüßungsformel
3. FORMEN DER BEGRÜSSUNG
Begegnen sich zwei Menschen, beginnt der Kontakt in der Regel mit einer Begrüßung. Man nickt sich zu, reicht sich die Hand, verbeugt sich oder sagt „Hallo“. Sich zu grüßen, ist ein Akt des Respektes, kann eine Geste des Willkommens sein, der Höflichkeitsetikette oder ein Ausdruck des Erkennens und Anerkennens von Zugehörigkeit. Kluge (1999: 342) vermutet, dass das Wort „Gruß“ aus dem lateinischen Wort „gratus“ abgleitet wurde, welches „lieb“ oder „willkommen“ bedeutet.
Begrüßungen haben in unterschiedlichen Gesellschaften sehr unterschiedliche Formen und gehen mit ritualisierten oder formalisierten Gesten einher. Nach Röhrich (1994: 591) lässt sich aus der Gruß-Sitte einer Gesellschaft ihre „ganze Kulturgeschichte“ ablesen. Die früheste Form des in Deutschland üblichen Grußes – Händedruck oder Handschlag – ist zunächst die Bekundung einer friedlichen Gesinnung durch das Ineinanderlegen der waffenlosen Hand. Auch das Heben der rechten Hand zum Gruß zeigt an, dass die waffentragende Hand leer ist, man sich also in friedlicher Absicht nähert.
Welche Grußform als angemessen gilt, ist nicht nur kulturabhängig, sie ist auch durch den jeweiligen Kontext der Begegnung bestimmt: wie gut sich die Begrüßenden kennen, welche Beziehung sie zueinander haben oder ob es sich um eine formelle oder informelle Begegnung handelt. Weiter spielen Generationszugehörigkeit oder die Zugehörigkeit zu einer subkulturellen Gruppe eine Rolle, welchen sozialen Status die sich begrüßenden Personen haben und ob sie Mann oder Frau sind.
Bestimmte Grußformen können die Zugehörigkeit zu einer politischen oder sozialen Bewegung ausdrücken – wie die erhobene Faust der Black-Power-Bewegung. Andere Gesten zeigen die Verbundenheit mit einer Sport-, Freundes- oder Interessensgruppe, wie der unter Surfern übliche „Hang Loose“ oder die „gehörnte Hand”, die in der Metal-Szene auch als Grußzeichen eingesetzt wird; auch das „Hook ‘em Horns”, mit dem sich Fans der amerikanischen Football-Mannschaft „Texas Longhorns” der Universität Texas begrüßen oder ihre Mannschaft anfeuern, gehört dazu. Regionale Eigenheiten spielen ebenfalls eine Rolle. Der erhobene kleine Finger – „Klenkes“ – ist beispielsweise in der deutschen Stadt Aachen eine Grußgeste. Es gibt auch Gestenformen, die extreme, verfassungswidrige Meinungen repräsentieren. So ist in Deutschland der „Hitlergruß“ verboten, mit dem Rechtsradikale ihre Gesinnung ausdrücken.
Grußformen unterliegen Moden, veralten, werden variiert oder durch neue Grußgesten ersetzt. Das „Hutziehen“ oder der „Handkuss“ als respektvolle Grüße in Deutschland sind inzwischen ebenso aus der Mode gekommen wie das „Hi“ der 1968er-Generation, das sich nur in wenigen subkulturellen Kontexten gehalten hat. Auch der „Knicks“ und der „Diener“, die in den 1950er Jahren noch Mädchen und Jungen gegenüber Erwachsenen bei einer „artigen“ Begrüßung als Respekterweis abverlangt wurden, sind obsolet. Vor allem in männlichen Jugendcliquen kann es Mode sein, sich mit Fauststoß, Abklatschen „high five“ oder mit ganzen Bewegungsabläufen zu begrüßen. Die in Italien gängige Begrüßung mit „Küsschen“ rechts und links auf die Wangen wird auch unter Bekannten in Deutschland immer üblicher, während beispielsweise in den Niederlanden oder in der Schweiz ein dritter Kuss obligatorisch ist. Der Kuss auf den Mund ist in Deutschland nur Liebenden vorbehalten, während in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion der sozialistische Bruderkuss bei Staatsbesuchen üblich war. Inzwischen reicht auch in den osteuropäischen Ländern ein Händedruck.
Grußformen verändern sich in allen Gesellschaften. Traditionelle Grußrituale, wie beispielsweise der Nasengruß der Maori in Neuseeland gehören immer weniger zur alltäglichen Begegnung zwischen Gleichgestellten, sondern sind der rituellen Begrüßung, beispielsweise der von Staatsgästen, vorbehalten.
Nicht nur beim militärischen Gruß regelt es die Etikette, wer wen zuerst grüßt. Auch im Alltag gibt es Verhaltensregeln, die sich von Gesellschaft zu Gesellschaft unterscheiden können. So gilt es in Deutschland als höflich, dass zunächst die Frau und erst dann der Mann bei einem Besuch mit Handschlag begrüßt werden, während es in arabischen Ländern üblich ist, dass der Gast zunächst den Gastgeber mit einem sanften Händedruck begrüßt, der Gastgeberin aber nur freundlich zunickt.
Eine Person nicht zu begrüßen, ist in allen Gesellschaften eine Kränkung. Einen Gruß zu verweigern, ist ein deutliches Zeichen für einen Konflikt oder eine tief sitzende Ablehnung. Immer wieder ist in interkulturellen Seminaren Thema, wer sich wem anzupassen hat. Besonders die Verweigerung der Begrüßung mit Handschlag wird als Unhöflichkeit wahrgenommen; handelt es sich um Mann und Frau, so wird die Verweigerung als Abwertung der Frau und Missachtung der Gleichberechtigung aufgefasst. Das ist unabhängig davon, welcher Herkunft die Person ist, die womöglich einen Händedruck als unangenehm empfindet oder andere Vorstellungen davon hat, was als angemessene Begrüßung gilt.
Im dritten Teil zeigt die Übung „Standpunkt und Bewegung – Begrüßungsgesten“ in sechzehn unterschiedlichen Formen der Begrüßung in verschiedenen Gesellschaften und Subkulturen. Die Übung „Statement“ dient der Meinungsbildung, sie greift Fragen nach Anpassung und Abgrenzung und den Umgang mit Unterschieden auf.