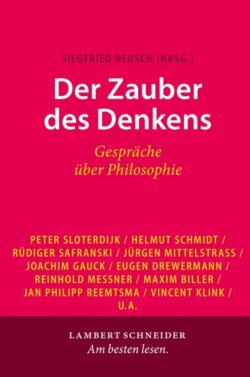Читать книгу Der Zauber des Denkens - Siegfried Reusch - Страница 11
Wer will bezweifeln, dass die Hasen vor der Tür auch ohne uns herumlaufen?
ОглавлениеBei einer Straßenumfrage haben wir Passanten gefragt, was sie unter Wahrheit verstehen. Was antwortet uns der Wissenschaftstheoretiker Jürgen Mittelstraß ganz spontan auf diese Frage?
Wahrheit ist der Wunsch aller Philosophen. Das heißt, Wahrheit ist das, was in einem theoretischen Zusammenhang in dem Sinne wahr ist, dass es ein Stück Wirklichkeit angemessen wiedergibt. Zugleich ist es etwas, das sich im Dialog, gegenüber Einsprüchen und konstruktiver Kritik bewährt.
Folglich existiert für Sie so etwas wie eine Wirklichkeit. Vertreten Sie eine Korrespondenztheorie der Wahrheit, derzufolge Wahrheit ein Maß für die Übereinstimmung des Denkens mit der Wirklichkeit ist?
Nein. Ich will nicht bezweifeln, dass es eine Wirklichkeit gibt, aber der Begriff der Wirklichkeit im Zusammenhang mit Wahrheitstheorien hat seine besonderen Schwierigkeiten. Allzu leicht ergibt sich im Sinne einer solchen Korrespondenztheorie der Wahrheit die Vorstellung, es gäbe auf der einen Seite so etwas wie die Wirklichkeit, auf der anderen Seite unsere Welt der Worte. Wahrheit in der Welt der Worte wäre dann die spiegelbildliche Abbildung der Wirklichkeit. So einfach ist es eben nicht. Wir müssten dann einen direkten, nichtsprachlichen Zugang zu dieser Wirklichkeit haben. Und einen derartigen Zugang haben wir nicht, weil wir immer schon von Wirklichkeit als einer gegliederten, unterschiedenen, damit auch sprachlich gegliederten und sprachlich unterschiedenen Wirklichkeit sprechen.
Ist Wahrheit demnach etwas Relatives?
Nein, das ist damit nicht gesagt. Relativ vielleicht nur insofern, als es „die“ Wirklichkeit als „die“ Instanz, die über wahr und falsch entscheidet, nicht gibt. Die Behauptung, dass die Wahrheit relativ sei, ist eine Behauptung, die sehr viel weiter geht, sie besagt, dass sich Geltungsansprüche – Wahrheitsansprüche sind Geltungsansprüche – nie einlösen lassen. Das meine ich nicht. Innerhalb eines bestimmten theoretischen Rahmens ist Wahrheit nicht relativ.
Sind Sie Konstruktivist?
Ich komme aus einer Schule, die als „Erlanger Schule“ bezeichnet wurde und die sich als Konstruktivismus bezeichnet. In der Tat verstehe ich mich als Konstruktivist – aber nicht im Sinne des sogenannten radikalen Konstruktivismus, der die Wirklichkeit in reine Konstruktionen auflöst und dabei biologistisch argumentiert. Wir konstruieren immer schon in einer bestimmten Wirklichkeit und in eine bestimmte Wirklichkeit hinein. Ohne eine solche Wirklichkeit, die immer eine praxisbezogene, handlungsbezogene ist, machen alle diese Konstruktionen keinen Sinn. Das bedeutet, dass sich der radikale Konstruktivismus gewissermaßen an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen sucht.
Was genau verstehen Sie unter „konstruieren“?
Sagen wir es einmal so: Der Konstruktivismus geht davon aus, dass wir unsere Unterscheidungen, damit auch unsere Theorien, nicht an einer wie auch immer gearteten Wirklichkeit ablesen können. Die Wirklichkeit sagt nicht von sich aus, wie sie ist. Unser Bild der Wirklichkeit ist immer ein solches, in das unsere gliedernden und unterscheidenden Aktivitäten Eingang gefunden haben. Insofern bewegen wir uns in einer teils unabhängig von uns existierenden, teils durch unsere Unterscheidungen und Begrifflichkeiten gegliederten Welt. Wer will bezweifeln, dass die Hasen vor der Tür auch ohne uns herumlaufen? Doch fein säuberlich zu unterscheiden „Hier ist die Welt, wie sie ist!“ und „Hier ist die Welt, wie wir sie gegliedert haben!“ geht nicht. Das ist in der Tat ein konstruktivistisches Credo.
Schließt dieses Credo aus, dass wir der „Wirklichkeit“ zumindest partiell „näher“ kommen können?
Dieses Bild würde ich nicht verwenden. Hinter ihm steht immer noch die Vorstellung, es gäbe eine „Welt wie sie ist“ und wir könnten in einem beharrlichen Versuch uns dieser Wirklichkeit immer weiter nähern. Das ist eine Vorstellung, die merkwürdigerweise von Popper vertreten wurde, obwohl er eigentlich eine Philosophie vertritt, die diese Vorstellung von Wirklichkeit oder Wahrheit nicht mehr zulässt. Gleichwohl spricht er von einer allmählichen Annäherung oder doch dem Versuch einer Annäherung an die Wahrheit. So würde man im Konstruktivismus nicht sprechen und so möchte auch ich nicht reden. An dieser Stelle möchte ich vorschlagen, von mehr oder weniger angemessenen und unangemessenen Unterscheidungen zu sprechen. Denn darüber kann kein Zweifel bestehen, dass unsere Unterscheidungen einmal, wie wir so schön sagen, sitzen und einmal nicht, dass sie sich in diesem Falle als unzweckmäßig erweisen, nicht nur weil wir auf diese Weise, wie wir sagen, ein Stück Wirklichkeit nur unzureichend erkennen, sondern auch, weil wir mit unseren eigenen Orientierungen nicht mehr zu Rande kommen. Einen Prozess, der – möglicherweise auch kontinuierlichen – Verbesserung von Unterscheidungen gibt es, aber diesen Prozess sollte man nicht belasten mit der zusätzlichen Annahme, dass dieser ein Prozess der allmählichen Annäherung an die Wahrheit ist. Damit formuliert man Ansprüche, die einzulösen ohne Rekurs auf eine Wirklichkeit, wie sie an sich ist, unmöglich ist.
Andererseits kann, wie Sie sagten, keiner daran zweifeln, dass draußen die Hasen auch ohne uns herumspringen. Gibt es möglicherweise eine nichtwissenschaftliche und eine wissenschaftliche Wirklichkeit?
Ja. Nur dass das keine Wirklichkeiten sind, die irgendwo fix und fertig dastehen. Wir gehen nicht von der einen in die andere, sondern in unserem eigenen Tun, auch in unserem kooperativen Tun, erzeugen wir diese Wirklichkeiten. Wenn Sie die Universität betreten, um dort zu studieren oder zu lehren, bewegen Sie sich zweifellos in einer anderen Wirklichkeit als wenn Sie nach Hause gehen, in die Arme Ihrer Familie zurückkehren, abends am Stammtisch sitzen oder auf den Sportplatz gehen. Das sind unterschiedliche Wirklichkeiten, aber doch solche, die durch unser Tun ständig miteinander verbunden werden – durch dieses Tun werden sie eigentlich erst erzeugt. Die Vorstellung des Konstruktivismus ist die, dass auch die Wissenschaft, unser theoretisches Sprechen eine Art unseres lebensweltlichen Sprechens ist. Es ist eines der Programme des Konstruktivismus, die sprachliche Praxis so zu reorganisieren, dass bestimmte Schwierigkeiten, die dann auch als sprachliche Schwierigkeiten erkennbar sind, nicht mehr auftreten; das heißt, dass jene so gar nicht verständliche Trennung der „Welt der Wissenschaftler“ und der Welt, in der wir alle leben, auch wenn wir nicht Wissenschaftler sind, wieder aufgehoben wird.
Eine andere Frage ist die, ob man sich Lebensweltformen vorstellen kann, die diese Verlängerung in die Wissenschaft, in die Welt der Theorien nicht finden oder nicht finden können. Lebensweltformen also, die die europäische Rationalität und Wissenschaft nicht zulassen. Allerdings liegt es mir näher, nicht der Frage nachzugehen, wie die Welt denn auch noch hätte aussehen können, wenn der europäische Geist nicht tätig geworden wäre, sondern mit einer Welt fertig zu werden, in der der europäische Geist tätig ist.
Wäre „Interpretation der Wirklichkeit“ für das, was Sie unter Konstruktivismus verstehen, eine angemessene Umschreibung?
In der Tendenz ja. Andererseits ist mir die Theorie der Interpretation oder wie immer man eine entsprechende Richtung bezeichnen möchte, etwas pointiert formuliert, zu hermeneutisch, soll heißen, noch zu sehr an der Vorstellung orientiert, dass es Dinge, wie sie sind oder wie wir sie sehen, zu verstehen gilt. Für mich suggerieren die Begriffe der Interpretation und des Verstehens einen Zusammenhang, der für die Geisteswissenschaften konstitutiv ist, aber schon für andere wissenschaftliche Bereiche eigentümlich zu kurz greift.
Sie haben von Rationalität gesprochen. Heißt das Begründung von irgendwelchen Aussagen mittels rationaler Verfahren?
Es ist natürlich schwer, in wenigen Worten jetzt so etwas wie Rationalität definieren zu wollen. Man wird mehr oder weniger einschlägige Merkmale benennen wollen, und so möchte ich das auch tun. Ich will als rational oder als eine rationale Position eine solche bezeichnen, die Geltungsansprüche formuliert und deren Einlösung nicht nach außen abgibt. Die Bemühung um Rationalität bedeutet, sehr genau zu unterscheiden, seine Behauptungen sehr genau zu wägen, jederzeit bereit zu sein, die mit diesen Behauptungen formulierten Geltungsansprüche einzulösen, all dies nicht abzugeben an Instanzen, die entweder vorgeben, dies zu leisten, oder von denen man erwartet, dass sie dies leisten. Gegensatz wäre also eine mythische oder fundamentalistische Welt, in der uns entsprechende Bemühungen von überweltlichen Mächten abgenommen werden. Hier vertrete ich die Idee der europäischen Aufklärung.
Die Frage nach der Rationalität ist auch eine Frage nach der Begründung. Wann ist eine wissenschaftliche Begründung wirklich begründet?
Es ist ein Unterschied, ob Sie einen mathematischen Satz begründen oder beweisen, oder ob Sie eine gesellschaftstheoretische Hypothese begründen. Man wird in einem allgemeinen Sinne sagen können, dass wir von „Begründung“ und „begründet“ genau dann sprechen, wenn die offensichtlichen Geltungsansprüche eingelöst sind und keine Alternative aufgetreten ist, die auf eine andere Weise das leistet, was Theorien oder Sätze, die als begründet gelten, leisten. Eine Begründung ist in diesem Sinne auch nie definitiv abgeschlossen im Sinne von letztbegründet. Dies wäre von vornherein dogmatisch. Ich selbst halte nur einen Begründungsanspruch für vertretbar, in dem Exklusivität nicht mitbehauptet wird, Exklusivität in dem Sinne, dass es zu einer gegebenen Begründung keine Alternativen gäbe. Allerdings – und das ist etwas, was immer hinzugefügt werden muss –, das, was dann konkurrierend auftritt, muss mindestens ebenso gut begründet sein und sich als begründet ausweisen können wie der Versuch, gegen den es sich wendet. Mit dem bloßen Hinweis, es gibt ja keine absoluten oder Letztbegründungen, wäre jede Begründung gleich gut – und das ist keine Alternative.
Gibt es demnach auch keine absoluten Normen?
Wenn wir von absoluten Begründungen sprechen, dann meinen wir, ein Sachverhalt sei ein für allemal in einer bestimmten Weise erklärt, der entsprechende Satz oder die entsprechende Theorie begründet, und dazu gäbe es keine Alternativen. Das ist problematisch. Die Rede von absoluten Normen liegt noch einmal auf einer anderen Ebene, allein schon, weil die Rede von Begründungen bei Normen ihre besonderen Schwierigkeiten hat. Aber selbst da, meine ich, sollte man nicht so zimperlich sein. Es ist die Frage, was man als eine absolute Norm bezeichnet. Wenn man den kategorischen Imperativ oder die Menschenrechte als absolute Normen bezeichnet, dann hätte ich nichts gegen den Begriff der absoluten Norm. Die Bezeichnung „absolute Norm“ wird nur dann problematisch, wenn damit Inhaltliches gemeint ist. Solange wir es mit formalen Normen zu tun haben, und das ist ja beim kategorischen Imperativ der Fall, bringt uns auch die Bezeichnung „absolut“ in keine Schwierigkeiten.
Aber den Europäern wird doch vorgeworfen, dass gerade in den „Menschenrechten“ Werte schon implizit enthalten sind.
Das ist wahr. Insofern habe ich auch ein wenig gezögert, als ich dieses zweite Beispiel nannte. Es kommt sehr darauf an, was man mit Menschenrechten alles meint. Wenn das bis in den pädagogisch-schulischen Bereich geht, etwa im Sinne von Recht auf Bildung, Recht auf Erziehung, nein. Wenn Sie die Rede von Menschenrechten aber zunächst einmal einschränken, etwa auf den Begriff der autonomen Person, dann meine ich, sind auch solche Einsprüche leicht zu ertragen.
Dies ist natürlich abhängig vom Menschenbild.
Naja, aber sehen Sie, wollen wir wieder ein Menschenbild zur Diskussion stellen, das es dem Einzelnen überlässt, sich in der Alternative von Herr und Knecht zu orientieren? Ich möchte das nicht empfehlen.
Letztlich gelangt man immer wieder bei ethischen Glaubenssätzen an, die wiederum einer Begründung bedürfen.
Sie haben Philosophie einmal als „Theorie der Begründung“ bezeichnet. Erschöpft sich Philosophie in der Aufgabe der Rechtfertigung von Zwecken und Zielen – oder wird „in Form von Wissenschaftstheorie Wissenschaft philosophisch und Philosophie wissenschaftlich“?
Das war damals der Konstruktivismus auf die Spitze getrieben. Ich erinnere mich sehr wohl an diese Formulierung. Da habe ich, was ich gerne auch heute noch tue, bewusst pointiert formuliert. Mittlerweile glaube ich – vielleicht ist das jetzt mein höheres Alter, das mich dazu führt –, dass sich die Philosophie in solchen Definitionen und näheren Bestimmungen nicht erschöpft. So würde ich es denn auch heute wahrscheinlich nicht mehr sagen. Allerdings: An einem möchte ich gerne festhalten – und das besagt ja auch das Zitat, das Sie eben anführten: Ich sähe es gerne, wenn die akademische Philosophie an der Universität wieder näher an die Probleme auch der anderen Disziplinen herangerückt würde und wenn die anderen Disziplinen, die bisher sozusagen einen gepflegten Positivismus ausgebildet haben, wieder philosophischer würden. Denn ihre weitgehende Wirkungslosigkeit hat die Philosophie zum Teil selbst zu vertreten, insofern sie sich in eigentümlicher Vornehmheit aus dem Alltag der Wissenschaften und der wissenschaftlichen Auseinandersetzung – nicht immer, aber häufig – herausgezogen hat. Die Philosophie muss sich wieder stärker involvieren lassen oder sich stärker einmischen in das Alltagsgeschäft der Universität, der Wissenschaft, ja, und auch der Gesellschaft.
Ist es denn nicht gerade das Gegenteil von Einmischung, wenn Sie in einer Diskussion auf die Frage, ob wir es nicht nach Goethe so halten sollten, dass wir das Erforschliche erforschen und – aus ethischen Gründen – das Unerforschliche unerforscht lassen sollten, antworteten, dass, wer nicht das Unerforschliche zumindest probiere, beim Erforschlichen Durchschnitt bleibe?
Lassen Sie mich weiter ausholen und sagen: Wenn wir denn schon so genau wüssten, wo die Grenze zwischen dem Erforschbaren und dem Unerforschbaren läge, dann wären wir an dieser Stelle sehr viel klüger. Aber genau das wissen wir ja nicht. Und jede Entscheidung oder jede Behauptung, man wüsste das schon, jeder Versuch, eine solche Grenze definitiv zu ziehen, ist – mindestens dies! – dogmatisch. Das heißt, wir haben, ob wir das nun begrüßen oder nicht, nicht die Möglichkeit, viele unserer Probleme dadurch loszuwerden, dass wir sagen: Hier ist das Erforschbare, und hier haben wir sozusagen freie Wahl, dort ist das Nichterforschbare, und da gehen wir nicht hin, das steht auch nicht zur Disposition und da halten wir uns raus. So ist die Welt nicht. Schon gar nicht so dualistisch. Das eigentliche Problem liegt eben genau darin, immer wieder aufs Neue eine solche Linie zu ziehen – warum nicht? Es wird sich dabei auch herausstellen, dass es sich da um keine festen Linien handelt und dass es die Forschung selber ist, die alle gezogenen Linien immer wieder übersteigt.
Das heißt, provokant auf einen Nenner gebracht: Die Forscher, zum Beispiel die Gentechniker, forschen und zeigen dadurch die Problematik des Ganzen auf, ohne jegliche Kontrolle?
Nein, das wollte ich damit nicht gesagt haben. Meine Vorstellung ist eher die, dass wir uns sehr wohl, und vielleicht sehr viel stärker, als das früher der Fall war, in unserem Forschen und Tun, für das wir mit Recht Freiheit reklamieren, immer wieder die Frage stellen, ob, unter anderem aus schlicht forschungssystematischen Gesichtspunkten, das, was wir da tun – noch einmal: Wissenschaft ist Tun! –, nicht Grenzen ganz anderer Art überschreitet, nämlich ethische Grenzen. Das heißt konkret gesprochen, ob zum Beispiel Forschung an Embryonen, insbesondere dann, wenn diese auch noch eigens zu Forschungszwecken hergestellt werden, nun aus anderen als wissenschaftssystematischen Gründen vielleicht doch verboten sein sollte, weil wir nämlich Grenzen verletzen, die keine Forschungsgrenzen sind, sondern ethische Grenzen.
Aber wer definiert diese ethischen Grenzen?
Wenn wir so etwas hätten wie eine allgemeingültige Ethik oder eine göttliche Ethik, dann wäre diese Frage einfach zu beantworten. Wir haben sie nicht. Ethik ist auch kein Lehrbuchwissen, das wir irgendwo in einem entsprechenden Buch nachschlagen könnten.
Die Welt wäre sicherlich einfacher, wenn sich auch in unserem Tun, auch in unserem wissenschaftlichen Tun, irgendwelche Gesetzmäßigkeiten einfach durchsetzten, keine normativen Spielräume mehr gegeben wären. Aber was wäre das für eine komische Welt? In dieser Welt müsste sich ja der Mensch als ein verantwortungsvolles, rationales Wesen selber verabschieden. Also lieber diese Kontingenz, lieber diese Spielräume, lieber die Möglichkeit zu scheitern und sich zu irren, als in einer Welt zu leben, in der Naturgesetzmäßigkeiten auch die Welt unseres Tuns bestimmen.
Wir müssen uns auch in ethischen Dingen immer wieder aufs Neue des begründeten Charakters unserer ethischen Beurteilungen vergewissern. Auch die Ethik ist in diesem Sinne nichts Statisches, auch wenn das häufig, zumal in eher traditionellen oder konservativen Kreisen, so formuliert wird. Vielleicht müssen wir den erforderlichen ethischen Sachverstand, zu dem auch, aber keineswegs allein, der philosophische Sachverstand gehört, mehr üben.
Haben Sie konkrete Vorstellungen, in welchem institutionellen Rahmen so etwas zum Beispiel in der Universität geschehen könnte?
Nun ja, keine sehr ausgearbeiteten Vorstellungen. Aber doch die, dass wir wahrscheinlich gut daran täten, im Prozess des Lehrens, Lernens und Forschens – also an einer Universität, wo wir den wissenschaftlichen Nachwuchs ausbilden – diese Dinge zu berücksichtigen. Wenn wir weiterhin so ausbilden, wie das früher einmal der Fall war, dass nämlich solche Fragestellungen im Zuge der Ausbildung überhaupt nicht auftreten, dann müssen wir uns auch nicht wundern, wenn wir auf diese Weise Wissenschaftler erzeugen, die später schlicht unfähig sind, in ethisch relevanten Situationen auch nur halbwegs rational zu agieren. Meine erste Empfehlung wäre deshalb, in die Ausbildung an den Universitäten, dort wo diese Ausbildung selbst forschungsbezogen ist, solche Fragestellungen stärker einzubeziehen. Wenn es uns nicht gelingt, Wissenschaftler so auszubilden, dass diese von vorneherein ein Gefühl dafür, ein Bewusstsein davon haben, dass ihr Tun auch eine ethisch relevante Seite hat, dann werden wir das auch durch irgendwelche Institutionen, die wir nachträglich erfinden, nicht kompensieren können. Womit ich nicht sagen will, dass solche Institutionen, die wir gewissermaßen nachträglich erfinden, keinen Sinn haben, wie etwa Ethikkommissionen in der Medizin. Die scheinen ja ganz gut zu funktionieren, und die werden mittlerweile auch akzeptiert. Sie will ich auch gar nicht brotlos machen; aber wir sollten die Ausbildung des wissenschaftlichen Subjekts nicht nur in Richtung Forschung, sondern auch in Richtung Ethik verbessern.
Ethik oder Philosophie als Pflichtfächer?
Wie man das studienmäßig organisiert, ist eine andere Frage. Ich bin im Übrigen der Meinung, dass die Art und Weise, wie wir unsere Studiengänge in der Regel hermetisch abgeschlossen gegenüber anderen Studiengängen organisieren, der falsche Weg ist. Wir müssen das Studium – auch in engeren zeitlichen Grenzen, das muss mit solchen Bemühungen nicht kollidieren – wieder so organisieren, dass Formen der Interdisziplinarität oder Transdisziplinarität zu den selbstverständlichen Elementen eines Studiums gehören.
Meinen Sie mit Ihrer Kritik an der „unendlichen Beliebigkeit der Fächeraufspaltung“, dass der interdisziplinäre Austausch gehemmt ist, oder meinen Sie, dass es zu viele wirklich neue Studienfächer gibt?
Beides, beides. Ich glaube zunächst einmal, dass irgendetwas im Wissenschaftssystem falsch gelaufen ist, insofern wir eine wohl unvermeidliche Spezialisierung in der Forschung sofort institutionalisiert haben. Interdisziplinarität ist da häufig nur der verzweifelte und in der Regel vergebliche Versuch, im Nachhinein wieder zusammenzuführen, was die wundersame Vermehrung der Disziplinaritäten und Fachlichkeiten trennt. Ich denke, dass in diesem Punkt die Reform sehr viel radikaler ansetzen muss. Wir müssen die institutionelle Zerlegung der Wissenschaft wieder auflösen. Wir müssen, mit anderen Worten, größere Fachbereiche bilden, in denen zum Beispiel der Chemiker wieder mit dem Physiker, mit dem Biologen und so weiter wirklich zusammenarbeitet und auch zusammen ausbildet. Wir haben im Grunde das Gegenteil getan. Wir haben alles getan, um nur jede vernünftige Interdisziplinarität und Transdisziplinarität in Studium und Lehre zu verhindern.
Kann ein Chemiker wirklich noch hochqualifizierte Forschung betreiben, wenn er gleichzeitig mit Biologen und Physikern zusammenarbeitet und auch noch ethische Aspekte berücksichtigt?
Wir müssen hier zwischen dem Forschungskontext im engeren und dem Ausbildungskontext im weiteren Sinne unterscheiden. Es ist wohl so, dass große wissenschaftliche Leistungen zunehmend ein hohes Maß an Spezialisierung voraussetzen. Nur, verlangen sollte man, dass in Ausbildungs- und Lehrzusammenhängen derjenige, der vielleicht in Forschungszusammenhängen längst ein einsamer Spezialist geworden ist, mehr zusammenbringt als seine Spezialitäten. Das Dilemma kriegen wir dadurch, dass wir die Lehre über die Forschung definieren und so den forschenden Spezialisten zum lehrenden Spezialisten machen. Meine Vorstellung ist immer noch die, dass ein anständiger Hochschullehrer, der in der Forschung Spezialist ist, in der Lehre sein Fach in möglichst großer Breite vertreten kann – was auch ethische Fragestellungen einschließt. Nur, solche Persönlichkeiten, Hochschullehrerpersönlichkeiten, tja, die wachsen auch nicht wie die Blumen auf dem Felde.
In der heutigen „Massenuniversität“ sehen selbst viele Studierende das Studium ausschließlich als Berufsausbildung. Wie sollen in diesem Klima noch derartige Fragen behandelt werden? Würden Sie, auch unter diesem Aspekt, einen berufsqualifizierenden Abschluss nach circa sechs Semestern befürworten?
Wenn das mit zwei Dingen nicht verbunden ist, bin ich dafür. Wenn es erstens nicht damit verbunden ist, dass wir so etwas wie Kurzstudiengänge in der Universität wiedererfinden; Kurzstudiengänge in der Form, dass all das, was bisher in ein zehn- oder zwölfsemestriges Studium gepackt ist, nun in einem sechssemestrigen untergebracht werden soll. Alle Versuche dieser Art sind fehlgeschlagen. Und wenn zweitens auch nicht gemeint ist, dass man jetzt die Universitätsausbildung insgesamt zerlegt in einen stark verschulten und stark entwissenschaftlichten Teil, der etwa bis zum vierten oder sechsten Semester führt, und in einen im engeren Sinne wissenschaftlichen Teil. Dann zerlegt man nicht nur das Studium, sondern dann zerlegt man die Universität. Universität findet dann eigentlich nur noch nach dem sechsten Semester statt. Das zweite droht ja jetzt, wie Sie wissen, und da bin ich vehement dagegen. Das wird die Universität zerstören und auch die Ausbildung, die wir eigentlich an Universitäten suchen und erwarten, nämlich die wissenschaftliche Ausbildung. Es war die Stärke der deutschen Universität, diese Zerlegung gerade nicht zu haben.
Wenn Sie aber meinen, dass es möglich sein muss, nach einem sechssemestrigen Studium, immerhin nach drei Jahren, ich unterstelle mal, intensiven Studiums, mit einem Zertifikat, das genau dieses belegt, die Universität zu verlassen, dann finde ich das vernünftig.
Das richtige Maß zu finden zwischen einem völlig verschulten Unterricht einerseits und einem illusionären wissenschaftlichen Unterricht andererseits – gut, das wird das Kunststück sein. Es kann nicht Zweck der Universitätsveranstaltung sein, dass jemand, der die Universität betritt, sich einfach nur in die nächste Klasse versetzt fühlt, einfach seine Schule weiter treibt. Ich wittere hinter solchen Überlegungen, wie sie im Moment insbesondere in den administrativen und bürokratischen Köpfen stattfinden, mehr als nur die Absicht, das Studium studierbarer zu machen. Ich bin voller Argwohn, wenn ich die momentanen Tendenzen verfolge.
In diesem Zusammenhang fällt auch sehr gerne und sehr kontrovers das Stichwort „Elite“.
Das Missliche in diesem Zusammenhang ist, dass das Wort „Elite“ so belastet ist. Aber ich habe keine Berührungsängste. Ich provoziere auch gerne und benutze deswegen gelegentlich selbst das Wort „Elite“. Ich bin davon überzeugt, dass unser Wissenschaftssystem genauso wie unser sportliches System – da akzeptieren wir es ja! – die Hochleistung braucht. Wir brauchen so etwas wie eine wissenschaftliche Elite, aber wir brauchen sie nicht überall. Auch der Postbote, sofern er überhaupt noch läuft, muss die 100 Meter nicht in elf Sekunden laufen. Das kann auch ein bisschen langsamer gehen. Und so ist es auch in Bereichen, für die die Universität wissenschaftlich ausbildet.
Ich bin auch kein Vertreter von Elitehochschulen. Ich warne eher vor einem System, das auf diesem Begriff aufgebaut ist, wie das amerikanische, das französische und in Grenzen das englische System. Ich bin aber sehr wohl ein Vertreter derjenigen, die meinen, dass wir alles tun müssen, um wissenschaftliche Hochleistung zu ermöglichen. Überall dort, wo wir institutionelle oder andere Hindernisse sehen, müssen wir sie zu diesem Zweck aus dem Weg räumen.
Gibt es grundsätzliche, hochleistungshemmende Elemente in unserem Hochschulsystem?
Nein. Ich glaube, dass sich die Qualität, der Leistungswille auch unter den gegebenen Verhältnissen durchsetzen kann. Und das ist auch gut so. Worauf man achten muss, ist nur, dass nicht doch strukturelle Bedingungen auftreten, zum Beispiel überfüllte Seminare oder fehlende Geräte, die tatsächlich die Entfaltung der Höchstleistung behindern. Eine Universität oder eine Gesellschaft, die darüber klagt, dass ihre Studenten zu lange studieren, aber nicht in der Lage ist, ein Studium so zu organisieren, dass es auch wirklich in einer angemessenen Zeit studiert werden kann, die macht eben ganz woanders Fehler.
Sie waren Mitglied der Strukturkommissionen von Sachsen und Berlin. In den neuen Bundesländern hatten Sie während der Evaluation des Wissenschaftsbetriebes in der DDR die Möglichkeit, an einer Neustrukturierung teilzunehmen. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Wurden die Wissenschaftler zum bloßen Rädchen in der Politik, oder konnten Sie wirklich gestalten?
Zunächst einmal: Ich war immer der Meinung, dass zu einem vollen Hochschullehrerleben neben Lehre, Forschung und Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses auch die wissenschaftliche Selbstverwaltung beziehungsweise die Wissenschaftspolitik gehört. Ich habe diese vielleicht in der Vergangenheit etwas zu exzessiv wahrgenommen. Dennoch fühle ich mich durch den schlichten Umstand, dass ich jetzt auch in solchen Bereichen tätig war, nicht von meinem eigentlichen Beruf entfremdet. Das hat auch etwas mit der Autonomie der Institution Universität zu tun, die muss man bauen, nicht beschwören.
Meine Erfahrungen in den genannten Kommissionen sind sehr gemischt. Die gute Nachricht zuerst: Ich fand, es war schon eine erstaunliche Leistung, die unser System, auch das wissenschaftliche System, in wirklich ganz kurzer Zeit vollbracht hat – in nicht mal zwei Jahren, wenn Sie die Arbeit des Wissenschaftsrates betrachten –, nämlich ein System soweit zu evaluieren und soweit zu rekonstruieren, dass dieses System ohne wirklich gravierende Brüche – ich spreche jetzt nicht von Personen – praktisch eine völlige Veränderung erfahren hat. Ob diese Veränderung in allen Teilen vernünftig war, und ob uns da genug eingefallen ist, das ist die andere Frage. Und das ist vielleicht die schlechte Nachricht. Denn im Endeffekt ist diese Veränderung dann doch so erfolgt, dass wir schlicht das uns gewohnte, also im Westen gewohnte, Universitäts- oder Wissenschaftssystem insgesamt mehr oder weniger radikal auch in den Neuen Ländern durchgesetzt haben. Wirklich Neues ist uns dabei nicht eingefallen, und das hatte natürlich auch wieder seine Gründe. Diese lagen weniger darin, dass es zu wenig institutionelle Fantasie gab. Die gab es. Sondern daran, dass das Ganze nicht nur unter einem ungeheuren Zeitdruck erfolgte, sondern auch unter einem ungeheuren finanzpolitischen Druck. Bestimmte Finanzierungsmöglichkeiten bestanden nur, wenn man sehr schnell in einer bestimmten Weise veränderte. Viel Spielraum für Experimente, neue Formen, die in unserem Finanzierungssystem von Wissenschaftlern und Universitäten nicht üblich waren, gab es nicht. Und insofern ist erklärbar – und in diesem Fall auch den Beteiligten nicht vorwerfbar –, dass dabei nicht große Neuerungen herausgekommen sind. Immerhin – ein bisschen mehr, als man tatsächlich zustandegebracht hat, hätte man vielleicht zustandebringen können. Die Kommissionen, die nach dem Wissenschaftsrat tätig waren – das waren die Hochschulstrukturkommissionen der Länder, in denen ich in Sachsen und in Berlin mitgewirkt habe –, hatten noch einmal die Chance, intern auf Länderebene die Dinge etwas anders anzupacken. Sie haben sie auch in der Form genutzt, dass eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht wurde – auch institutionelle Vorschläge –, die es verdient hätten, als wirklich neue und Reformelemente betrachtet zu werden. Dass diese nicht oder jedenfalls zu größeren Teilen nicht realisiert wurden – nun gut, das lag nicht in der Hand dieser Kommissionen. In dem Augenblick, als wir eine Chance gehabt hätten, dass zum Beispiel in Berlin ein paar Dinge anders hätten realisiert werden können, kam der finanzielle Einbruch. Das war kein böser Wille, auch nicht auf Seiten der Politik oder der Verwaltung. Jede Reform kostet Geld, Reformen zum Nulltarif gibt es nicht.
Wie stehen Sie zu dem Vorwurf, dass die Professoren der alten Bundesrepublik lediglich ihre Privatdozenten in den Neuen Ländern entsorgt hätten?
Ha! Also so pauschal gilt das nicht; aber es gibt natürlich Bereiche, in denen das der Fall war.
Welche Rolle spielten bei Personalfragen ideologische Kriterien im Gegensatz zu fachlichen? Es gibt ja durchaus auch marxistische Professoren in Westdeutschland.
Ja ja, das waren auch ein paar Dinge, die mich wahnsinnig geärgert haben. Also, zunächst einmal glaube ich sagen zu können, jedenfalls für den Bereich des Wissenschaftsrats, dass ideologische Dinge keine Rolle gespielt haben. Gleichwohl haben auch Ideologien in diesem ganzen Prozess gegriffen. Etwa die, dass man sich einfach nicht vorstellen konnte, dass es auch Teile der Philosophie der DDR unter Qualitäts- und anderen Gesichtspunkten wohl verdient hätten, in das gemeinsame System aufgenommen zu werden. Der antimarxistische Besen hat da kräftig gekehrt – und das ist schlimm gewesen. Allerdings waren das vor allem die Neuen Länder selbst, die da gekehrt haben, das darf man nicht vergessen. Diese Form der Reinigung setzte überhaupt erst ein, als das Evaluationsgeschäft, sofern es vom Wissenschaftsrat betrieben wurde, beendet war. Und da waren es eben in den Neuen Ländern sehr häufig gerade die Wendehälse, die mit Feuer und Schwert durch die Universitäten gegangen sind, nicht die Westler. Die Westler haben sehr früh bemerkt, dass oft auch sehr gemischte Verhältnisse herrschten. Die Vorstellung, es ist alles im Argen, das Niveau ist im Keller, die Ideologie ist entsetzlich, war häufig unbegründet; wer in dieser Weise, mit dieser Vorstellung rübergegangen ist, wurde schnell eines Besseren belehrt. Nein nein, es waren, wenn man so sagen will, die eigenen Leute, die hier und dort am grässlichsten gewütet haben. Und das ist ein Kapitel der Vereinigung, das erst noch richtig geschrieben werden muss.