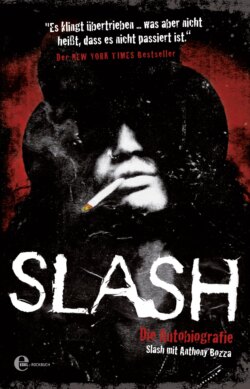Читать книгу Slash - Slash - Страница 6
3 Rock'n'Roll auf einer Saite
ОглавлениеSich anders als in seiner üblichen Selbstwahrnehmung zu erfahren, fernab des gewohnten Standpunkts, relativiert die eigene Perspektive - das ist so, als hörte man die eigene Stimme auf dem Anrufbeantworter. Fast möchte man meinen, einem Fremden zu begegnen - oder auch ein Talent an sich zu entdecken, von dem man bis zu diesem Zeitpunkt gar nichts wusste. Als ich zum ersten Mal auf einer Gitarre eine Melodie so gut hinbekam, dass sie sich wie das Original anhörte, war das so eine Erfahrung. Je länger ich mich mit diesem Instrument beschäftigte, desto öfter kam ich mir vor wie ein Bauchredner. Was ich da durch das Medium dieser sechs Saiten zu hören bekam, war, wie mir bald klar wurde, die Stimme meiner eigenen Kreativität - und gleichzeitig noch etwas völlig anderes. Seither sind mir Noten und Akkorde zur zweiten Sprache geworden, und in der Regel drückt dieses Vokabular aus, was ich fühle, wenn die normale Sprache versagt. Außerdem ist die Gitarre mein Gewissen - wann immer ich vom Weg abgekommen bin, hat sie mich wieder aufs rechte Gleis zurückgeführt; wann immer ich vergesse, warum ich auf der Welt bin, erinnert sie mich daran.
Der Mensch dem ich alles verdanke, heißt Steven Adler. Er brachte mich überhaupt erst dazu, Gitarre zu spielen. Wir lernten uns eines Abends auf dem Spielplatz der Laurel Elemen-tary kennen, als wir beide dreizehn waren. Soweit ich mich erinnere, fuhr er Skateboard, hatte es aber einfach nicht drauf. Als er sich einmal ziemlich übel hinlegte, fuhr ich mit dem Bike zu ihm rüber und half ihm auf die Beine. Von dem Moment an waren wir unzertrennlich.
Steven war mit seinen beiden Brüdern bei seiner Mutter und seinem Stiefvater im Valley aufgewachsen, bis seine Mutter seine Allüren satt hatte und ihn nach Hollywood zu seinen Großeltern abschob. Dort blieb er dann den ganzen Sommer über bis zum Ende der Junior High. Anschließend schickte man ihn wieder zurück zu seinen Eltern, um dort die High School zu besuchen. Steven ist einmalig; er ist so eine Art schwieriger Fall, wie ihn nur eine Großmutter gernhaben kann - ohne dass sie ihn deshalb gleich bei sich wohnen haben wollte.
Steven und ich lernten uns in dem Sommer kennen, bevor wir in die achte Klasse kamen, und wir hingen dann bis zur High School zusammen rum. Ich war gerade in die neue Wohnung zu meiner Großmutter in Hollywood gezogen; meine Mutter wohnte damals am Hancock Park. Steven und ich waren daher sowohl neu an der Bancroft Junior High als auch neu im Viertel. In all der Zeit brachte es Steven, was Schulstunden anbelangte, noch nicht einmal auf eine Woche im Monat. Ich schaffte es immer irgendwie, weil ich in Kunst, Musik und Englisch gut genug war, um auf einen ordentlichen Durchschnitt zu kommen. In diesen Fächern hatte ich Einsen, weil es die einzigen waren, die mich interessierten. Ansonsten hatte ich für die Schule nicht viel übrig, weshalb ich meistens blau machte. Da ich im Schulsekretariat einen Block mit Entschuldigungsformularen gestohlen hatte und die Unterschrift meiner Mutter fälschte, wann immer es nötig war, fehlte ich in den Augen der Schulleitung weit seltener unentschuldigt, als das tatsächlich der Fall war. Der einzige Grund, weshalb ich den Abschluss an der Junior High schaffte, war trotz allem ein Lehrerstreik im letzten Jahr. Unsere regulären Lehrer wurden durch Aushilfslehrer ersetzt, mit denen ich locker fertig wurde, manchmal mit Quatsch, manchmal mit Charme. Ich möchte hier nicht groß darauf eingehen, aber ich erinnere mich daran, mehr als einmal den Lieblingssong eines Lehrers vor der Klasse auf der Gitarre gespielt zu haben. Belassen wir es dabei.
Um ehrlich zu sein, fand ich die Schule an sich gar nicht so übel: Ich hatte Freunde dort, sogar eine Freundin (dazu kommen wir gleich), und ich machte alles mit, was die Schule für einen kleinen Kiffer so verlockend macht. Unsere Clique traf sich jeden Morgen vor der Vollzähligkeitsprüfung, um sich eine Dosis Amylnitrit hochzuziehen, das es damals unter der Bezeichnung »Locker Room« völlig legal im Headshop zu kaufen gab. Die Dämpfe von dem Zeug erweitern die Blutgefäße, und das führt zu einem kurzen euphorischen Rush. Nach ein paar Hits davon rauchten wir einige Zigaretten, und zur Mittagszeit trafen wir uns dann wieder auf dem Schulhof zu einem Joint. Man tat eben, was man konnte, um sich die Schulzeit so angenehm wie möglich zu machen.
Wenn wir nicht zur Schule gingen, verbrachten Steven und ich den Tag in Hollywood und Umgebung. Wir hatten den Kopf voller Träume und unterhielten uns über Musik und wie wir zu Geld kommen könnten.
Hin und wieder schnorrten wir Leute an oder verdienten uns ein paar Dollar, indem wir jemandem beim Umzug halfen. Hollywood ist schon immer ein merkwürdiges Pflaster gewesen, das die seltsamsten Gestalten anzog, aber Ende der 70er-Jahre, nach all den kulturellen Irrungen und Wirrungen - vom Scheitern der Revolution in den Sixties über den Drogenmissbrauch bis hin zur Lockerung der Sexualmoral - hing dort eine Menge abgefahrenes Volk herum.
Ich erinnere mich nicht mehr genau, wie wir ihn kennengelernt haben, aber es gab da einen älteren Typ, der uns öfter Geld gab - einfach so. Wir hingen häufig mit ihm ab und unterhielten uns mit ihm. Ich glaube, er bat uns hin und wieder auch, für ihn einkaufen zu gehen. Ich hielt das zwar für ziemlich komisch, aber irgendwie wirkte der Kerl nicht bedrohlich genug, um zwei Dreizehnjährigen etwas anhaben zu können, womit die nicht fertig würden. Abgesehen davon war die Extraknete, die wir von ihm bekamen, die Mühe wert.
Steven hatte nicht die geringsten Skrupel, und er hatte eine ganze Reihe von Möglichkeiten, regelmäßig an Geld zu kommen. Eine davon war Clarissa, eine Nachbarin von mir. Sie war Mitte zwanzig und wohnte nur ein paar Häuser die Straße hinauf. Eines Tages sahen wir sie auf ihrer Veranda sitzen, als wir gerade vorbeikamen. Steven begrüßte sie ganz spontan. Die beiden kamen ins Gespräch, und sie lud uns ein, zu ihr hineinzukommen. Wir hingen eine Weile bei ihr rum, bevor ich mich zum Gehen entschloss, aber Steven blieb noch ein Weilchen. Wie sich später herausstellte, hatte er noch am selben Abend Sex mit ihr, wofür er auch noch Geld bekommen hatte! Ich habe keine Ahnung, wie er das angestellt hat, weiß aber, dass er noch vier-, fünfmal bei ihr war - und dass sie ihm jedes Mal Geld gegeben hat. Ich fand das unglaublich; ich war richtig neidisch auf ihn.
Andererseits geriet Steven ständig in die merkwürdigsten Situationen, und die gingen nicht immer gut aus. Einmal war er mit Clarissa zugange, als ihr schwuler Mitbewohner nach Hause kam. Erschrocken schubste sie Steven von sich herunter und er landete mit dem Kopf auf dem harten Schlafzimmerboden. Damit hatte sich das dann erledigt.
Wir kamen ganz gut zurecht, Steven und ich: Er sorgte für Bargeld, ich klaute, was wir an Musik und Rockmagazinen brauchten. Viel gab es ohnehin nicht, wofür wir Geld hätten ausgeben wollen, mal abgesehen von Big Gulps und Zigaretten, es ging uns also nicht schlecht. Wir streunten auf dem Hollywood Boulevard herum, stromerten den Sunset Boulevard hinauf bis zum Doheny Drive, checkten die Rockposter in den vielen Headshops oder gingen in einen der Souvenir- oder Musikläden, wenn wir dort etwas Spannendes sahen. Wir liefen einfach so herum und ließen die aufregende Atmosphäre auf uns wirken. Stundenlang hingen wir in einem Laden namens Piece O' Pizza ab und hörten dort Van Halen aus der Jukebox, immer und immer wieder. Das wurde irgendwann zum Ritual. Steven hatte mir einige Monate zuvor Van Halens erste Platte vorgespielt. Es war einer der Augenblicke in meinem Leben, in denen mich die Musik einer mir bis dahin unbekannten Gruppe total fesselte.
»Das musst du dir anhören«, hatte Steven mit großen Augen gesagt. »Die Band heißt Van Halen - der totale Hammer!« Ich hatte meine Zweifel, da Steven und ich musikalisch nicht immer einer Meinung waren. Er legte die Platte auf, und aus den Lautsprechern dröhnte das Solo von Eddie, mit dem »Eruption« beginnt. »Großer Gott«, sagte ich, »was ist das denn?«
In diesem Jahr sah ich auch mein erstes grosses Rockkonzert. Das war das California World Music Festival im Memorial Coliseum von Los Angeles am 8. April 1979. Es kamen hundertzehntausend Leute dorthin, und das Programm war der reine Wahnsinn. Jede Menge Bands traten auf, wobei Ted Nugent, Cheap Trick, Aerosmith und Van Halen die Headliner waren. Und Van Halen spielte alle anderen Bands an die Wand, sogar Aerosmith. Was aber auch nicht sonderlich schwer war, weil Aerosmith damals derart beschissen drauf waren, dass sich in ihrem ganzen Set kein Song vom anderen unterschied. Obwohl ich ihr Fan war, konnte ich lediglich »Seasons of Wither« zweifelsfrei heraushören.
Bald darauf hingen Steven und ich regelmäßig vor dem Rainbow und dem Starwood ab, den Treffpunkten der damals gerade aufkommenden Glam-Metal-Szene. Van Halen haben dort ihre Wurzeln, und Mötley Crüe etablierten sich gerade dort. Neben Bands wie diesen war in L. A. damals der erste Punkrock zu hören. Vor den Clubs war immer irre was los, und da ich wusste, wo Drogen zu kriegen waren, verhökerte ich die nicht nur des Geldes wegen, sondern auch, um in die Szene reinzukommen. Auf der Junior High bastelte ich an einer weiteren Methode, um dieses Ziel zu erreichen: Ich fing an, Ausweise zu fälschen, mit denen ich tatsächlich in die Clubs reinkam.
Nachts ging in West Hollywood und Hollywood mächtig was ab. Die ganze Homosexuellenszene um das noble Schwulenrestaurant French Quarter und Schwulenbars wie das Rusty Nail prallten mit voller Wucht auf die Rockszene, die größtenteils hetero war. Diesen Gegensatz fanden Steven und ich herrlich bizarr: Freaks so weit das Auge reichte. Wir konnten uns daran kaum sattsehen, so fremd und absurd war die Szene größtenteils.
Steven und ich gerieten in allerlei Schwulitäten. Eines Abends nahm mein Dad uns mit auf eine Party seiner Künstlerfreunde, die in ein paar Häusern in einer Sackgasse oben im Laurel Canyon lebten. Alexis, der Gastgeber, hatte einen Bottich mit tödlichem Punsch angesetzt, von dem bald alle britzebreit waren. Steven, der im Valley aufgewachsen war, hatte seinen Lebtag keine derart coole Szene gesehen: ein Haus voll abgefahrener Künstler, Späthippies - Erwachsene! Kurz gesagt, die Szene in Kombination mit dem Punsch haute ihn völlig um. Für Dreizehnjährige waren wir ziemlich trinkfest, aber der Stoff, den es gab, war was für Fortgeschrittene, und ich war so hackedicht, dass ich noch nicht mal mitbekam, wie Steve sich mit einer Frau verdrückte, die in der Gästewohnung unten wohnte. Er ging mit ihr ins Bett, was, wie sich später herausstellte, irgendwie weniger cool war: Sie war über dreißig und verheiratet. Für einen Dreizehnjährigen wie mich war sie eine Seniorin. In meinen Augen hatte Steve es einer alten Frau besorgt - die obendrein auch noch die Alte eines anderen war.
Am Morgen erwachte ich mitten auf dem Boden, Punschgeschmack im Mund, und es kam mir so vor, als hätte mir einer einen Nagel in den Kopf geschlagen. Ich ging nach Hause zu meiner Großmutter, um meinen Rausch auszuschlafen; Steven kam nicht mit, er blieb lieber noch im Bett. Ich war vielleicht zehn Minuten zu Hause, als mein Dad anrief, um mir zu sagen, dass Steven besser sein Testament machen sollte: Die Frau, mit der er im Bett gewesen war, hatte alles ihrem Mann gebeichtet, und der war über die Sache nicht gerade erfreut. Mein Dad meinte, der Kerl hätte vor, Steven zu erdrosseln, und dass er sich sich ernsthaft in Gefahr befände. Als ich ihn seiner Ansicht nach nicht so recht ernst nahm, sagte er mir, der Typ hätte geschworen, Steven zu killen. Letzten Endes passierte allerdings doch nichts, das heißt Steven kam ungeschoren davon, aber die Episode deutete auf das voraus, was uns noch bevorstand. Schon mit dreizehn hatte Steven sein Leben auf exakt zwei Ziele reduziert: Ficken und In-einer-Rockband-spielen. Ich finde dieses Maß an Konzentration absolut beeindruckend.
Mit der musikalischen Klugheit eines Dreizehnjährigen, die ich (womöglich wegen seines Talents als Aufreißer) weit höher einschätzte als meine eigene, war Steven zu dem Schluss gekommen, dass es nur drei Rock'n'Roll-Bands gab, die etwas taugten: Kiss, Boston und Queen. Diesen Bands huldigte er unablässig - Tag für Tag -, während wir eigentlich in der Schule hätten sein sollen. Stevens Großmutter arbeitete in einer Bäckerei und ging jeden Tag um fünf Uhr morgens aus dem Haus; sie hatte keine Ahnung, dass ihr Enkel kaum zur Schule ging. Er hörte den lieben langen Tag Kiss auf voller Lautstärke und spielte dazu auf einer kleinen Kaufhausgitarre und einem Mini-Amp, der ebenfalls voll aufgedreht war. Als ich mal zu ihm kam, um mit ihm abzuhängen, schrie er mich über den Lärm hinweg an: »Hey! Weißt du was? Wir gründen eine Band!«
So aufgeschlossen und sorglos wie er nun mal ist, kann Steven einen unheimlich mitreißen. Ich hegte nicht den geringsten Zweifel, weder an seiner Absicht noch an seinem Ehrgeiz; ich war sogleich völlig überzeugt von der Sache. Da er sich schon mal zum Gitarristen ernannt hatte, waren wir uns sofort einig: Ich spielte Bass. Wenn ich heute Musik höre, nach fünfundzwanzig Jahren als Musiker, höre ich natürlich sofort die einzelnen Instrumente heraus; ich höre die Tonart und habe auf der Stelle mehrere Ideen, wie man den Song angehen könnte. Mit dreizehn hörte ich zwar schon jahrelang Rock'n'Roll, hatte Konzerte gesehen und wusste also durchaus, welche Instrumente eine Rockband so braucht, aber ich hatte keinen blassen Schimmer, wie welches Instrument klingt. Ich wusste, was eine Gitarre ist, aber worin sie sich von einem Bass unterscheidet, wusste ich nicht. Und Stevens Künste machten mir das auch nicht gerade klar.
Wenn wir beide durch die Stadt zogen, kamen wir immer wieder an einer Musikschule an der Kreuzung Fairfax und Santa Monica vorbei. Sie nannte sich Fairfax Music School (heute hat dort ein Chiropraktiker seine Praxis), und ich dachte mir, wenn ich Bass lernen will, warum dann nicht dort? Also ging ich eines Tages einfach mal rein, stellte mich vor eine Art Rezeption und sagte: »Ich möchte Bass spielen.« Die Frau hinter der Theke stellte mich einem der Lehrer vor, einem Typ namens Robert Wolin. Als Robert erschien und auf mich zukam, war er nicht gerade das, was ich erwartet hatte: Er war mittelgroß, weiß, hatte sein kariertes Hemd in die Levi's gesteckt, einen buschigen Schnauzer im Gesicht, einen Stoppelbart und zotteliges braunes Haar, das mal eine Frisur gehabt haben mochte, bevor es außer Kontrolle geraten war. Ich muss wohl nicht eigens betonen, dass er in meinen Augen nicht nach einem Rockstar aussah.
Immerhin erklärte er mir geduldig, ich bräuchte einen eigenen Bass, um Stunden zu nehmen - noch nicht mal daran hatte ich gedacht. Ich bat meine Großmutter um Hilfe, und sie schenkte mir eine alte Flamencogi-tarre mit einer einzigen Nylonsaite, die bei ihr im Schrank stand. Als ich mich dann nach der Schule mit Robert traf, war ihm sofort klar, dass er besser mal ganz von vorne anfing, weil ich keine Ahnung hatte, dass das, was ich da mitgebracht hatte, beileibe nicht Bass genannt werden konnte. Robert legte »Brown Sugar« von den Stones auf, nahm seine Gitarre und spielte erst den Riff mit, dann das Lead. Und da hörte ich es - den Sound. Was immer Robert da machte, das war's! Von Ehrfurcht ergriffen starrte ich seine Gitarre an. Ich wies mit dem Finger darauf.
»Das möchte ich auch können«, sagte ich ihm. »Genau das.«
Robert war wirklich entgegenkommend; er zeichnete mir ein paar Akkorde auf, zeigte mir den entsprechenden Fingersatz auf der Gitarre und stimmte mir die eine Saite, die ich hatte. Außerdem sagte er mir, ich solle mir sobald wie möglich die restlichen fünf besorgen. Und so kam die Gitarre in mein Leben - aus heiterem Himmel. Und sie erwischte mich völlig arglos und naiv. Ich hatte nicht einen Gedanken daran verschwendet, ich hatte nicht darauf spekuliert; abgesehen davon, dass ich in Stevens Fantasieband spielen wollte, hatte ich keinen Plan. Zehn Jahre später sollte ich all das haben, wovon Steven geträumt hatte: Ich bereiste die Welt, ich spielte in ausverkauften Arenen, und wir hatten mehr Mädels, als wir je beglücken konnten. Und das alles dank des ramponierten Stück Holz, das meine Großmutter aus ihrem Schrank hervorgekramt hatte.
Buchstäblich über Nacht ersetzte die Gitarre bei mir das BMX-Rad als Obsession Nummer Eins. Gitarrespielen war so völlig anders als alles, was ich je getan hatte: Es war eine Ausdrucksform für mich, so befriedigend und persönlich wie Malen und Zeichnen, nur dass sie viel tiefer ging. Die Fähigkeit, Klänge hervorbringen zu können, die mir so viel bedeuteten, seit ich zum ersten Mal in meinem Leben Musik gehört hatte, machte mich zu jemandem. Die Veränderung trat augenblicklich ein, fast so, als hätte jemand eine Lampe angeknipst, und sie hatte dieselbe Wirkung: Es wurde Licht. Ich kam von der Musikschule nach Hause und kopierte Roberts Methoden. Ich legte meine Lieblingssongs auf und spielte mit, so gut es ging. Ich machte, was ich mit meiner einen Saite machen konnte. Nach ein paar Stunden war ich in der Lage, den Akkordwechseln zu folgen und sogar die Melodien einiger Songs nachzuspielen, na ja, mehr oder weniger. Songs wie Deep Purples »Smoke On The Water«, Chicagos »25 Or 6 To 4«, Led Zeppelins »Dazed And Confused« und Jimi Hendrix' »Hey Joe« lassen sich alle auf der E-Saite spielen, also beschränkte ich mich erst mal auf die. Ich wiederholte sie, immer und immer wieder. Allein das Wissen, dass ich die Songs, die aus meiner Stereoanlage dröhnten, nachspielen konnte, ließ die Gitarre zu einem unverzichtbaren Teil meines Lebens werden - und das für immer.
Den ganzen Sommer über, bevor ich in die neunte Klasse kam, nahm ich Stunden bei Robert - auf meiner abgegriffenen Flamencogitarre, die irgendwann auch sechs Saiten hatte. Und er zeigte mir natürlich auch, wie man sie stimmte. Ich staunte jedes Mal, wenn er einen Song auflegte, den ich nicht kannte, und es ihm binnen weniger Minuten gelang, ihn nachzuspielen. Ich machte mich daran, ihm nachzueifern und beging den Fehler aller übereifrigen Anfänger. Ich versuchte, sofort auf dasselbe Level zu gelangen. Aber wie jeder gute Lehrer zwang Robert mich dazu, mich erst einmal auf die Grundlagen zu konzentrieren. Er brachte mir die wesentlichen Dur- und Molltonleiter und die Bluesskalen bei, dazu die wichtigsten Akkorde in verschiedenen Lagen. Außerdem zeichnete er mir die Akkorde meiner Lieblingssongs auf, zum Beispiel »Jumpin' Jack Flash« und »Whole Lotta Love«, die ich zur Belohnung spielen durfte, wenn ich die Übungen für die jeweilige Woche erledigt hatte. Für gewöhnlich ging ich gleich zur Belohnung über, und wenn ich am nächsten Tag in der Musikschule aufkreuzte, wusste Robert natürlich sofort, dass ich meine Hausaufgaben nicht mal angerührt hatte. Manchmal spielte ich weiterhin so, als hätte ich immer noch bloß eine Saite. Alle Songs, die ich besonders mochte, hatten einen Riff, und es machte mir einfach mehr Spaß, den auf einer Saite rauf und runterzuspielen, als die Songs richtig zu lernen.
Meine BMX-Ausrüstung verstaubte derweil. Meine Freunde fragten sich, wo ich Abend für Abend war. Eines Tages, als ich mit dem Rad und der Gitarre auf dem Rücken zur Musikschule fuhr, traf ich Danny Mc-Cracken. Er wollte wissen, wo ich abgeblieben wäre und ob ich in letzter Zeit irgendwelche Rennen gewonnen hätte. Ich sagte ihm, ich sei Gitarrist geworden. Er musterte mich skeptisch, beguckte sich die alte Klampfe und blickte mir dann herausfordernd in die Augen: »Ach ja?« Seinem Ausdruck nach zu urteilen, war er ziemlich verwirrt, so als hatte er nicht gewusst, was er mit der Information anfangen solle. Wir saßen einen Augenblick betreten schweigend auf unseren Bikes, dann verabschiedeten wir uns. Es war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe.
Ich respektierte meinen Gitarrenlehrer Robert, aber naiv und ungeduldig wie ich war, sah ich keine Verbindung zwischen den Grundlagen, die er mir beibrachte, und den Stones- oder Led-Zeppelin-Songs, die ich spielen wollte. Und so kam es denn auch bald zur Krise, als ich in der Grabbelkiste eines Gitarrenladens sozusagen mein eigenes Lehrbuch fand: How to Play Rock Guitar. Das Buch enthielt sämtliche Akkordgrafiken, Tabulaturen und Beispielsoli von Größen wie Eric Clapton, Johnny Winter und Jimi Hendrix. Es war sogar eine wabbelige kleine Plastiksingle mit dabei, auf der man sich anhören konnte, wie die Sachen in dem Buch zu spielen waren. Ich nahm das Teil mit nach Hause, wo ich es sofort verschlang, und nachdem ich erst mal die Sachen von der kleinen Platte drauf hatte, improvisierte ich rasch meine eigenen Akkordfolgen, und da war ich dann wirklich außer mir. Als ich erst mal in der Lage war, eigene Kombinationen zu erfinden, die sich nach Rock'n'Roll-Leadgitar-re anhörten, war mir, als hätte ich den heiligen Gral gefunden. Das Buch veränderte mein Leben; ich habe das abgegriffene Ding noch heute in irgendeinem Koffer, weiß der Kuckuck wo, und ich habe weder vorher noch seither je ein anderes gesehen. Ich habe ziemlich oft danach gesucht, es aber nicht mehr gefunden. Ich habe das Gefühl, das letzte Exemplar auf der ganzen Welt ergattert zu haben, und dass es an jenem Tag in diesem Laden genau auf mich gewartet hat. Das Buch vermittelte mir die Fertigkeiten, nach denen ich gesucht hatte, und als ich diese schließlich beherrschte, war die Musikschule für mich gegessen.
Ich war jetzt ein »Rockgitarrist«, jedenfalls für meine Begriffe, und ich musste meinen Weg gehen: Ich borgte mir einen Hunderter von meiner Großmutter und kaufte mir eine E-Gitarre. Es war eine billige LesPaul-Kopie von einer Firma namens Memphis Guitars. Was mich daran ansprach, war die Form, da die meisten meiner Lieblingsgitarristen eine Les Paul spielten. Sie war für mich die Rockgitarre schlechthin. Wenngleich ich damals noch nicht mal wusste, wer Les Paul überhaupt war. Ich hatte keine Ahnung von seinem erhabenen Jazzgitarrenspiel und wusste auch nicht, dass er ein Pionier in der Entwicklung von E-Gitarre, Soundeffekten und Aufnahmetechnik gewesen war. Ich wusste nicht, dass die Les Paul mit ihrem Solid Body bald zu meinem bevorzugten Instrument werden sollte. Und ich hatte schon gar keine Ahnung davon, dass ich viele Jahre später so einige Male die Ehre haben sollte, mit ihr auf der Bühne zu stehen. Nichts von alledem wusste ich an jenem Tag, es ging um viel Elementareres: Für mich stand die Form der Gitarre für den Sound, der mir vorschwebte.
Zur Gitarre zu finden war, als hätte ich mich selbst gefunden. Sie definierte mich, sie gab meinem Leben einen Sinn. Sie war ein kreatives Ventil, das es mir erlaubte, mich selbst zu verstehen. Die Wirren meiner Pubertät waren plötzlich zweitrangig. Die Gitarre half mir, mich zu orientieren. Ich führte kein Tagebuch; ich hatte scheinbar kein Talent, meine Gefühle auf konstruktive Weise auszudrücken, erst die Gitarre half mir, mir über sie klar zu werden. Ich zeichnete für mein Leben gern; es war eine Tätigkeit, die mich ablenkte, aber es reichte mir als Ausdrucksmöglichkeit nicht. Ich habe schon immer Künstler beneidet, die sich durch ihre Kunst ausdrücken können, und durch die Gitarre habe ich selbst erfahren, wie herrlich befreiend das ist.
Stundenlang zu üben, egal wo, wirkte befreiend. Gitarrespielen versetzte mich von nun an in einen Trancezustand, der die wie Balsam für meine Seele war: Die Hände beschäftigt, die Gedanken konzentriert, fand ich meinen Frieden. Als ich erst einmal in einer Band spielte, wurde allein die körperliche Anstrengung, die es kostet, ein Konzert durchzustehen, zum perfekten Ventil für mich: Wenn ich auf der Bühne stehe, fühle ich mich wohler in meiner Haut als irgendwann sonst. Musik ist eng verbunden mit unseren Emotionen, sie kommt aus dem Unterbewusstsein, und da ich nun mal der Typ bin, der seinen emotionalen Ballast gern in sich einschließt, hat mir nichts je besseren Zugang zu meinen Gefühlen verschafft als die Musik.
Meine innere Stimme mit Hilfe der Gitarre zu finden, und das im Alter von fünfzehn Jahren, war für mich wie eine Revolution. Es war ein Riesensprung in meiner Entwicklung; ich wüsste nichts, was mein Leben stärker beeinflusst hätte. Das Einzige, das auch nur annähernd daran heranreicht, hatte sich zwei Jahre zuvor ereignet: meine erste Erfahrung mit dem Geheimnis des anderen Geschlechts. Nachdem ich es das erste Mal gemacht hatte, konnte ich mir nicht vorstellen, dass es etwas Besseres geben könnte als Sex - bis ich eine Gitarre in der Hand hielt. Und wie ich kurz darauf feststellen musste, konnten diese beiden Hobbys in meiner Teenagerwelt unmöglich friedlich koexistieren.
Meine erste Freundin hieß Melissa. Sie war ein süßes Ding; zwar ein bisschen pummelig, aber sie hatte tolle Titten und war ein Jahr jünger als ich. Sie war zwölf und ich dreizehn, als wir beide unsere Unschuld verloren. Heute, wo Teenager ihre Sexualität viel früher ausleben als damals, mag das vielleicht niemanden sonderlich schockieren, aber 1978, als die meisten unserer Altersgenossen lediglich Zungenküsse austauschten, waren wir dem Rest der Welt um Längen voraus. Zu ersten Fummeleien kam es in der Waschküche des Mietshauses, in dem Melissa wohnte. Dieser Raum lag im Erdgeschoss und führte nach hinten raus. Melissa holte mir einen runter, was für uns beide eine Premiere war. Schließlich machten wir in der Zweizimmerwohnung weiter, in der Melissa mit ihrer Mutter Carolyn wohnte. Dummerweise kam Carolyn gleich beim ersten Mal unvermutet nach Hause, sodass ich - die Hose um die Knöchel -durch Melissas Zimmerfenster verschwinden musste. Glücklicherweise meinten es die Sträucher unten gut mit mir.
Wir waren ziemlich scharf aufeinander. Wann immer ihre Mutter nicht zu Hause war, trieben wir es in Melissas Bett, und wenn sie zu Hause war, trieben wir es auf der Couch, nachdem Carolyn Valium eingeschmissen hatte, immer in der Hoffnung, dass sie nicht aufwachte und uns erwischte. Natürlich fiel es uns nicht immer leicht, darauf zu warten, bis Carolyns Valium wirkte. Es dauerte aber nicht lange, und Melissa und Carolyn zogen um in eine Dreizimmerwohnung. Carolyn fand sich schließlich mit unserem Gepoppe ab. Sie fand, wir trieben es besser bei ihr zu Hause als weiß Gott wo, und das sagte sie uns auch. Für Melissa und mich, zwei Kinder, die vor Geilheit gar nicht genug voneinander kriegen konnten, war sie die coolste Mutter der Welt.
Carolyn qualmte einen Joint nach dem anderen, entsprechend locker sah sie das Ganze - sie drehte uns die perfekten Tüten. Außerdem erlaubte sie mir, über Nacht zu bleiben, sodass ich oft wochenlang bei Melissa schlief. Da Sommerferien waren, hatte meine Mutter nichts dagegen. Melissas Mom arbeitete nicht; sie hatte einen furchtbar netten, erheblich älteren Freund, der mit Koks, Pot und Acid dealte und uns großzügig von allem abgab, solange wir damit in der Wohnung blieben.
Das Haus, in dem Carolyn und Melissa wohnten, stand an der Kreuzung Edinburgh und Willoughby, etwa zwei Blocks westlich der North Fairfax Avenue und einen halben Block vom Santa Monica Boulevard entfernt. Die Lage war perfekt, weil die Laurel Elementary School, die meine Freunde und ich besuchten, gleich die Straße runter lag. Genau genommen haben wir uns dort sogar kennengelernt. Der dortige Spielplatz war praktisch eine genauso isolierte Kommune wie Melissas Block. Überhaupt bot das Viertel eine interessante kulturelle Mischung: junge Schwule und alte jüdische Familien, Russen, Armenier und Zuwanderer aus dem Nahen Osten, die alle irgendwie miteinander auskamen. Die Atmosphäre hatte etwas Idyllisches, einen Touch von Erwachsen müsste man sein, man lächelte, man grüßte einander, man winkte dem anderen zu, aber unter diesen oberflächlichen Gesten herrschte dennoch eine spürbare Spannung.
Ein Abend sah bei uns normalerweise so aus, dass Melissa und ich uns zusammen mit ihrer Mutter zunächst was knallten, bevor wir beide dann über die Straße zu Wes und Nate gingen. Die zwei waren schwul und wohnten in dem einzigen frei stehenden Haus zwischen all den Mietskasernen im Umkreis von sechs Blocks. Sie hatten einen großen Garten - gut viertausend Quadratmeter schätze ich -, in dem eine riesige Eiche mit einer Schaukel dran stand. Wir rauchten einen Joint mit ihnen und gingen dann hinters Haus, wo wir uns unter die Eiche legten und in die Sterne schauten.
Ich entdeckte während der Zeit auch jede Menge zeitgenössischer Musik. Wie schon gesagt lief bei meinen Eltern ständig Musik; sie gehört zu meinen liebsten Kindheitserinnerungen. Ich höre all diese Dinge heute noch, von den klassischen Komponisten, die mein Dad liebte, bis hin zu den Legenden der 60er und frühen 70er, die sie beide gern mochten. Es war die kreativste Zeit der Rockmusik. Ich bin ständig auf der Suche, finde aber selten Musik, die besser ist als die von damals. Immer wenn ich meine, ich hätte was gefunden, entpuppt es sich bei näherem Hinsehen als ein weiterer Aufguss irgendeines uralten Originals. Und dann stelle ich fest, dass ich doch lieber wieder die Stones oder Aerosmith höre oder irgendein anderes Original, auf dem der Sound basiert.
Dennoch: Mit dreizehn genügte mir die Plattensammlung meiner Eltern einfach nicht mehr. Ich machte mich auf die Suche nach neuen Sounds, und die fand ich in Hülle und Fülle bei Melissa. Dort hörte ich zum ersten Mal Supertramp, Journey, Styx, April Wine, Foghat und Genesis - nicht dass auch nur eine dieser Gruppen wirklich nach meinem Geschmack gewesen wäre. Aber Melissas Mom hörte auch Pink Floyd, die ich bereits von meiner Mutter kannte, und bei all dem Pot, das wir bei Carolyn qualmten, gewann die Musik eine ganz neue Bedeutung. Die Wohnung war ein Paradies für einen aufstrebenden Gitarristen: Ich konnte mich für lau zuknallen, neue Musik entdecken und hatte die ganze Nacht Sex mit meiner Freundin. Und das alles noch bevor ich auf die High School kam.
Ich verbrachte den Rest der achten Klasse und die ganze neunte tagsüber mit Gitarrespielen auf meinem Zimmer und Streifzügen mit Steven durch Hollywood - wenn ich nicht gerade mit Melissa im Bett lag. Ich stahl einen klobigen Kassettenrekorder von Panasonic und schleppte ihn überall mit hin. Ich hörte darauf Ted Nugent, Cheap Trick, Queen, Cream und Edgar und Johnny Winter. Ich klaute jeden Tag neue Kassetten und machte eine Band nach der anderen durch. Ich begann immer mit dem Live-Album einer Band; ich finde, das ist die einzige Möglichkeit, um festzustellen, ob eine Band wirklich was drauf hat oder nicht. Wenn sie sich live nach was anhörte, klaute ich gleich all ihre Studioalben. Außerdem nutzte ich Live-Alben, um schon mal die größten Hits einer Band zu hören, bevor ich mich daranmachte, alles von ihnen zu klauen - ich war mit anderen Worten genügsam. Ich stehe heute noch auf Live-Alben; ich finde, für einen Rockfan - und das bin ich bis heute in erster Linie geblieben - gibt es nichts Besseres, als seine Lieblingsband live zu hören. Ich bin noch immer der Ansicht, dass die besten Aufnahmen meiner Lieblingsbands auf ihren Live-Alben zu finden sind, ob das nun Ae-rosmiths Live Bootleg ist, Live At Leeds von The Who, Get Your Ya Ya's Out von den Rolling Stones oder Give The People What They Want von den Kinks. Als Guns N' Roses Jahre später Live Era herausbrachten, war ich unheimlich stolz; ich finde, da sind einige ganz große Momente drauf.
Von Melissa und Steven abgesehen waren alle meine Freunde viel älter als ich. Ich hatte viele von ihnen während meiner Zeit bei der BMX-Gang kennengelernt und auch danach immer wieder neue gefunden, weil ich ständig Pot hatte, das ich irgendwo geschenkt bekam. Mom rauchte Pot und zierte sich, es mir auch zu erlauben. Es war ihr einfach lieber, wenn ich unter ihrer Aufsicht kiffte, anstatt draußen in der Welt herumzuexperimentieren. Bei allem Respekt ihr gegenüber muss ich sagen, sie hatte zwar die besten Absichten, aber ihr war nicht klar, dass ich eben nicht nur zu Hause unter ihrem wachsamen Auge kiffte, sondern immer auch ein bisschen was von ihrem Gras abstaubte (manchmal nur die Samen), um woanders zu rauchen oder was davon zu verhökern. Es war unfehlbar die beste Methode, irgendwo gut anzukommen, und ich bin ihr dankbar dafür.
Die älteren Kids, mit denen ich so verkehrte, hatten ihre eigenen Wohnungen, dealten, schmissen Partys und hatten offensichtlich nicht die geringsten Probleme damit, mit Minderjährigen rumzuhängen. Von den offensichtlichen Vorteilen einmal abgesehen, bot mir ein solches Umfeld natürlich auch die Möglichkeit, die jeweils angesagten Bands zu entdecken, die ich sonst vielleicht gar nicht kennengelernt hätte. Es gab da zum Beispiel eine Gruppe von Surfern und Skatern, mit denen ich abhing, die mich auf Devo, Police, 999 und einige der radiokompatiblen New-Wave-Bands aufmerksam machten. In einer anderen Clique, in der ich verkehrte, gab es einen Kerl namens Kevin, ein schlaksiger Schwarzer Mitte zwanzig, und auf einer seiner Partys hörte ich zum ersten Mal das erste Album der Cars.
Kevin war der große Bruder von Keith, einem meiner BMX-Kumpel, der mir den Spitznamen Solomon Grundy verpasst hatte. Ich sah zu Keith auf, weil immer die heißesten Mädchen von der Fairfax High School hinter ihm her waren. Als ich etwa dreizehn, vierzehn war und total auf BMX stand, gehörte Kevin bereits zur Szene, aber er war immer so cool, dass man stets vermutete, er würde alles hinschmeißen, um etwas mit mehr Anspruch auf die Beine zu stellen, eben was für Erwachsene. Warum Keith mich Solomon Grundy getauft hat, weiß ich bis heute nicht.
Kevins Musikgeschmack war jedenfalls ziemlich fragwürdig. Er stand auf Disco, womit wir überhaupt nichts anfangen konnten. Heute ist mir allerdings klar, dass ihm dieses Disco-Ding auch erlaubte, sich richtig rauszuputzen - und dafür verdient er dann doch meinen Respekt. Er war damit durchaus erfolgreich, denn die Mädchen in seiner Clique und auf seinen Partys waren heiß und willig, was ich besonders interessant fand. Allerdings erwartete ich nicht, dass mir »die coole neue Band«, von der Kevin sprach, während wir auf einer seiner Partys einen Joint durchzogen, gefallen würde. Aber schon während ich den ersten Song hörte, änderte ich meine Meinung, und gleich der zweite Song machte mich zu einem lebenslangen Fan von Elliot Easton. Elliot war die Seele der Cars, und die haben mich mit ihrer ersten Platte bekehrt. Meiner Ansicht nach waren die Cars eine der wenigen wirklich einflussreichen Bands zu der Zeit, als New Wave den Äther eroberte.
Kurz bevor ich nach Hause ging, hörte ich auf der Party noch ein paar Takte, die mich nicht mehr losließen. Jemand hatte Aerosmiths Rocks aufgelegt, und ich hörte nur zwei Songs, aber das genügte vollauf. Die Musik hatte einen derart geilen Vibe, wie ich ihn noch nie gehört hatte. Falls die Leadgitarre tatsächlich die unentdeckte Stimme war, die in mir schlummerte, dann war das die Platte, auf die ich mein ganzes Leben lang gewartet hatte. Ich sah mir extra noch das Albumcover an, bevor ich abzog, um herauszufinden, was ich da gerade gehört hatte. Der Name Aero-smith sagte mir was. Vier Jahre zuvor, 1975 also, hatten sie mit »Walk This Way« ihren einzigen Radiohit gehabt. Ein, zwei Wochen später kam mir Rocks gleich noch mal unter - leider in einem denkbar ungünstigen Augenblick.
Ich muss der nächsten Episode aus meinem Leben die Erklärung vorausschicken, dass Beziehungen grundsätzlich nicht einfach sind, erst recht nicht, wenn die Beteiligten noch jung und unerfahren sind und die Hormone verrücktspielen. Melissa und ich mochten einander wirklich sehr, aber wir machten immer wieder mal Schluss, um uns dann doch irgendwann wieder zu vertragen, was meist daran lag, dass meine Begeisterung für sie nicht ganz so groß war wie die fürs Gitarrespielen. Zu der Zeit, um die es jetzt geht, waren wir gerade mal wieder getrennt, und ich hatte ein Auge auf ein anderes Mädchen geworfen, das wir hier mal Laurie nennen wollen. Sie verkehrte in meinem Freundeskreis, war aber deutlich älter und spielte ganz offensichtlich in einer anderen Liga als ich. Laurie hatte lange blond-braune Haare, sagenhafte Titten und lief immer in dünnen - hauchdünnen - tief ausgeschnittenen Trägerhemdchen herum. Die Dinger waren so durchsichtig und so weit geschnitten, dass praktisch ständig ihr Busen zu sehen war. Wie ich war Laurie gerade Single, nachdem sie mit ihrem Freund Ricky, dem Prototyp eines Surfers, Schluss gemacht hatte. Ich war wild entschlossen, was mit ihr anzufangen. Es war mir gleich, dass sie vier Jahre älter war als ich und sie noch nicht mal wusste, dass es mich gab. Ich war mir sicher, ich würde das bringen. Ich sprach sie immer wieder an, schenkte ihr Aufmerksamkeit und schließlich kam ein Gespräch zustande. Laurie kam aus ihrer Deckung hervor und lernte mich kennen. Und nachdem ich sie erst mal so weit hatte, schien sie zu vergessen, dass ich einige Wochen zuvor nichts weiter gewesen war als ein kleiner Strolch, der sie nicht im Geringsten interessierte. Schließlich lud sie mich eines Abends zu sich nach Hause ein, als ihre Mutter gerade nicht in der Stadt war.
Ich stellte mein Rad auf dem Rasen vor ihrem Haus ab und folgte Laurie nach oben in ihr Zimmer. Meiner Vorstellung von cool oder groovy war sie um Jahre voraus: Bei ihr hingen Seidentücher über den Lampen, Rockposter an den Wänden, sie besaß eine eigene Stereoanlage und jede Menge Platten. Wir rauchten was, und ich war fest entschlossen, den Coolen zu mimen, also ging ich ihre Alben durch, um etwas zu finden, womit ich sie beeindrucken konnte. Dabei entdeckte ich Rocks, das Album, das ich ein paar Wochen zuvor auf Kevins Party zum ersten Mal gehört hatte, und legte die Platte auf. Im Unterbewusstsein hatte ich die beiden Songs seit der Party gespeichert. Daher war ich völlig weg, kaum dass ich das Kreischen am Anfang von »Back In The Saddle« gehört hatte. Vor den Lautsprechern hockend hörte ich mir die Platte an, immer und immer wieder. Laurie existierte nicht mehr. Ich hatte sie völlig vergessen, sie und die Pläne, die ich für den Abend gehabt haben mag. Nach einigen Stunden tippte sie mir auf die Schulter.
»Hey«, sagte sie.
»Hey«, sagte ich. »Was gibt's?«
»Ich meine, du solltest besser mal nach Hause gehen.«
»Ach so, ja. Okay.«
Rocks hat noch heute dieselbe Wirkung auf mich wie damals: Die gekreischten Vocals, die rotzigen Gitarren, der gnadenlose Groove - genauso muss meiner Meinung nach Bluesrock gespielt werden. Irgendwas an Aerosmiths ungeniert zur Schau gestellter Halbwüchsigkeit traf zur damaligen Zeit haargenau meinen Nerv. Die Platte brachte zum Ausdruck, was ich fühlte. Nach meiner verpatzten Chance bei Laurie widmete ich mich voll und ganz »Back In The Saddle«. Ich klaute die Kassette und ein Aerosmith-Songbook gleich dazu, und dann hörte ich den Song, bis ich die Riffs draufhatte. Ich habe dabei auch gleich eine wertvolle Lektion gelernt: Musikbücher können einem nicht beibringen, etwas richtig zu spielen. Ich hatte ein bisschen Notenlesen gelernt, ich sah also, dass die Noten im Songbook nicht zu dem passten, was auf der Platte gespielt wurde. Es konnte gar nicht anders sein: Ich mühte mich stundenlang ab und konnte trotzdem nicht richtig mitspielen. Von da an verzichtete ich auf jegliche Notenbücher und hörte mir einen Song einfach so lange an, bis ich wusste, wie er gespielt wird.
Als ich mir die Licks von »Back In The Saddle« erarbeitete, bekam ich auch gleich mit, wie eigen Joes und Brads Spielweise ist, und dass niemand sonst je etwas so spielt, wie man selbst. Das Nachspielen sollte stets ein Ausgangspunkt dafür sein, seine eigene Stimme zu finden, auf keinen Fall sollte die Imitation zur eigenen Stimme werden. Man sollte seinen Helden nicht in dem Maß nacheifern, dass man sie Note für Note kopiert. Die Gitarre ist dafür ein viel zu persönliches Ausdrucksmittel. Sie sollte das bleiben, was sie ist: eine ganz persönliche und einzigartige Erweiterung der Person, die sie spielt.
Bis zum Ende des letzten Sommers an der Junior High hatte ich mir eine ganz und gar eigene Welt geschaffen, die mir die Beständigkeit gab, die ich zu Hause nicht fand - gerade weil Mom und Dad nach ihrer Trennung eine Beziehung nach der anderen eingingen, von denen keine von Dauer war. Ich lebte mal bei Mom, mal bei Dad, immer nur für kurze Zeit, aber emotional fühlte ich mich dort nicht mehr zu Hause. Letztendlich lebte ich größtenteils bei meiner Großmutter in Hollywood, mein kleiner Bruder blieb dagegen bei Mom. Und natürlich schlief ich die meiste Zeit ohnehin bei Melissa.
Nach ihrer Beziehung mit David Bowie kam meine Mutter mit einem talentierten Fotografen zusammen, den wir hier einfach mal ihren »Freund« nennen wollen. Die beiden waren drei Jahre zusammen und zogen schließlich auch in eine gemeinsame Wohnung an der Cochran Avenue, gleich um die Ecke von der West Third, gar nicht so weit von der La Brea Avenue entfernt; auch ich wohnte eine Weile bei ihnen. Dieser Freund war etwa zehn Jahre älter als Ola. Als sie sich kennenlernten, ging sein Stern gerade auf: Ich erinnere mich noch daran, bei ihnen Herb Ritts getroffen zu haben, Moshe Brakha und eine Handvoll anderer berühmter Fotografen und Models. Mom und ihr Freund hatten eine ziemlich turbulente Beziehung, in deren Verlauf Ola allmählich zu seiner Assistentin degradiert wurde; ihre eigene Karriere stellte sie derweil nämlich hintan.
Olas Freund hatte immer eine Dunkelkammer in seinem Bad, und gegen Ende ihrer Beziehung entdeckte ich, dass er dort, wenn er angeblich »arbeitete«, in Wahrheit die ganze Nacht freebaste. Nicht dass die Beziehung der beiden grundsätzlich schlecht gewesen wäre, aber Koks beendete die Karriere von Olas Freund erst einmal - und die Beziehung mit Mom ging bei diesem Sturzflug gleich mit den Bach runter. Der Freund hatte eine Menge Probleme. Er war unglücklich, und Unglück hat gern Gesellschaft, daher war er irgendwann fest entschlossen, mich mit reinzuziehen, obwohl ich ihn nicht sonderlich mochte (was er wusste). Also freebasten wir gemeinsam und zogen dann los, um uns die Garagen in der Nachbarschaft näher anzusehen. Normalerweise klauten wir gebrauchte Möbel, alte Spielsachen und was immer so aussah, als hätte man sich davon getrennt. Wir fanden zum Beispiel ein rotes Sofa, das wir dann den ganzen Weg nach Hause schleppten, wo wir es schwarz anmalten und es dann in sein Büro stellten. Keine Ahnung, was Ola gedacht hat, als sie am nächsten Morgen aufwachte. Ich habe wirklich keinen Schimmer, weil sie nie über das Sofa gesprochen hat. Wie auch immer, nach unseren Abenteuern kokste der Freund weiter, den ganzen Vormittag und, wie ich annehme, auch den Rest des Tages. Ich verdrückte mich um halb acht in mein Zimmer, tat eine Stunde so, als würde ich schlafen, stand dann auf, sagte meiner Mutter guten Morgen und ging zur Schule, als hätte ich die ganze Nacht geschlafen.
Mom hatte darauf bestanden, dass ich bei ihr und ihrem Freund wohne, weil sie nicht in Ordnung fand, was ihrer Ansicht nach drüben bei meinem Dad so lief. Nachdem der sich erst mal mit der Trennung abgefunden hatte, hatte er eine Wohnung im selben Haus gemietet, in dem auch sein Freund Miles und eine Reihe gemeinsamer Bekannter meiner Eltern wohnten. Für Außenstehende sah es so aus, als würden in diesem Kreis alle saufen und als hätte Dad damals mit einer Reihe von Frauen was gehabt, was Mom alles andere als ideal für mich fand. Dad war damals jedoch fest mit Sonny zusammen, einer Frau, der das Leben übel mitgespielt hatte. Sie hatte ihren Sohn bei einem schrecklichen Unfall verloren, und so lieb sie auch war, sie hatte einen totalen Hau. Wenn sie nicht gerade soffen, verbrachten Dad und sie ihre Zeit im Bett. Jedenfalls sah ich Dad während meiner Zeit bei Mom nur am Wochenende, aber wenn ich ihn sah, dann hatte er immer was Interessantes für mich: eine seltene Dinosaurier-Figur oder irgendwas Technisches wie den Bausatz für ein ferngesteuertes Flugzeug.
Später, als er in eine Wohnung an der Ecke Sunset und Gardner zog, ein Haus mit mehreren Einzimmerappartments, deren Mieter sich etagenweise Bad und Klo teilten, sah ich ihn wieder öfter. Sein Freund Steve Douglas wohnte auf demselben Flur. Im Erdgeschoss war ein Gitarrenladen, aber damals interessierte mich das noch nicht. In seiner Wohnung, die gleichzeitig sein Atelier war, hatte Dad sich an der hinteren Wand ein Hochbett gebaut, und dort hauste ich eine Weile, während ich in die siebte Klasse ging. Das war das Jahr, in dem ich von der John Burroughs Junior High geflogen war, weil ich eine Ladung BMX-Räder gestohlen hatte, aber die Geschichte ist nicht der Mühe wert, erzählt zu werden. Wie auch immer, während dieser kurzen Zeit besuchte ich die Le Conte Junior High, und da mein Dad kein Auto fuhr, ging ich die fünf Meilen zur Schule zu Fuß.
Ich weiß nicht genau, womit Dad und Steve ihre Brötchen verdienten. Jedenfalls war Steve auch Künstler, und soweit ich das beurteilen konnte, verbrachten sie ihre Tage mit Saufen, und nachts malten sie jeder für sich oder unterhielten sich über Kunst. Eine meiner unterhaltsameren Erinnerungen aus dieser Zeit kreist um eine altmodische Arzttasche, in der Steve eine Sammlung Uraltpornos aufbewahrte. Er erwischte mich eines Tages dabei, als ich sie mir ansah.
Im Prinzip teilten wir drei uns die beiden Wohnungen von Steve und meinem Dad, sodass es völlig normal für mich war, in Steves Atelier zu spazieren, wann immer mir danach war. Eines Tages kam er herein und ertappte mich dabei, dass ich in seinem alten Pornoschatz stöberte. »Ich mach dir 'n Vorschlag, Saul«, sagte er. »Wenn du's schaffst, mir die Tasche unter der Nase wegzuklauen, kannst du sie haben. Meinst du, du kriegst das hin? Aber ich bin ziemlich flink, also streng dich an.« Ich lächelte ihn nur an. Ich hatte mir schon vor seinem Angebot einen Plan zurechtgelegt, wie ich die Tasche klauen könnte. Ich wohnte auf demselben Flur - verglichen mit dem, was ich als Dieb draußen auf der Straße so leistete, war das nun wirklich kein großer Coup.
Einige Tage später ging ich auf der Suche nach Dad rüber zu Steve, und diesmal waren die beiden derart in eine Unterhaltung vertieft, dass sie noch nicht einmal mitbekommen hatten, dass ich reingekommen war. Es war die perfekte Gelegenheit: Ich griff mir die Tasche und versteckte sie auf dem Dach. Dummerweise war mein Triumph nur von kurzer Dauer: Dad befahl mir, die Tasche zurückzugeben, nachdem Steve bemerkt hatte, dass sie verschwunden war. Jammerschade, die Hefte waren echte Klassiker.
Es gab Zeiten in meiner Kindheit, da warf ich Mom und Dad allen Ernstes vor, mich gekidnappt zu haben und gar nicht meine richtigen Eltern zu sein. Entsprechend oft lief ich von zu Hause weg. Als ich wieder mal Vorbereitungen dazu traf, half Dad mir sogar dabei, meinen »Koffer« zu packen, eine kleine karierte Tasche, die er mir in England gekauft hatte. Er war so verständnisvoll und hilfsbereit, dass ich mich doch noch zum Bleiben entschloss. Diese Art subtile Psychologie ist typisch für meinen Dad. Etwas, das ich hoffentlich geerbt habe, weil ich es selbst gern bei meinen eigenen Kindern einsetzen möchte.
Ich würde sagen, mein grösstes Abenteuer erlebte ich mit sechs, als ich mit meinem Roller abhauen wollte. Damals wohnten wir noch an der Lookout Mountain Road, und ich fuhr mit dem Roller den ganzen Laurel Canyon hinunter bis zum Sunset Boulevard, also alles in allem gerade mal zwei Meilen. Ich wusste sogar genau, wo ich hinwollte: Ich plante, für den Rest meines Lebens in ein Spielzeuggeschäft zu ziehen. Ich bin wohl schon immer einer von der entschlossenen Sorte gewesen. Aber so oft ich auch als Kind von zu Hause weglaufen wollte, über meine Erziehung kann ich mich nicht beklagen. Wäre sie auch nur ein bisschen anders gewesen, wäre ich nur eine Minute später geboren worden oder zur richtigen Zeit am falschen Ort gewesen oder umgekehrt, dann gäbe es das Leben, das ich gelebt und lieben gelernt habe, womöglich nicht. Und das ist etwas, worüber ich gar nicht nachdenken will.