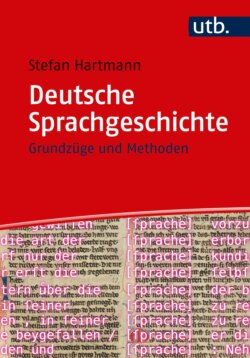Читать книгу Deutsche Sprachgeschichte - Stefan Hartmann - Страница 10
2.2.1 Sprachvergleich und Rekonstruktion: Die komparative Methode
ОглавлениеAls 2015 in Südafrika die Überreste einer zuvor unbekannten Menschenart, des Homo naledi, entdeckt wurden (vgl. Berger et al. 2015), war dies eine kleine wissenschaftliche Sensation, die auch auf ein breites Presseecho stieß. Für die Paläoanthropologie, die sich mit der Entwicklungsgeschichte des Menschen befasst, sind solche Funde von zentraler Bedeutung, denn um zu verstehen, wie sich unsere Spezies evolutionär entwickelt hat, ist es wichtig, möglichst viele verwandte Spezies miteinander zu vergleichen. Dies nennt man die komparative MethodeKomparative Methode (vgl. Fitch 2010: 44–46). Derlei Vergleiche können unter anderem dazu beitragen, Rückschlüsse auf den hypothetischen letzten gemeinsamen Vorfahren, den last common ancestor, von Menschen und Schimpansen zu ziehen.
Die komparative MethodeKomparative Methode in der Sprachwissenschaft verfolgt ähnliche Ziele mit ähnlichen Mitteln. Sie ermöglicht es, Sprachstufen zu rekonstruieren, aus denen uns keinerlei Zeugnisse überliefert sind. Die komparative Methode baut auf der Grundannahme auf, dass zwischen den Sprachen der Welt Verwandtschaftsverhältnisse bestehen: Sprachen, die zur gleichen SprachfamilieSprachfamilie gehören, lassen sich demnach auf eine gemeinsame ProtospracheProtosprache zurückführen. So gehören etwa das Deutsche, Englische und Niederländische zur westgermanischen Sprachfamilie, während etwa Isländisch, Norwegisch, Dänisch und Schwedisch zur nordgermanischen zählen. Aus den Gemeinsamkeiten der jeweiligen Einzelsprachen lassen sich Eigenschaften der Protosprache, also des West- bzw. Nordgermanischen, rekonstruieren. Damit ist gemeint, dass wir eine wissenschaftlich fundierte Annahme darüber treffen, wie die jeweilige Protosprache ausgesehen haben könnte (vgl. Crowley & Bowern 2010: 79).
Natürlich sind die Verwandtschaftsverhältnisse zwischen Sprachen weitaus komplexer, als dass man einfach nur für jede Sprachfamilie eine gemeinsame „Ursprache“ annehmen müsste. So gehören das West- und Nordgermanische ihrerseits zur germanischen Sprachfamilie, zusammen mit den ausgestorbenen ostgermanischen Sprachen, zu denen das Gotische gehört, das für die Rekonstruktion des Proto-Germanischen eine zentrale Rolle spielt (vgl. Lehmann 1994: 19). Die germanischen Sprachen indes gehören ebenso wie beispielsweise die romanischen und die slawischen Sprachen zur indoeuropäischen Sprachfamilie, die in der deutschsprachigen Literatur oft auch als „indogermanische“ Sprachfamilie bezeichnet wird.
Um diese Verwandtschaftsverhältnisse zu entschlüsseln, bedarf es des Sprachvergleichs. Tab. 1 stellt die Kardinalzahlen von 1 bis 10 in sieben verschiedenen Sprachen gegenüber: drei westgermanischen, drei romanischen und einer sog. isolierten Sprache, d.h. einer Sprache, die mit keiner anderen bekannten Sprache verwandt ist. Schon ein oberflächlicher Vergleich zeigt deutliche Gemeinsamkeiten zwischen den Zahlwörtern in den eng miteinander verwandten Sprachen. Ebenso fällt auf den ersten Blick ins Auge, dass das Baskische sich ganz deutlich von den anderen Sprachen unterscheidet (außer im Falle von sei ‚sechs‘).
| germanisch | romanisch | isoliert | ||||
| Dt. | Engl. | Nl. | Franz. | Ital. | Span. | Bask. |
| eins | one | één | un | uno | uno | bat |
| zwei | two | twee | deux | due | dos | bi |
| drei | three | drie | trois | tre | tres | hiru |
| vier | four | vier | quatre | quattro | cuatro | lau |
| fünf | five | vijf | cinq | cinque | cinco | bost |
| sechs | six | zes | six | sei | seis | sei |
| sieben | seven | zeven | sept | sette | siete | zazpi |
| acht | eight | acht | huit | otto | ocho | zortzi |
| neun | nine | negen | neuf | nove | nueve | bederatzi |
| zehn | ten | tien | dix | dieci | diez | hamar |
Tab. 1: Die Zahlen von 1 bis 10 in drei westgermanischen und drei romanischen Sprachen sowie einer sog. isolierten Sprache, dem Baskischen, das mit keiner anderen bekannten Sprache verwandt ist.
Für die Ähnlichkeiten gibt es eine einfache und plausible Erklärung: Die einander ähnlichen, aber doch deutliche Unterschiede aufweisenden Sprachen haben sich aus einer gemeinsamen Vorstufe (Protosprache) entwickelt und sind im Laufe der Zeit gleichsam auseinandergedriftet. Die Frage, welche der (heutigen) Sprachen „älter“ oder „jünger“ ist, stellt sich daher zunächst nicht. Die komparative Methode geht von der – natürlich stark idealisierenden – Annahme aus, dass Aufspaltungen zwischen Sprachen plötzlich stattfinden und dass nach der Aufspaltung der Protosprache kein Kontakt mehr zwischen den daraus resultierenden Tochtersprachen besteht (vgl. Campbell 2013: 143).
Zur Anwendung der komparativen Methode
Campbell (2013: 111–134) schlägt folgende Schritte für die Durchführung einer Rekonstruktion mit Hilfe der komparativen Methode vor (ähnlich auch Crowley & Bowern 2010: 78–94; Trask 2015: 196):
Schritt 1: Kognaten finden
Unter KognatenKognat (von lat. cognatus ‚verwandt; ähnlich/übereinstimmend‘) versteht man Formen, die auf einen gemeinsamen Ursprung zurückgehen. Am Anfang der komparativen Methode steht folgerichtig die Aufgabe, potentielle Kognaten in verwandten Sprachen ausfindig zu machen, bzw. in Sprachen, bei denen man gute Gründe hat, von einer Verwandtschaft auszugehen.
Nicht alle potentiellen Kognaten müssen automatisch auch Kognaten sein. So haben wir bereits gesehen, dass Baskisch sei ‚sechs‘ zwar formal ein hohes Maß an Ähnlichkeit zu seinen Pendants in den romanischen Sprachen aufweist. Aber weil das Baskische nicht mit den romanischen Sprachen verwandt ist, kann es nicht mit Ital. sei oder Span. seis kognat sein. Allenfalls könnte es sich um ein Lehnwort handeln – eine These, die durchaus in Erwägung gezogen wurde (vgl. Uhlenbek 1940–41). LehnwörterLehnwort gelten jedoch nicht als Kognaten (vgl. Campbell 2013: 352), da EntlehnungEntlehnung zunächst ein rein „horizontaler“ Prozess ist, wie Fig. 3 zeigt: Ein Wort wie Restaurant beispielsweise wird zu einem bestimmten Zeitpunkt t aus einer Sprache (S1) in eine andere (S2) entlehnt – hier: aus dem Französischen ins Deutsche. Daher existiert es heute in beiden Sprachen, doch es lässt sich nicht auf eine gemeinsame Proto-Sprache zurückführen. Hingegen lässt sich für dt. Gast und engl. guest, zusammen mit weiteren Kognaten wie nl. gast, norw. gjest, isl. gestur oder dän. gæst eine gemeinsame Ursprungsform annehmen, nämlich germanisch *gasti-. Der Asterisk (*) zeigt hier an, dass es sich um eine rekonstruierte Form handelt, die selbst nicht belegt ist: Es ist vielmehr jene Vorform, die angesichts der überlieferten Formen als die wahrscheinlichste angesehen wird.
Fig. 3: Kognat vs. Lehnwort.
Schritt 2: Lautliche Entsprechungen aufzeigen
Mit Hilfe der (potentiellen) Kognaten werden anschließend systematische Lautentsprechungen herausgearbeitet. Diese müssen von solchen Entsprechungen unterschieden werden, die höchstwahrscheinlich dem Zufall geschuldet sind. So enden in Tab. 1 span. uno und cinco auf -o, die baskischen Pendants bat und bost auf -t. Hier ein Muster erkennen zu wollen, wäre indes übereilt, wie auch der Blick auf die anderen auf -o endenden spanischen Zahlwörter in der Tabelle zeigt, die keine baskische Entsprechung auf -t haben. Auch wäre eine Stichprobe von nur zwei Wörtern natürlich viel zu klein, um überzeugend eine Lautkorrespondenz aufzuzeigen.
Vergleichen wir hingegen zwei und zehn mit den Kognaten im Englischen und Niederländischen, so zeigt sich ein Muster, das wir auch in vielen anderen Wörtern wiederfinden, wie Tab. 2 verdeutlicht.
| Deutsch | Englisch | Niederländisch |
| Zahn | tooth | tand |
| zahm | tame | tam |
| (er)zählen | tell | (ver)tellen |
| zehren (früher auch: ‚reißen‘, vgl. mhd. zerzern ‚zerreißen‘) | tear ‚(zer)reißen‘ | teren ‚zehren‘ |
| Zinn | tin | tin |
| Zuber | tub | tobbe |
| Zwirn | twine | twijn |
Tab. 2: Beispiele für Kognaten mit /ts/ im Deutschen und /t/ in anderen westgermanischen Sprachen.
Anhand dieser und weiterer Wörter lässt sich eine relativ klare Lautentsprechung nachweisen: Dem /ts/ im Deutschen entspricht im Englischen und Niederländischen – und auch in anderen westgermanischen Sprachen – der stimmlose Plosiv /t/. Historisch ist dies, wie wir in Kap. 4.1.1 sehen werden, auf die 2. Lautverschiebung zurückzuführen, die das Deutsche von allen anderen germanischen Sprachen trennt. Um Wandelphänomene wie die 2. Lautverschiebung entdecken zu können, bedarf es jedoch zunächst des Sprachvergleichs – genauer: der komparativen Methode.
Schritt 3: Den Proto-Laut rekonstruieren
Woher weiß man jedoch, dass bei den in Tab. 2 genannten Beispielen /ts/ der jüngere Laut ist und /t/ der ältere? Hierfür gibt es verschiedene Indizien. Erstens finden zahlreiche Lautwandelprozesse sprachübergreifend in eine bestimmte Richtung statt (Direktionalitätsprinzip): So gibt es viele Sprachen, in denen ein Wandel von /k/ zu /f/ belegt ist, während dieser Wandel in der umgekehrten Richtung praktisch nicht vorkommt (vgl. Campbell 2013: 113).
Zweitens gilt das Mehrheitsprinzip: Wenn keine anderen Indizien dagegen sprechen, wird jener Laut als Proto-Laut angenommen, der in meisten Tochtersprachen der zu rekonstruierenden Proto-Sprache auftritt (vgl. Campbell 2013: 114). So werden wir in Kap. 4.1.1 sehen, dass sich das Deutsche durch die sog. 2. Lautverschiebung von allen anderen germanischen Sprachen unterscheidet. Das zeigt sich auch in Tab. 2, denn das Englische und Niederländische haben hier wie die überwältigende Mehrheit der westgermanischen Sprachen /t/, wo das Deutsche /ts/ hat: isländisch tíu, Afrikaans tien, norwegisch und dänisch ti, schwedisch tio, färöisch tíggju – deutsch zehn. Das lässt darauf schließen, dass /t/ der ältere Laut ist.
Drittens gilt es, die gemeinsamen phonologischen Eigenschaften der unterschiedlichen Laute in den Tochtersprachen einzubeziehen. So diskutiert Campbell (2013: 116) ein Beispiel aus den romanischen Sprachen. Hier entspricht spanisch und portugiesisch /b/ im Französischen /v/ und im Italienischen /p/. Alle drei Laute teilen das Merkmal [+labial]. /b/ und /p/ teilen darüber hinaus das Merkmal [+plosiv], während /b/ und /v/ das Merkmal [+stimmhaft] gemeinsam haben. Nach dem Mehrheitsprinzip könnte man nun annehmen, dass */b/ als Proto-Laut zu rekonstruieren sei, doch spricht das Direktionalitätsprinzip dagegen, da sich stimmlose Plosive häufig zu stimmhaften Plosiven wandeln und Plosive zwischen Vokalen häufig zu Frikativen werden. Daher ist es plausibel anzunehmen, dass */p/ der gesuchte Proto-Laut ist, der in einigen der Tochtersprachen den häufig beschrittenen Wandelpfad p > b > v gegangen ist. Im Zweifelsfall kann es mithin sinnvoll sein, dem Direktionalitätsprinzip – unter Einbezug der geteilten phonologischen Merkmale der jeweiligen Laute – den Vorzug vor dem Mehrheitsprinzip zu geben.
Schritt 4: Status der Lautentsprechungen bestimmen
Bislang mag der Eindruck entstanden sein, dass einem Laut in der Protosprache immer genau ein Set an Korrespondenzen entspreche, etwa dem Proto-Laut */p/ die Korrespondenz /b/ – /p/ – /v/ im Spanischen, Portugiesischen, Französischen und Italienischen. Das ist aber keineswegs immer der Fall, wie folgendes Beispiel aus den germ. Sprachen zeigt: Das stimmhafte /d/ in Bruder und das stimmlose /t/ in Vater gehen auf den gleichen Proto-Laut zurück; die rekonstruierten ie. Formen lauten *bhrāter- bzw. *pətḗr (vgl. Pfeifer 1993). Die Formen haben sich im Deutschen durch Lautwandel auseinanderentwickelt. Synchron haben wir es daher mit zwei verschiedenen, sich jedoch teilweise überlappenden Korrespondenzenbündeln zu tun:
| dt. /t/ | nl. /d/ | engl. /ð/ |
| Vater | vader | father |
| dt. /d/ | nl. /d/ | engl. /ð/ |
| Bruder | broeder | brother |
Tab. 3: Beispiel für zwei verschiedene, einander überlappende Sets an Lautkorrespondenzen.
Die Lautkorrespondenzen in Tab. 3 ließen sich natürlich noch um weitere Sprachen ergänzen. Doch schon in dieser kleinen Auswahl an Sprachen wird deutlich, dass die Faustregel „ein Laut in Sprache A entspricht einem Laut in Sprache B“ keineswegs immer aufgeht. Bei solchen einander überlappenden Korrespondenzenbündeln muss daher in jedem Einzelfall entschieden werden, ob es sich um zwei verschiedene Korrespondenzmuster handelt oder ob sich die beiden Korrespondenzmuster auf einen Proto-Laut zurückführen lassen – was im Falle der Vater/Bruder-Kognaten sehr wahrscheinlich ist.
Schritt 5: Plausibilität des rekonstruierten Lauts überprüfen
Abschließend gilt es, die Plausibilität des rekonstruierten Lauts im Kontext des gesamten bisher rekonstruierten Phoneminventars vor dem Hintergrund typologischer Erwartungen zu überprüfen (vgl. Campbell 2013: 124–128) – in anderen Worten: zu überprüfen, wie plausibel die Annahme ist, dass a) eine Sprache das rekonstruierte Phoneminventar aufweist und dass b) in einer Sprache, die dieses Phoneminventar hat, genau dieser Laut auftaucht.
Gehen wir zunächst auf a) näher ein. In den Sprachen der Welt sind bestimmte Phoneminventare deutlich verbreiteter als andere, während einige hypothetisch denkbare Konfigurationen gar nicht auftreten. Zum Beispiel ist keine Sprache bekannt, in der es gar keine Vokale gibt. Ein rekonstruiertes Phoneminventar ganz ohne Vokale wäre folgerichtig eher unplausibel.
Weiterhin gibt es eine Reihe sprachlicher Universalien. Unter Sprachuniversalien versteht man Aussagen, die für alle (oder zumindest tendenziell für alle) Sprachen gelten. Wie „universal“ die in der Forschung angenommenen Universalien sind, ist hochumstritten, zumal nur ein Teil der auf der Welt gesprochenen Sprachen dokumentiert ist, von den bereits ausgestorbenen Sprachen ganz zu schweigen. Evans & Levinson (2009) sehen die Existenz von Sprachuniversalien daher als „Mythos“, wobei sie sich jedoch nur auf Aussagen beziehen, die ausnahmslos für alle Sprachen gelten sollen. Dass es statistische Tendenzen gibt, erkennen sie jedoch ausdrücklich an. Auf genau solche Tendenzen bezieht sich Kriterium b).
Über die komparative Methode hinaus: Weitere Möglichkeiten der Rekonstruktion
Die komparative Methode hat sich als wichtigstes Instrument der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft erwiesen, doch hat sie auch ihre Grenzen. So kann sie beispielsweise in isolierten Sprachen wie dem Baskischen, also solchen Sprachen, für die bisher keine Verwandten gefunden wurden, nicht angewandt werden. Hier muss man auf eine andere Methode zurückgreifen, um mögliche Vorstufen der Sprache zu rekonstruieren, nämlich die interne Rekonstruktion, die sich in manchen Fällen auch in nicht-isolierten Sprachen als Ergänzung zur komparativen Methode eignet. Ausgangspunkt der internen Rekonstruktion sind Allomorphe, also Formen, die im jeweiligen Flexionsparadigma oder auch in über Wortbildung abgeleiteten Wörtern unterschiedliche phonologische Formen haben. Im Deutschen finden wir Allomorphie z.B. in umgelauteten Formen, vgl. Maus – Mäus-e, Bub – Büb-lein. In solchen Fällen kann davon ausgegangen werden, dass die beiden Formen auf eine einzige Form zurückgehen und sich durch Lautwandel auseinanderentwickelt haben (vgl. Trask 2015: 238). Auf Grundlage dessen, was man über sprachübergreifende Lautwandeltendenzen weiß, kann man dann Lautwandelprozesse postulieren, die zur gegenwärtigen Situation geführt haben. Auch hier gilt es dann, die postulierten Prozesse im Kontext des rekonstruierten Gesamtsystems zu überprüfen (vgl. Campbell 2013: 199).
In den vergangenen Jahren haben sich zudem immer stärker computationale Methoden der Lexikostatistik und Glottochronologie etabliert. Bei diesen quantitativen Ansätzen, die allerdings in der historischen Linguistik teilweise noch mit Skepsis betrachtet werden (vgl. z.B. Campbell 2013), handelt es sich um sog. phylogenetische MethodenBayessche phylogenetische Methoden, die sich an der Evolutionsbiologie orientieren. Dass der Begriff „phylogenetische Methoden“ häufig ausschließlich mit diesen modernen Ansätzen in Verbindung gebracht wird, ist freilich etwas irreführend, denn letztlich sind auch die „klassischen“ Methoden, die zur Rekonstruktion von Sprachfamilienstammbäumen verwendet werden, phylogenetisch (von gr. φῦλον ‚Stamm‘ und γενετικός ‚Ursprung, Quelle‘). Auch die Verknüpfung zwischen Sprachwissenschaft und Evolutionsbiologie ist nicht neu: So wurde Darwin bei der Entwicklung der Evolutionsbiologie unter anderem von den Schriften August Schleichers inspiriert, der sich als einer der ersten an der Rekonstruktion der ie. Ursprache versuchte. Umgekehrt lehnen sich viele theoretische Ansätze jüngeren Datums an die Evolutionsbiologie an (z.B. Haspelmath 1999, Croft 2000).
Die Glottochronologie geht davon aus, dass es so etwas wie ein Basisvokabular gibt, also ein Inventar an Konzepten, für das es in allen Sprachen und Kulturen Wörter gibt. Das können z.B. Verwandtschaftsbezeichnungen, Farbwörter, Naturphänomene wie Sonne und Mond oder grundlegende Erfahrungen wie leben und sterben sein (vgl. z.B. Trask 2015: 350f.). Zwei häufig verwendete Listen, die sog. Swadesh-ListenSwadesh-Listen, hat Morris Swadesh zusammengestellt, eine mit 100, eine mit 200 Wörtern. Diese Listen haben z.B. Gray & Atkinson (2003) und Bouckaert et al. (2012) verwendet, um die einzelnen Aufspaltungen des Ie. möglichst genau zu datieren und damit auch Hypothesen zum Ie. zu überprüfen. Dafür nutzten sie 2.449 Kognaten (allesamt aus der 200-Wörter-Swadesh-Liste) aus 87 Sprachen und kodierten jedes der Kognaten-Sets daraufhin, ob es in der jeweiligen Sprache vorhanden ist oder nicht (0 vs. 1). Wie das aussehen kann, zeigen beispielhaft Tab. 4 und Tab. 5 (aus Atkinson & Gray 2006: 94).
In Tab. 4 sind vier Konzepte aus den Swadesh-Listen aufgeführt, zusammen mit den entsprechenden Wörtern aus sechs ie. Sprachen (darunter aus dem ausgestorbenen Hethitischen, die als älteste belegte ie. Sprache gilt). Das Wort für ‚hier‘ z.B. ist im Englischen und Deutschen kognat: here und hier. Das frz. Wort geht hingegen nicht auf die gleiche Wurzel zurück wie das engl. und dt., aber es teilt sich eine Wurzel mit dem italienischen Wort, auch wenn diese etymologische Verwandtschaft durch Lautwandel opak (undurchsichtig) geworden ist: ici und qui/qua. Mit dem Neugriechischen und Hethitischen kommen zwei weitere Wurzeln hinzu, denn die Wörter in diesen Sprachen gehören weder zum Kognatenset 1 (hier/here) noch zum Kognatenset 2 (ici/qui/qua).
In Tab. 5 ist für jedes Swadesh-Konzept in jeder der in der Stichprobe in Tab. 4 vorhandenen Sprachen angegeben, ob das jeweilige Kognaten-Set in der Sprache vorhanden ist oder nicht. Im Falle von hier findet sich in jeder der sechs Sprachen genau eine der vier Varianten: Im Englischen und Deutschen das Kognatenset 1 (hier/here), im Frz. und Italienischen das Kognatenset 2 (ici/qui/qua), im Neugriechischen das Kognatenset 3 (edo), im Hethitischen das Kognatenset 4 (ka). So entsteht eine Matrix aus binären Werten, also aus Ja/Nein-Werten bzw. Einsen und Nullen.
| Englisch | here 1 | sea 5 | water 9 | when 12 |
| Deutsch | hier 1 | See 5, Meer 6 | Wasser 9 | wann 12 |
| Französisch | ici 2 | mer 6 | eau 10 | quand 12 |
| Italienisch | qui 2, qua 2 | mare 6 | acqua 10 | quando 12 |
| Neugriechisch | edo 3 | thalassa 7 | nero 11 | pote 12 |
| Hethitisch | ka 4 | aruna- 8 | watar 9 | kuwapi 12 |
Tab. 4: Einige Sprachen und Swadesh-Wörter, die in den Daten von Gray & Atkinson (2003, 2005) verwendet wurden. Wörter mit der gleichen Zahl sind Kognaten.
| Bedeutung (Swadesh-Konzept) | hier | See | Wasser | wenn | ||||||||
| Kognatenset | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Englisch | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Deutsch | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Französisch | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Italienisch | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Neugriechisch | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hethithisch | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tab. 5: Kognaten-Matrix für die vier Wörter in Tab. 4. Die Ziffern in der Zeile „Kognatenset“ geben die Zahlen wieder, mit denen in Tab. 4 die einzelnen Kognaten markiert sind.
Das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein der jeweiligen Kognatensets wird als Grundlage für Modelle der diachronen Sprachentwicklung verwendet. Genauer gesagt, wird die lexikalische Ersetzung modelliert: Angenommen z.B., die in unserer Stichprobe häufigeren Kognatensets 1 und 2 sind älter als die selteneren Kognatensets 3 und 4, dann muss ja zu einem bestimmten Zeitpunkt das alte Wort aus Kognatenset 1 oder 2 durch ein neues Wort ersetzt worden sein. In unterschiedlichen Sprachen hat diese Ersetzung für unterschiedliche Kognatensets und für unterschiedlich viele Kognatensets stattgefunden. Mit Hilfe der binären Kodierung in 1 und 0 ist also der entscheidende Prozess für die Modellierung der Zustandswechsel: von 0 zu 1 (Hinzukommen eines Kognatensets) oder von 1 zu 0 (Verlust eines Kognatensets).
Für diese Modellierung nutzen Atkinson & Gray (2003, 2006) komplexe statistische Methoden, die hier nicht ausführlich diskutiert werden können.1 Grob gesagt modelliert der Ansatz von Atkinson und Gray auf Grundlage einer Fülle von Daten unterschiedliche Sprachenstammbäume und vergleicht die so entstandenen Modelle hinsichtlich ihrer Plausibilität. Die Ergebnisse, zu denen sie auf diese Weise gelangen, interpretieren Gray & Atkinson (2003) als Evidenz für die Hypothese, dass sich das Ie. vor etwa 10.000 Jahren im anatolischen Raum auszubreiten begann.
Diese Hypothese und auch die verwendeten Methoden wurden jedoch heftig kritisiert. So kommen Pereltsvaig & Lewis (2015: 53) zu dem Schluss:
Wherever we look, we find that the model produces multiple chains of errors, consistently failing to accord with known facts about the diversification and spread of the Indo-European languages.
Einige der gegen solche phylogenetische Methoden vorgebrachten Einwände laufen darauf hinaus, dass man auf eine Vielzahl an Daten setzt und darüber die Korrektheit der Analysen im Einzelfall vernachlässigt. So lautet eine zentrale Kritik, dass sich trotz aller Bemühungen, LehnwörterLehnwort aus den Daten auszuschließen, letztlich doch relativ viele LehnwörterLehnwort eingeschlichen haben, die somit eigentlich nicht als Kognaten gelten dürften (vgl. Pereltsvaig & Lewis 2015: 81). Einen solchen Balanceakt zwischen großen Datenmengen einerseits und sorgfältiger qualitativer Analyse der einzelnen Datenpunkte andererseits bringt freilich jede empirische Arbeit mit sich. Ein weiterer, möglicherweise schwerwiegenderer Kritikpunkt betrifft die Frage, wie repräsentativ die Swadesh-Listen tatsächlich sind, zumal Swadesh keine klaren Kriterien für die Auswahl genau dieser Wörter bzw. Konzepte formuliert hat (vgl. Pereltsvaig & Lewis 2015: 72).
Aus wissenschaftstheoretischer und wissenschaftssoziologischer Perspektive ist die neu entfachte Debatte um den Ursprung des Ie. hochspannend, da hier in methodischen Fragen Welten aufeinanderprallen, die unterschiedlicher kaum sein könnten: auf der einen Seite die Vertreter der klassischen komparativen Methode, die auf genauer, händischer Analyse durch Experten beruht; auf der anderen Seite die Vertreter quantitativer Methoden, die zwar größere Datenmengen einbeziehen können, dabei aber z.T. auch fehleranfälliger sind. Inwieweit Ungenauigkeiten auf Ebene der einzelnen Datenpunkte durch eine Vielzahl an Daten „aufgefangen“ werden können, ist eine Frage, die sich bei jeder quantitativen Studie stellt und immer wieder neu erörtert werden muss. Was die hier dargestellten phylogenetischen Methoden angeht, so bleibt abzuwarten, ob sie sich eines Tages als Teil des anerkannten Methodenrepertoires der historischen Linguistik werden durchsetzen können.
Infobox 2: Die germanischen Sprachen
Das Deutsche gehört zu den germanischen Sprachen, die sich in nord- und westgermanische Sprachen untergliedern lassen (die ostgermanischen Sprachen, zu denen das Gotische gehörte, sind ausgestorben). Die nordgermanische Sprachfamilie bilden Isländisch, Färöisch, Norwegisch, Schwedisch und Dänisch. Das Deutsche ist eine westgermanische Sprache. Weitere westgermanische Sprachen sind Englisch, Friesisch, Niederländisch, Afrikaans, Luxemburgisch und Jiddisch. Fig. 4 gibt einen Überblick über die germanischen Sprachen und die Regionen, in denen sie gesprochen werden. Auf der Karte ist jede Sprache einer bestimmten Koordinate zugewiesen. Diese Koordinaten wurden aus dem World Atlas of Language Structures (WALS) übernommen und stehen quasi stellvertretend für das Verbreitungsgebiet der jeweiligen Sprache. Das kann relativ groß sein – Deutsch zum Beispiel wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz gesprochen, und es gibt Sprachinseln etwa in den USA und Südamerika (vgl. z.B. Glottolog, Hammarström et al. 2017).
Fig. 4: Überblick über die germanischen Sprachen nach dem World Atlas of Language Structures (WALS, Dryer & Haspelmath 2013). Erstellt mit ggmap (Kahle & Wickham 2013).
Zum Weiterlesen
Eine praxisorientierte Hinführung zur Anwendung der komparativen Methode bietet Kapitel 5 von Campbell (2013). Crowley & Bowern (2010) bieten neben einem praxisorientierten Kapitel auch einen Abschnitt zur Geschichte der komparativen Methode und zu ihren Herausforderungen. Zum Einstieg eignen sich auch Kapitel 10 von Bybee (2015) sowie die Handbuchartikel von Rankin (2003) und Weiss (2015).