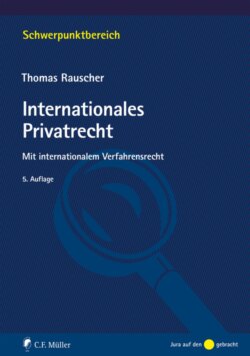Читать книгу Internationales Privatrecht - Thomas Rauscher - Страница 94
2. Annahme der Verweisung und Renvoi
Оглавление347
a) Die Anwendung ausländischen Kollisionsrechts im Rahmen einer Gesamtverweisung kann zu drei unterschiedlichen Ergebnissen führen:
Entweder entscheidet das fremde Kollisionsrecht ebenso wie das deutsche IPR, erklärt also die eigene Rechtsordnung für anwendbar, es nimmt die Verweisung an. Damit ist auch aus deutscher Sicht die kollisionsrechtliche Prüfung beendet; es kommen die Sachvorschriften des fremden Staates zur Anwendung. Dabei sind die fremden Kollisionsnormen so anzuwenden, wie sie in der Rechtspraxis des fremden Staates Anwendung finden. Auch Tatbestandsmerkmale und Anknüpfungskriterien sind im Sinn des verwiesenen IPR zu verstehen. Es ist jedoch auch das fremde IPR am deutschen ordre public zu messen und kann wegen Verstoß gegen diesen unanwendbar sein (im Einzelnen Rn 581 ff).
348
b) Erklärt das fremde IPR das deutsche Recht für anwendbar, so spricht man von Rückverweisung.
349
aa) Art. 4 Abs. 1 S. 2 beendet in diesem Fall die Verweisungskette; es kommt zur Anwendung der deutschen Sachvorschriften. Das deutsche IPR nimmt eine Rückverweisung immer an. Dabei ist es unerheblich, ob die vom fremden IPR ausgesprochene Verweisung selbst eine Gesamtverweisung oder eine Sachnormverweisung ist. Wir verfahren also anders als das fremde Gericht mit der Verweisung des fremden Rechts auf deutsches Recht: Es würde eine Sachnormverweisung auf deutsches Recht im materiellen deutschen Recht enden lassen, eine Gesamtverweisung jedoch auf die deutsche Kollisionsnorm richten und dadurch zurückverwiesen werden.
350
bb) In diesem Fall wird also der internationale Entscheidungseinklang nicht erreicht, sofern auch das fremde Recht der Theorie des renvoi folgt und ebenfalls die Rückverweisung annimmt. Verweist A auf B und B auf A, so wenden schließlich beide Staaten ihr eigenes Recht an. Dieser Folge des renvoi lassen sich jedoch andere Vorteile abgewinnen: Die Anwendung des eigenen Rechts ist praktikabel; das Gericht ist mit dem eigenen Recht vertraut, es muss nicht mit Mühe und Kosten den Inhalt des fremden Rechts ermitteln, die Rechtssache wird zügig entschieden. Historisch wurde dieses „Heimwärtsstreben“ sogar dem renvoi als Zweck unterstellt: Dem eigenen Recht – und damit den eigenen Gerechtigkeitswertungen – werde zur Durchsetzung verholfen. Dieses Argument ist vom Standpunkt des IPR abzulehnen: Sucht man mit der Kollisionsnorm den Sitz des Rechtsverhältnisses, so kann man nicht andererseits das eigene Recht für jedenfalls gerechter halten; dann wäre immer die lex fori anzuwenden.
351
cc) Ursache der Rückverweisung ist immer eine abweichende Anknüpfung im IPR des verwiesenen Staates. Diese kann auf einem anderen Anknüpfungskriterium beruhen oder auf einem anderen Anknüpfungssubjekt.
Ein Däne und eine Deutsche, die in Deutschland leben, heiraten vor einem deutschen Standesamt. Die materiellen Voraussetzungen der Eheschließung beurteilen sich für die Deutsche nach ihrem deutschen Heimatrecht (Art. 13 Abs. 1, keine Verweisung), für den Dänen nach seinem dänischen Heimatrecht (Art. 13 Abs. 1, Gesamtverweisung nach Art. 4 Abs. 1). Nach dänischem IPR bestimmen sich die Voraussetzungen der Eheschließung nach dem Recht des Domizils; es kommt also wegen eines abweichenden Anknüpfungskriteriums zur Rückverweisung auf deutsches Recht.
352
Ursache der abweichenden Anknüpfung kann auch eine abweichende kollisionsrechtliche Einordnung des Sachverhalts (Qualifikation) sein.
Hat ein 2014 verstorbener österreichischer Erblasser ein in Deutschland belegenes Grundstück hinterlassen, so bestimmt sich (aus deutscher Sicht) das Erbstatut nach Art. 25 Abs. 1 aF im Wege der Gesamtverweisung in das österreichische letzte Heimatrecht des Erblassers. Die dortige Kollisionsnorm, § 28 Abs. 1 aF östIPRG[61], nimmt zwar die Verweisung für das Erbstatut an. Fragen, die den sachenrechtlichen Erwerb des Grundstücks betreffen (Universalsukzession, Anfall, Annahme, Ausschlagung, Nachlassverwaltung), werden jedoch auch dann der lex rei sitae als Sachenrechtsstatut unterstellt, wenn der Erwerb von Todes wegen eintritt (§§ 32, 31 Abs. 1 östIPRG). Das österreichische Erbstatut qualifiziert also den „Erbserwerb“ nicht erbrechtlich. Ist dagegen der Erbfall seit dem 17.8.2015 eingetreten und österreichisches Recht nach der EU-ErbVO anwendbar (zB bei Rechtswahl des Heimatrechts, Art. 22 Abs. 1 EU-ErbVO), so handelt es sich nicht um eine Gesamtverweisung, da Verweisungen in das Recht eines Mitgliedstaats im Umkehrschluss aus Art. 34 EU-ErbVO Sachnormverweisungen sind.
353
c) Erklärt das fremde IPR eine weitere Rechtsordnung für anwendbar, so spricht man von Weiterverweisung.[62] Nicht alle Rechtsordnungen, die bereit sind, eine Rückverweisung ersten Grades anzunehmen, folgen auch einer Weiterverweisung (zB Art. 13 Abs. 1 italienisches IPRG).
354
aa) Ausgehend vom deutschen IPR ist jedoch auch der Weiterverweisung zu folgen. Da eine Art. 4 Abs. 1 S. 2 entsprechende Regel (Annahme der Rückverweisung) nicht existiert und für das Abbrechen der Verweisung bei dem zweiten ausländischen Staat auch keine dem Heimwärtsstreben vergleichbaren Interessen feststellbar sind, führt die Weiterverweisung nicht ohne weiteres in das materielle Recht. In welcher Weise der Weiterverweisung gefolgt wird, hängt von dem weiterverweisenden Recht – nicht vom deutschen Gesamtverweisungsprinzip – ab.
355
bb) Versteht das erstverwiesene IPR seine eigene Verweisung auf das Recht eines dritten Staates als Sachnormverweisung, so bleibt es bei der Anwendung der Sachnormen dieses dritten Staates. In diesem Fall wird der internationale Entscheidungseinklang erreicht und ein sinnvolles Ende der Verweisungskette gefunden.
Der brasilianische Staatsangehörige E verstirbt 2014 mit letztem Wohnsitz in Italien. Es wird ein gegenständlich beschränkter Erbschein in Deutschland beantragt, weil E ein Grundstück in Frankfurt hinterlassen hat. Deutsches IPR (Art. 25 Abs. 1 aF) verweist als Gesamtverweisung in brasilianisches IPR. Das IPR von Brasilien (Art. 10 Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro – LIDB[63]) verweist auf das Recht des letzten Wohnsitzes des Erblassers. Die Verweisung ist Sachnormverweisung (Art. 16 LIDB); es ist italienisches materielles Erbrecht anzuwenden.
356
cc) Behandelt dagegen das erstverwiesene IPR seine Verweisung als Gesamtverweisung, so ist die Weiterverweisung aus deutscher Sicht ebenfalls auf das IPR des dritten Staates gerichtet. Das entspricht dem Prinzip, dem verwiesenen IPR in seiner Behandlung des Falles zu folgen. Nimmt an irgendeiner Stelle der dadurch ausgelösten Verweisungskette eine Rechtsordnung die Verweisung an, so kommen die Sachnormen dieses Rechts zur Anwendung. Führt die Verweisungskette zurück in deutsches Recht, so ist Art. 4 Abs. 1 S. 2 anzuwenden: Die Verweisung wird im deutschen Recht abgebrochen.
Der Erblasser (im Beispiel Rn 355) ist Schweizer mit letztem Wohnsitz in London. Das zunächst verwiesene schweizerische IPR verweist im Wege der Gesamtverweisung weiter auf das letzte Wohnsitzrecht des Erblassers (Art. 91 Abs. 1 schweizIPRG). Das englische IPR knüpft die Beerbung in Immobilien an die lex rei sitae, verweist also auf deutsches Recht.
357
dd) In seltenen, nicht mit zwingender kollisionsrechtlicher Logik lösbaren Fällen bleibt die Verweisungskette zwischen dem zweiten und dritten Staat oder auf einer späteren Stufe hängen; es kommt zu einer Rückverweisung auf eine in der Kette vorangehende (nicht die deutsche) Rechtsordnung. Unstreitig kann auch in diesem Fall das damit programmierte Hin- und Her-Verweisen oder der Verweisungszirkel nicht endlos weiterlaufen; strittig ist die Frage, wo abzubrechen ist. Die hM bricht zutreffend eine solche Kette von Gesamtverweisungen dort ab, wo eine Rechtsordnung erstmals erneut in der Verweisungskette erscheint (ausdrücklich bestimmt § 5 Abs. 2 Hs. 2 östIPRG diese Technik). Hierfür spricht eine gewisse Ähnlichkeit der Situation zum Fall der Rückverweisung auf deutsches Recht, wobei nicht zu verkennen ist, dass es für eine Analogie zu Art. 4 Abs. 1 S. 2 an der Identität der Interessenlage (Anwendung des eigenen Rechts) fehlt.
Der 2014 verstorbene Erblasser (im Beispiel oben Rn 355) ist Schweizer mit letztem Wohnsitz in Italien. Das erstverwiesene schweizerische IPR verweist auf das letzte Wohnsitzrecht, also italienisches IPR. Dieses verweist auf das letzte Heimatrecht des Erblassers (Art. 46 Abs. 1 italIPRG), also auf schweizerisches Recht. Die Verweisung des italienischen Rechts ist partiell Gesamtverweisung; das italienische Recht ist bereit, eine Rückverweisung anzunehmen (Art. 13 Abs. 1 lit. b italIPRG), die das schweizerische Recht hier ausspräche. Dennoch brechen wir die Verweisungskette aus deutscher Sicht im schweizerischen Recht ab, weil sich hier die Kette erstmals schließt.
Die Regel, die Verweisung bei der Rechtsordnung abzubrechen, die als erste erneut in der Verweisungskette erscheint, führt zu Komplikationen, wenn dieser Staat weder eine Sachnorm-, noch eine Gesamtverweisung ausspricht, sondern der foreign court theory folgt, die häufig in England und den USA angewendet wird: Danach ist zB durch ein mit einer Erbsache befasstes englisches Gericht ein renvoi nach Ermessen anzunehmen, wenn ein Gericht des aus englischer Sicht verwiesenen Staates („Staat C“) englisches Recht anwenden würde. Die Entscheidung hängt somit davon ab, ob Staat C seine Verweisung in englisches Recht als Sachnormverweisung behandelt (dann nimmt das englische Gericht den renvoi an) oder als Gesamtverweisung – mit der Folge der Anwendung eigenen Rechts kraft Rückverweisung (dann behandelt das englische Gericht seine Verweisung als Sachnormverweisung). In dieser Konstellation ist fraglich, ob man aus deutscher Sicht die Verweisung in Staat C abbricht, weil die foreign court theory keine bedingungslose Gesamtverweisung ausspricht, oder man das Ergebnis der foreign court theory entscheiden lässt, was aber letztlich die spiegelverkehrte Anwendung des IPR von Staat C bedeutet.[64] Praktikabel dürfte es sein, die englische Verweisung, die nur fallweise bereit ist, einen renvoi anzunehmen, als Sachnormverweisung zu behandeln, auch wenn dies nicht in allen Fällen zur Entscheidungsharmonie führt.