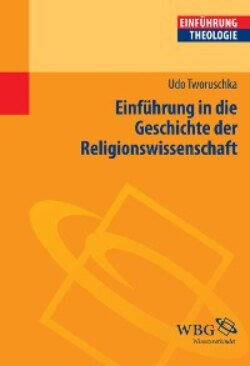Читать книгу Einführung in die Geschichte der Religionswissenschaft - Udo Tworuschka - Страница 20
7.2 Humanistisches Interesse an der antiken Religionswelt
ОглавлениеAls „Aufstand der Mediävisten“ (Wallace K. Ferguson) werden die mit der Abgrenzung der aufeinander folgenden Epochen (Spät-)Mittelalter und Renaissance einhergehenden Probleme bezeichnet. Dahinter steht die Kritik am idealisierten Renaissancebild Jakob Burckhardts, der diese Epoche als monolithische, einzigartige, perfekte Zivilisation dargestellt hatte. Undifferenziert wurde die Renaissance dem „finsteren Zeitalter“ (Petrarca) des Mittelalters gegenübergestellt. Bereits im 12. Jh. hatte es jedoch eine Renaissance gegeben, wodurch die Epoche der Renaissance das Exklusivrecht verlor, die Moderne begründet zu haben.
Kulturgeschichtliche Umwälzungen
Mehrere kulturgeschichtliche Umwälzungen prägten die Renaissanceepoche: die „Entdeckung“ Amerikas, die Erfindung von Schießpulver und Kompassnadel, die Begründung des heliozentrischen Weltbilds (Nikolaus Kopernikus), Gutenbergs Erfindung des Buchdrucks, die Reformation. Längst muss das Bild der fortschrittsfeindlichen katholischen Kirche im 16./17. Jh. korrigiert werden. Viele Vorkämpfer des wissenschaftlichen Fortschritts waren damals Geistliche (z.B. Kopernikus). Der Fall des gegen das ptolemäische Weltbild ankämpfenden Mathematikprofessors Galileo Galilei hing mit politischen Krisen, personalpolitischen Netzwerken im Vatikan zusammen. Er war kein Beweis für die generelle Wissenschaftsfeindlichkeit der katholischen Kirche. Hinzu kamen Entwicklungen der Handels- und Geldwirtschaft. Trotz vorhandener Kontinuitäten zum religiös-theologischen Weltbild des Mittelalters war der diesseitsorientierte Renaissancemensch Vertreter einer autonomen Natur, entschied und gestaltete nach eigenem Gutdünken. Renaissancehumanismus und Aufklärung waren durch den Fortschrittsgedanken verbunden. Man wollte nicht nur die Antike wiedergebären, vielmehr ihr überlegen sein. Wird der Epochenbegriff Renaissance auf die Bedeutung „Wiedergeburt der Antike“ eingeengt, werden Kontinuitäten zur Epoche der Aufklärung übersehen. Wichtige Anliegen der Humanisten waren Toleranz und Gewissensfreiheit.
Bildungsideal
Im Mittelpunkt der Renaissance stand die an den historisch-kritisch erforschten antiken griechischen und römischen Quellen ausgerichtete Bildung (Literatur, Sprache). Sie ermöglichte es dem Menschen, seine wahre Bestimmung zu erkennen und zu vervollkommnen. Dies fand seinen Ausdruck in einer vollendeten Sprachform. Die Pathosformel „ad fontes“ („zu den Quellen“) brachte diese Orientierung auf den Punkt. Außerdem war der Humanismus durch ein besonderes historisches Bewusstsein geprägt: Man empfand sich als Repräsentant einer neuen, an die klassische Antike anknüpfenden Epoche, die das „finstere Mittelalter“ überwunden hatte. Während der Zeit des Humanismus gab es bereits Persönlichkeiten, die über den europäischen Tellerrand hinausblickten.
Zu den Vorläufern des europäischen Akademiewesens zählte die Academia Platonica (1470–1521) in Florenz, die unter der Leitung des Platon- und Plotin-Übersetzers und -Kommentators Marsilio Ficino (1433–1499) an der Wiederbelebung des Platonismus und dessen Versöhnung mit dem Christentum („christlicher Platonismus“) arbeitete. An der Akademie unterrichteten aus Byzanz geflohene Gelehrte griechische Sprache, Philosophie und Literatur. Marsilio Ficinos Schüler Pico Della Mirandola (1463–1494) gehörte zu den ersten Gelehrten, die Kenntnisse der jüdischen Kabbala über die jüdischen Zirkel hinaus verbreiteten. Für die Entwicklung der Religionswissenschaft im 17. Jh. fiel die Auseinandersetzung mit dem (antiken) „Heidentum“, seinen Mythen und „Fabeln“ sowie seinem Verhältnis zur biblischen Religionstradition ins Gewicht. Der niederländische Humanist und (mild) reformierte Theologe Gerhard Johannes Vossius (1577–1649) griff in seinem Werk „De theologia gentili …“ (3 Bde. 1642) auf die Abhandlung von Alessandro Sardi (1520–1588) „De Moribus Ac Ritibus Gentium“ (1577) zurück. Vossius sammelte alle verfügbaren heidnischen Religionsphänomene in klassisch-antiken, jüdischen und christlichen Quellen. Er nutzte bereits die Informationen von Entdeckern, Missionaren und Kolonisten. Vossius führte alle heidnischen Gottheiten auf biblische Ursprünge zurück, unterschied zwischen der göttlichen Offenbarung und den nach dem Sündenfall entstandenen Religionstraditionen.
Der Priesterbruder Johannes Boemus/Böhm (um 1485–um 1533/35), Verfasser des Werkes „Omnium gentium mores, leges et ritus“ („Sitten, Recht und Gebräuche/Riten aller Völker“, 1517/20), gilt als einer der ersten humanistischen Ethnographen bzw. Religionswissenschaftler. Sein Werk, das sich an Zuhausegebliebene und Nichtreisende richtete, behandelte die Völker Afrikas, Asiens und Europas. Böhms Werk unterscheidet sich von vielen seiner Vorläufer durch „new standards of style, plausibility and systematic coherence“ (Vogel 1995: 19). Böhme griff auf klassische (u.a. Herodot, Plinius, Sabellicus) sowie Renaissanceautoren zurück und erreichte „a new level of scholarly discourse and literary method“ (ebd.).