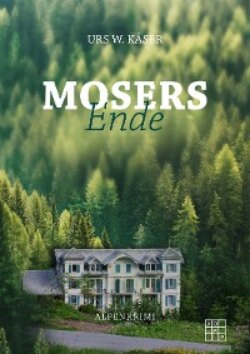Читать книгу Mosers Ende - Urs W. Käser - Страница 5
ОглавлениеFreitag, 20. Juli 2012
In vielen engen Kurven wand sich die steile Strasse durch das Reichenbachtal hinauf. Aus Erfahrung wusste ich, dass ich mich jetzt keiner Träumerei hingeben durfte, sondern konzentriert durch das Fenster blicken musste, um mir die sonst drohende Übelkeit vom Leib zu halten. Zum Glück nahm der Chauffeur die Haarnadelkurven nicht sportlich rassig, sondern langsam und gleichmässig, als wüsste er von meinem angeschlagenen Gleichgewichtsorgan. Wir waren nur drei Passagiere in diesem Nachmittagskurs. Christian Abegglen, las ich auf dem kleinen Schild, das oberhalb der Frontscheibe angebracht war. Der Name kam mir bekannt vor, wahrscheinlich war er es gewesen, der mich auch im vorletzten Sommer im Postauto hinauf gefahren hatte. Ich war bestimmt schon zum zehnten Mal in diesem Tal unterwegs, aber immer wieder von Neuem stellte ich mir die Frage, wer denn auf die Idee gekommen war, durch diesen steil ansteigenden Wald und die enge Schlucht einen Fahrweg zu bauen. Was erwartete einen denn hinter der Schlucht? Nein, nicht das Paradies, sondern ein tief eingeschnittenes Tal, im Winter dauerhaft im Schatten der hohen Berge liegend, im Sommer ein sonniger Weidegrund für das Rindvieh aus dem Unterland. Aber eben nicht nur dies! Direkt am schäumenden Bach, inmitten von blumenreichen Weiden und dunklen Tannen, mit einem spektakulären Blick auf die Felswände der Engelhörner, da stand es, seit bald hundert Jahren fast unverändert: Das Hotel Rosenlaui!
Wir waren noch mehrere Kilometer vom Hotel entfernt, aber vor meinem geistigen Auge sah ich es schon klar und deutlich: Die breite Fassade des 1904 erbauten, vierstöckigen Hauptgebäudes, im Erdgeschoss etwas nach links versetzt den Hoteleingang, rechts davon die hohen Fenster des Frühstückssaales. Darüber, in der ersten Etage, die grosse Bibliothek, daneben der Speisesaal, dann in der zweiten bis vierten Etage die Fremdenzimmer. Die cremefarbene Fassade, zu der die graublau gestrichenen Fensterläden einen schönen Kontrast bilden. Die meisten Zimmer mit einem kleinen Balkon mit schmiedeeiserner Brüstung. Die Fassade gekrönt von fünf separaten kleinen Steildächern, ein richtiges Bijou!
Mit fünf Minuten Verspätung hielt das Postauto vor dem Hotel. Ich schwang meinen Rucksack über die Schulter, packte meinen grossen Rollkoffer, stieg aus, sah mich um und dachte: Gottlob! Seit dem vorletzten Sommer schien sich hier nichts verändert zu haben. Linkerhand des Hauptgebäudes stand immer noch der kleine Pavillon, in dem man Getränke und Kuchen kaufen konnte, daneben ein Dutzend grün gestrichene, von Ahornbäumen beschattete Gartentische mit dazu passenden Stühlen. Es war ein herrlicher Sommernachmittag, die Luft angenehm warm, und der Hotelgarten erschien gesprenkelt von den durch das Ahornlaub blitzenden Sonnenstrahlen. Etwa die Hälfte der Tische war besetzt, Familien mit Kindern und auch ältere Gäste genossen die lauschige Stimmung.
Ich wandte mich dem Hotel zu. Die breite Türe stand, wie immer bei schönem Wetter, offen, ich trat ein und stellte mich vor die Rezeption. Es war niemand da, so drückte ich den Klingelknopf. Keine drei Sekunden waren vergangen, als sich die Türe des dahinterliegenden Büros öffnete, eine grosse, schlanke Frau mit langen, blonden, gewellten Haaren erschien und mir die Hand entgegenstreckte.
»Willkommen, Herr Wolf, schön, dass Sie wieder einmal bei uns zu Gast sind!« Ich drückte ihre grosse, warme Hand.
»Guten Tag, Frau Dietrich, auch ich freue mich sehr, hier im Rosenlaui einige ruhige Tage verbringen zu dürfen.«
Hotelchefin Claudia Dietrich lächelte charmant. Sie musste um die fünfzig sein, sah aber viel jünger aus.
»Ja, mit ruhig treffen Sie den Nagel auf den Kopf. Wie Sie wissen, gibt es bei uns für die Gäste weder Fernsehen noch Radio noch Internet, und der Mobiltelefonempfang ist sehr schlecht. Höchstens das Bimmeln der Kuhglocken könnte Sie beim Schreiben stören. Und abends, da kann man zwar noch in unserer Bar sitzen und sich amüsieren, aber es läuft keine laute Musik, und betrunkene Gäste gibt es kaum. Und um viertel vor zwölf ist strikte Nachtruhe im Haus, da pochen wir darauf.«
»Wunderbar, genau das, was ich jetzt brauche. Wissen Sie, ich schreibe an einem Kriminalroman, dessen Handlung hier in der Umgebung spielt, und ich erhoffe mir Inspiration durch Landschaft und Leute.«
»Oh, das freut mich sehr«, erwiderte Claudia Dietrich mit wachem Blick und legte einen Formularblock vor mich hin, »aber hüten Sie sich bloss davor, unser Tal in einem schlechten Licht zu zeigen. Sonst lasse ich alle Ihre Bücher verbrennen…«
»Im Gegenteil, ich will die schöne Gegend im allerbesten Licht darstellen. Ein kleines Verbrechen kann ja schliesslich überall passieren…«
»Na gut, hoffen wir das Beste. Nun muss ich Sie aber bitten, auf diesem Formular noch die Angaben für das Fremdenverkehrsamt auszufüllen.« Ich nahm meinen Kugelschreiber zur Hand und füllte das Formular aus.
»Aha, jetzt ist der Groschen gefallen«, kommentierte Claudia Dietrich, »ich habe die ganze Zeit nach Ihrem Vornamen gesucht. Valentin Wolf, was für ein schöner Name!«
»Ist nicht mein Verdienst, trotzdem Danke für das Kompliment«, sagte ich, nahm den Zimmerschlüssel in Empfang und begann mit meinem Gepäck die Treppe hochzusteigen.
Ach so, erinnerte ich mich beim Anblick des Schlüssels in meiner Hand, Nummer Neunzehn, also habe ich dasselbe Zimmer wie vor zwei Jahren, wie aufmerksam von der Chefin! Ich hatte das Zimmer damals explizit gelobt, und sie hatte es sich notiert. Die mehr als hundertjährige Treppe war mit einem Läufer belegt, aber unter dem weichen Belag knarrte und quietschte das Holz bei jedem Schritt in allen Variationen. Auf dem ersten Treppenabsatz hörte ich plötzlich ein bedrohliches Knurren. Ich blieb abrupt stehen und hob meinen Kopf.
»Ach so, du bist es, Bäri«, sagte ich halblaut und streckte meinen rechten Arm aus, »komm zu mir, kennst du mich denn nicht mehr?« Der grosse, alte Berner Sennenhund, der seit elf Jahren zum Rosenlaui gehörte, hörte sofort auf zu knurren, bellte zweimal kurz, begann eifrig zu wedeln und kam langsam die Stufen herunter. Ich streichelte seinen Kopf und kraulte ihn ausgiebig hinter den Ohren, wie er es so gern mochte. Dann entliess ich ihn die Treppe hinunter und stieg weiter hinauf in die dritte Etage.
Ja, der Hotelprospekt versprach wahrlich nichts Falsches: Beim Eintreten ins Zimmer fühlte ich mich auf einen Schlag um hundert Jahre zurückversetzt. Der Fussboden mit breiten, langen Dielen aus Tannenholz belegt, die Wände mit blassblauen Tapeten in Lilien-Muster, ein Landschaftsgemälde in überdimensioniertem Rahmen, an der Zimmerdecke geschwungene Bögen aus weissem Stuck, neben dem Fenster ein mächtiger Heizungsradiator, an der linken Wand ein viel zu hohes Bett mit weissem Leintuch und braunen Wolldecken, in der Ecke ein klobiger Schrank aus dunklem Holz, rechterhand eine schwere Kommode auf vier Füssen, darauf eine Waschschüssel und ein riesiger Krug. In den Zimmern gab es, wie eben vor hundert Jahren, kein fliessendes Wasser. Toilette und Bad befanden sich am Ende des langen Ganges.
Beinahe drei Stunden hatte meine Reise von Bern aus gedauert, und ich fühlte eine leichte Müdigkeit in mir aufsteigen. Vor dem Abendessen blieb mir noch genügend Zeit für ein Nickerchen und vielleicht einen ersten Spaziergang in der sauberen Bergluft. Ich räumte mein Gepäck provisorisch ein, legte mich angekleidet auf das Bett, und bald schon begannen mir die Augen zuzufallen.
Woher kommt denn diese Musik? Das klingt doch nach Chopin! Langsam richte ich mich im Bett auf, schaue auf die Uhr. Zehn vor sieben, jetzt habe ich doch tatsächlich fast zwei Stunden lang geschlafen! Schnell mache ich mich zurecht und steige die Treppe hinunter. Vor dem Eingang zum grossen Speisesaal in der ersten Etage bleibe ich stehen und schaue hinein. Am Flügel, hinten im Saal, sitzt Claudia Dietrich und spielt ein buntes Potpourri aus Chopin-Walzern. Wie leicht ihre Finger, durch tausendfache Übung geschult, über die Tastatur gleiten! Schwebend und perlend kommen die Töne aus dem mächtigen Instrument, steigen empor, verteilen sich im Saal, nehmen mich gefangen, lassen mich eintauchen in eine himmlische Klangwelt. Gebannt höre ich eine Weile einfach nur zu. Was für ein wunderschöner Auftakt zum Abendessen!
Das Hotel scheint gut besetzt zu sein, denn auf allen Tischen ist gedeckt. Zum Glück bin ich noch rechtzeitig aufgewacht! Ich hatte mir nämlich vorgenommen, mir einen Einzeltisch in der vorderen Ecke des Saales zu schnappen. Wenn man schon alleine essen muss, will man doch wenigstens die anderen Gäste ausgiebig beobachten können! Ich habe Glück, mein Wunschtisch ist noch frei.
Kaum habe ich Platz genommen, erscheint der Herr des Hauses, Daniel Dietrich, ein grosser, hagerer Mann mit grau-blondem Fünftagebart, durch die hintere Saaltür und eilt sofort auf meinen Tisch zu.
»Mein lieber Herr Wolf, willkommen im Rosenlaui! Ich hoffe, Sie bleiben einige Wochen bei uns.«
»Na ja, einige Wochen«, erwidere ich trocken, »das würde mein Budget sprengen. Die Preise sind seit dem Bau des Hotels leider nicht stehengeblieben…« Daniel Dietrich lacht. Wie seine Frau, sieht auch er noch ziemlich jung aus, obwohl er seit mehr als zwanzig Jahren das Rosenlaui führt.
»Da haben Sie Recht. Aber immerhin sind wir, im Vergleich zum Schweizer Durchschnitt, noch sehr günstig.«
»Das muss ich zugeben. Und man bekommt für sein Geld auch etwas. Wunderschöne Zimmer und ausgezeichnete Verpflegung.«
»Danke für die Blumen, Herr Wolf, und jetzt wünsche ich Ihnen einen guten Appetit.«
Unterdessen hat Claudia Dietrich unter starkem Applaus ihr kleines Konzert beendet. Fast alle Tische sind jetzt besetzt und der Geräuschpegel im Saal hat markant zugenommen. Aufmerksam mustere ich die anderen Hotelgäste. Vom Aussehen her und aus den Gesprächsfetzen, die an mein Ohr dringen, stammen die meisten Gäste aus der Deutschschweiz. Nur von der Fensterfront her kann ich Worte in Hochdeutsch und in Holländisch aufschnappen. Was mir am meisten auffällt und woher die lautesten Stimmen kommen, ist ein sehr langer Tisch in der Saalmitte, an dem zehn Personen sitzen. Ob das wohl ein Verein ist, oder ein Freundeskreis, der hier logiert, frage ich mich. Nein, von der Altersstruktur her ist das unwahrscheinlich. Es sind sieben Erwachsene, alle im Alter etwa zwischen vierzig und fünfzig, sowie drei Teenager. Also wohl eher eine Zusammenkunft mehrerer Familien, denke ich. Meine Neugier ist definitiv geweckt!
»Herr Wolf?«
»Oh«, schrecke ich auf, »Entschuldigung, ich habe Sie gar nicht kommen hören. Sie sind doch, hm, Maria?« Maria Manzoni lächelt.
»Genau, Herr Wolf, Sie haben ein gutes Gedächtnis. Hier, bitte, Ihre Suppe.«
»Vielen Dank, Maria. Und ich nehme dann, wie immer, einen Dreier Rioja zum Essen.« Eine Weile lang vertiefe ich mich in die sämige, wunderbar gewürzte Tomatensuppe und nippe ab und zu an meinem Wein. Als Maria mit dem Hauptgang kommt – Kalbskotelette, Kartoffelpüree und grünen Bohnen – frage ich sie diskret nach dem grossen Tisch. Sie beugt sich etwas zu mir herunter und flüstert: »Das ist die grosse Familie Moser aus Meiringen. Alle vier Geschwister sind hier, zusammen mit den Frauen und Kindern. Und sie haben zusammen ein grosses Problem…« Ich nicke dankend und verzichte darauf, sie weiter auszufragen. Allein an meinem Tisch sitzend, habe ich Musse, die zehn Menschen, ihre Stimme, Mimik und Gestik ausgiebig zu studieren. Von ihren Gesprächen kann ich einen Teil, wenn auch längst nicht alles, verstehen. Nachdem Maria den Nachtisch – Vanillecreme mit Himbeeren – abgeräumt hat, bilde ich mir ein, die Rollen und Charaktere der Mosers zuordnen zu können und zu wissen, wer wie gut auf wen zu sprechen ist.
Da ist ein alleinstehender Mann um die fünfzig namens Samuel. Er könnte der älteste in der Geschwisterreihe sein, ist schlecht gelaunt, erscheint mir ehrgeizig, aber irgendwie unzufrieden mit seinem Leben. Dann ein Ehepaar mit zwei fast erwachsenen Söhnen, Luca und Remo. Der Vater, Michael, spielt ein wenig den Lebemann, stellt sich in den Mittelpunkt, scherzt herum. Ein Jurist oder ein Arzt? Die Mutter, Susanna, wirkt eher abwesend, träumerisch, beteiligt sich nur wenig am Gespräch. Wer von beiden ist wohl den Mosers angeheiratet? Ich kann es vom Aussehen her nicht entscheiden. Sodann ein zweites Ehepaar, Linda und Matthias, mit einer halbwüchsigen Tochter namens Elena. Ein sehr seltsames Paar ist das, man würde kaum denken, dass sie zusammengehören. Linda, stark geschminkt, ist offen, fröhlich, spricht unbefangen mit allen am Tisch. Matthias hingegen ist wortkarg, mürrisch, kommt mir wie eine Zielscheibe vor, so als würde er ständig angegriffen und müsse sich rechtfertigen und verteidigen. Worum es dabei geht, kann ich leider nicht verstehen. Matthias gleicht äusserlich Samuel, dürfte also sein Bruder sein.
Da geschieht etwas Unerwartetes. Das dritte, vermutlich jüngste und kinderlose Paar am Tisch steht auf, verlässt den Saal und erscheint kurz darauf wieder. Beide tragen eine kleine Handharmonika, ein sogenanntes Schwyzerörgeli, in den Händen. Gleichzeitig kommt von vorne Hotelchef Daniel Dietrich, einen Kontrabass schleppend, in den Saal und verkündet: »Verehrte Gäste, ich darf Ihnen Barbara und Bruno Brawand-Moser aus Meiringen vorstellen. Die beiden wirken seit vielen Jahren in der Ländlerkapelle Echo vom Brünig mit und haben sich bereit erklärt, uns mit einem kleinen volkstümlichen Konzert zu unterhalten, zu dem ich mit meinem Bass beisteuern darf.« Aha, denke ich, dieser Bruno Brawand hat in die Familie Moser eingeheiratet.
Und sogleich beginnt das erste Musikstück, ein traditioneller Schottisch. Die Finger der Brawands laufen mit atemberaubender Schnelligkeit auf den zahllosen Knöpfen ihrer Schwyzerörgeli hin und her. Es wird mir immer ein Rätsel bleiben, wie man seine Finger zu solcher Virtuosität trainieren kann. Währenddessen lässt Dietrich mit stoischer Ruhe den Bogen über die Saiten seines Kontrabasses hin und her gleiten. Schon nach wenigen Takten hat die fröhliche Melodie des Schottisch den ganzen Speisesaal in seinen Bann gezogen. Man wiegt sich im Takt, summt mit oder klopft den Rhythmus, sei es mit den Schuhen auf dem Fussboden oder mit den Fingern auf dem Tisch. Auch der nachfolgende Walzer im Dreivierteltakt nimmt das Publikum sofort mit, einige Paare sind sogar aufgestanden und drehen sich tanzend im Kreise. Ohne Pause folgt ein Musikstück dem anderen. Nach dem sechsten Stück steht Barbara Brawand auf, hält ihre Hände wie einen Trichter von den Mund und singt mit ganzer Inbrunst das sogenannte Sennengebet. Ein solches lassen die traditionellen Alphirten jeweils in der Abenddämmerung von den Bergen herab erklingen, wobei sie einen extra dafür angefertigten grossen, hölzernen Schalltrichter verwenden. Auf der Alp oben wäre das Ganze noch viel schöner anzuhören, weil die von den Bergflanken zurückkommenden Echos das Lied mehrstimmig erscheinen lassen und ihm einen schaurig-schönen Klang verleihen. Aber sogar hier im Saal läuft es mir kalt den Rücken herab. Nach einem letzten Schottisch legen die Musikanten ihre Instrumente nieder und verbeugen sich, unter langem Applaus, vor dem Publikum.
Zum Abschluss des feinen Abendessens lasse ich mir einen Tessiner Grappa die Kehle hinabrinnen. Dann erhebe ich mich, verlasse den Speisesaal und begebe mich in die gleich gegenüber liegende, grosse Bibliothek des Hauses. Auch hier fühlt man sich absolut wie zu Thomas Manns Zeiten. Der Raum ist gegen zwanzig Meter lang und sechs Meter breit, und die Wände sind fast lückenlos mit Bücherregalen bedeckt. An der Fensterfront stehen sechs oder sieben breite, tiefe Polstersessel mit reichlich abgewetztem Bezug, und neben jedem Sessel steht eine Leselampe mit grossem, grünem oder gelbem Schirm, die bloss einen düster-bleichen Lichtkegel verbreitet. In der Längsachse des Raumes stehen, von hochlehnigen Stühlen umsäumt, drei rechteckige, schwere Tische. Zwei davon sind wohl als Lesetische gedacht, auf dem dritten, niedrigeren steht ein spielbereites Schachbrett.
Unglaublich, was sich in dieser Bibliothek im Laufe der Zeit an Büchern angesammelt hat. Die meisten Bände sind wohl alte, klassische Werke. In eintöniger Reihe stehen sie auf dem Regal, mit ihren düsteren, dunkelgrauen oder braunen Bücherrücken und den kaum mehr leserlichen Titeln. Nur ab und zu leuchten dazwischen, wie Farbtupfer, neuere Bücher mit roten, gelben oder weissen Rücken auf. Ich schreite ganz langsam den Bücherreihen entlang und überfliege die Titel. Man könnte hier wohl ganze Tage damit zubringen, alte und neue Kostbarkeiten ausfindig zu machen, da und dort einen Band zur Hand zu nehmen, einige Seiten zu lesen, um dann in den langen Regalen weiter zu stöbern…
Die Zeit verrinnt wie im Fluge in diesem ehrwürdigen Raum. Ich schaue auf die Uhr. Halb elf, Zeit für meine Zimmerruhe. Ich steige die Treppe hoch, gehe ins Bad und lege mich dann angekleidet mit einem Buch aufs Bett. Gähnend versuche ich, noch einige Seiten zu lesen, aber ich merke, wie mir die Augenlider schwer und schwerer werden…
Plötzlich schrecke ich auf. Was ist denn da los? Ein dumpfer Lärm und ein unterdrückter Schrei haben mich geweckt. Jetzt meine ich, Schritte im Flur zu hören. Woher das wohl kam? Ich horche angestrengt. Von weit her höre ich leises Stimmengemurmel. Das muss von der Bar im Nebengebäude kommen, wohin sich viele Hotelgäste nach dem Essen zu einem Drink verzogen haben. Sonst herrscht absolute Stille im Haus.
Habe ich mich getäuscht, das Ganze nur geträumt? Wahrscheinlich, denke ich, so muss es sein. Ich lege mich wieder aufs Ohr und döse bald wieder ein. Da: Unvermittelt zerreisst ein gellender Schrei die Stille! Eine Türe schlägt krachend, jemand poltert dumpf im Treppenhaus und schreit verzweifelt um Hilfe. Es ist eine Frauenstimme!