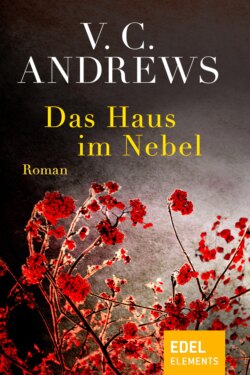Читать книгу Das Haus im Nebel - V.C. Andrews - Страница 17
ОглавлениеKAPITEL ACHT
Ich hatte nicht vor, mich mit Lloyd anzufreunden. Bis zu dem Tag, als er in der Cafeteria zu mir kam, habe ich ihn, glaube ich, keine zweimal angeschaut.
Ich saß allein dort, tat mir selbst Leid und hasste alles und jeden um mich herum. Vermutlich hatte ich diesen bitteren, unglücklichen Gesichtsausdruck. Als Lloyd sein Tablett auf den Tisch knallte und auf den Sitz neben meinem glitt, war ich so tief in finstere Gedanken versunken, dass ich ihn weder hörte noch sah. Um meine Aufmerksamkeit zu erregen, stieß er mich absichtlich mit der Schulter an, wodurch ich etwas Suppe verschüttete. Am liebsten hätte ich demjenigen, der das getan hatte, ins Gesicht geschlagen.
›Tut mir Leid‹, meinte er, ›aber du hast dich so weit herübergelehnt, dass du zwei Plätze gebraucht hast.‹
›Habe ich nicht‹, protestierte ich. Er zuckte nur die Achseln. ›Dann war ich’s vielleicht‹, sagte er und lachte.
Ich wusste natürlich, wer er war. Jeder wusste, wer Lloyd Kimble war, genauso wie man weiß, was ein Skorpion oder eine Klapperschlange ist. Man musste nicht direkt in Kontakt damit gekommen sein, um zu wissen, dass man besser Abstand hielt.
›Was ist passiert?‹, fragte er mit einem halben Lächeln. ›Deine Freunde haben dich fallen lassen?‹
Er nickte in ihre Richtung.
›Nein‹, entgegnete ich scharf. Ich war nicht in der Stimmung, dass man sich über mich lustig machte. ›Niemand hat mich fallen lassen.‹
Lloyd hat ein Lächeln, das einen rasend macht. Er verzieht die Lippen, und man hört förmlich, wie das Gelächter aus seinen arroganten Augen schallt, aber gleichzeitig ist es auch irgendwie sexy. Er ist gefährlich, und das macht ihn wohl aufregend. Er macht, was er will und wann er will. Er ist impulsiv und respektiert weder Regeln noch Autoritäten.
Mr Calder, der die Aufsicht in der Cafeteria hatte, schaute mich mit einem solchen Blick voller Verachtung an, wie ich mich erniedrigen und Lloyd Kimble gestatten konnte, neben mir zu sitzen, und mit ihm zu reden? Plötzlich fühlte ich mich so wütend und rebellisch, wie Lloyd meiner Meinung nach wohl auch war. Welches Recht hatte Mr Calder zu entscheiden, wer meine Freunde sein sollten und wer nicht? Er war mein Englischlehrer, nicht mein Vater oder mein älterer Bruder. In dem Augenblick verachtete ich alle Erwachsenen auf der Welt, weil sie rechthaberische Heuchler waren.
›Eine Beverly wie du sitzt normalerweise nicht alleine, es sei denn, irgendetwas stimmt nicht, und ich bin mir sicher, dass es nicht an deinem Atem liegt‹, kommentierte Lloyd, während er in seinen Hamburger biss.
›Was ist eine Beverly?‹, fragte ich ihn.
Einen Augenblick lang hörte er auf zu kauen und lächelte, dann kaute er weiter, bis er herunterschluckte und zu Darlene und meinen anderen Freundinnen deutete.
›Eine Beverly. Du weißt schon. Mädchen aus Beverly Hills, verwöhnte Miststücke.‹
›Ich wohne in Beverly Hills, bin aber wohl kaum eine verwöhnte Schlampe‹, entgegnete ich mit mehr Mut, als ich für möglich gehalten hätte. Sein Lachen machte mich noch wütender.
›Bin ich nicht!‹
›Schön für dich‹, meinte er. ›Und warum sitzt du nicht bei ihnen?‹
›Das ist ein Haufen Heuchler, wenn du es schon wissen musst‹, sagte ich.
›Oh, das weiß ich‹, sagte er. ›Was haben sie dir denn getan, deine Kreditkarte kaputtgemacht?‹
›Sehr witzig. Sie haben überhaupt nichts getan‹, erwiderte ich. ›Sie glauben einfach … sie wären jetzt etwas Besseres als ich.‹
›Warum jetzt?‹, hakte er nach. Ich wandte mich zu ihm um, schaute ihn an und fragte mich, warum er plötzlich so interessiert an mir war. ›Du siehst aus, als könntest du einen echten Freund gebrauchen‹, bot er mit diesem aufreizenden Achselzucken und Lächeln an.
›Du wirst dich doch nicht herablassen und mein Freund sein wollen?‹, forderte ich ihn heraus. ›Der Freund einer Beverly?‹
›Ich tue, was ich will‹, erwiderte er streng unnachgiebig. ›Niemand schreibt mir vor, wer meine Freunde sein sollen.‹
Er lächelte wieder sanft. Plötzlich erschien er mir nicht mehr so gefährlich, wie jeder, den ich kannte, behauptete, und als ich so dicht neben ihm saß, fiel mir auf, dass er auch viel besser aussah, als ich gedacht hatte. Er hatte große dunkle Augen, die boshaft funkelten. Vielleicht war ich gerade in der richtigen Stimmung für ihn. Wir redeten noch etwas weiter, und ich entdeckte, dass er Humor hatte, besonders in Bezug auf meine Freunde. Ich lachte und er lachte, und ich erzählte ihm von meinen Eltern und wie meine so genannten Freunde darauf reagiert hatten. Er wusste mehr über mich, als ich erwartet hatte. Er wusste, dass ich mit Charles Allen ausgegangen war, und als ich ihm erzählte, das sei ein weiterer großer Fehler gewesen, wurde sein Lächeln noch wärmer.
Ich merkte, dass meine Freunde umso mehr über mich tratschten, je länger ich mit ihm redete und bei ihm sitzen blieb. Ich gebe zu, dass ich anfänglich nur alle schockieren wollte, aber nachdem ich einige Zeit mit Lloyd verbracht hatte, fing ich wirklich an, ihn zu mögen. Er und ich hatten mehr gemeinsam, als ich je vermutet oder zugegeben hätte. Er schien meine Gefühle für meine Eltern wirklich zu verstehen, und dann sagte er etwas, das ich für sehr wahr hielt.«
»Was?«, fragte Star. Sie interessierte sich jetzt richtig für meine Geschichte.
»Er sagte, dass Kids wie wir schneller erwachsen werden müssen und dass Erwachsenen das nicht klar ist oder dass sie es nicht wahrhaben wollen und uns weiter wie Kinder behandeln, wenn wir bereits meilenweit davon entfernt sind. Aber nicht weil wir es so wollen. Es passiert einfach.
Er sagte auch, man könne sich keine Sorgen darüber machen, ob das fair ist oder nicht. Man muss es einfach hinnehmen und tun, was man tun muss, und wenn das den Erwachsenen nicht gefällt, müssen sie sich wohl oder übel damit abfinden.«
»Brillant«, kommentierte Jade und verzog ihren Mund wie eine Geldbörse mit einer Ziehschnur.
»Das dachte ich damals«, fuhr ich sie an. »Es ist kein hochkünstlerisches Zeug wie in einigen Büchern, die du und ich vielleicht lesen, aber dennoch trifft es zu, besonders auf mich, und ich wette, auf dich auch.«
Einen Moment wirkte sie nachdenklich, dann wandte sie den Blick ab.
»Was passierte dann mit ihm?«, fragte Star. Zögernd drehte Jade sich wieder um, um zuzuhören.
»Wir verbrachten immer mehr Zeit miteinander, trafen uns zwischen den Stunden, beim Mittagessen, nach der Schule. Er hatte kein Auto, aber ein Moped, das, wie ich später herausfand, keine Versicherungsplakette und ein abgelaufenes Kennzeichen trug. Lloyd machte sich darüber keine Gedanken.
›Verschleiß dich nicht an Kleinigkeiten‹, lautete seine Devise.
Er brachte mich viel zum Lachen, und ich fühlte mich besser, wenn ich mit ihm zusammen war. Ich fühlte mich … frei von allem. Wenn ich mit ihm zusammen war, hörten die Streitereien in meinem Kopf auf.
Mommy hatte noch einige weitere Rendezvous mit verschiedenen Männern, aber keiner von ihnen taugte in ihren Augen etwas. Dass mein Vater glücklicher war, erbitterte sie. Häufig ging sie mit Frauen zum Essen aus, die Männern gegenüber ähnliche Gefühle hegten wie sie und zu den AMH wurden, den Anonymen Männerhasserinnen, wie ich sie heute nenne. Nach dem, was ich gelesen habe, führen die Anonymen Alkoholiker Treffen durch, die sich nicht allzu sehr davon unterscheiden. Diese Frauen treffen sich zum Kaffee bei uns zu Hause, und dann höre ich sie wie wütende Hennen gackern. Jede von ihnen beginnt dann zu erzählen, wie sie von ihrem Ehemann oder Freund zum Narren gehalten wird. Sie gibt zu, dass es größtenteils ihr eigener Fehler ist, und alle zeigen Mitgefühl. Sie schwören, sich nie wieder auf eine ernste Beziehung mit einem Mann einzulassen, und freuen sich diebisch über jede, die einen Mann ausgenutzt oder einem Mann das Herz gebrochen hat.
Meine Mutter prahlt damit, dass sie meinem Vater das Leben zur Hölle macht und mich wie ein Schwert drohend über sein Haupt hält. Sie erzählte ihnen von den Rechnungen und wie sie den Einfluss ihres Anwalts über ihn und seinen Anwalt ausnutzt. Daraufhin applaudierten und gratulierten die anderen Frauen ihr und jubelten, als hätte sie eine größere Schlacht für die Rechte der Frauen gewonnen.
Ich erzählte Lloyd davon; da sagte er, er wolle nie Kinder haben und würde nur heiraten, wenn die Frau das genauso sähe.
›Wer will schon das Leben eines anderen Menschen ruinieren? ‹, meinte er.
Ich fand das sehr traurig, aber ich verstand es auch. Er und ich trafen einander mittlerweile seit zwei Wochen hin und wieder. Meistens trafen wir uns in der Schule oder im Einkaufszentrum. Ich wusste, dass alle meine Freundinnen ihn für sexbesessen hielten, aber das stimmte überhaupt nicht. Tatsächlich war er schüchtern, hatte fast Angst davor, einen zu berühren oder zu küssen.
Als ich das Darlene erzählte, die ständig hinter mir her war, weil ich ihr etwas erzählen sollte, damit sie es weitertratschen konnte, meinte die, dass er vermutlich nur eine bestimmte Technik bei mir anwendete, wie eine Spinne, die ihr Opfer ins Netz locken will. Zugegebenermaßen hatte ich die Idee seitdem im Kopf. Aber selbst als ich eines Nachmittags zu ihm nach Hause ging, versuchte er nicht, sich mir irgendwie zu nähern.
›Bist du sicher, dass du einer Beverly gestatten willst, dein Zimmer zu sehen?‹, fragte ich ihn, worauf er mir erwiderte, er sei mittlerweile völlig sicher, dass ich gar keine Beverly sei. Noch vor zwei Wochen hätte ich das nicht als Kompliment betrachtet, aber jetzt bedeutete es, dass er mir sein Vertrauen aussprach, dass er mich respektierte, mich für echt hielt.
Ihre Wohnung war klein, und seine Mutter hielt sie nicht besonders gut in Schuss. Schmutziges Geschirr vom Vortag stand herum, auf Fensterbrettern und Möbeln lag dicker Staub, in den Teppichen waren üble Flecken. Alles in der Wohnung, die Geräte, die Möbel, die Teppiche, ja selbst die Wände wirkten erschöpft, verwohnt. Er erklärte mir, dass seine Mutter gerade einen neuen Freund habe und sich viel bei ihm aufhalte. Mir war nicht klar, dass Lloyd deshalb manchmal tagelang allein zu Hause war. Aber bald begriff ich das. An jenem ersten Tag machte ich tatsächlich eine Menge sauber, etwas, das ich zu Hause kaum je getan hatte. Lloyd sagte mir ständig, dass ich das nicht tun müsse.
›Ich weiß, dass ich das nicht muss‹, erklärte ich ihm, ›aber ich will es für dich tun.‹
›Meine Mutter wird merken, dass ich jemanden mitgebracht habe‹, sagte er. ›Sie weiß, dass ich nicht besonders viel sauber mache.‹
›Dann soll sie es halt wissen‹, entgegnete ich. Das gefiel ihm. Eines Abends, als meine Mutter die AMH zu Besuch hatte, erzählte ich ihr, ich würde mich mit Darlene im Einkaufszentrum treffen, und nahm stattdessen ein Taxi zu Lloyds Wohnung. Er war sehr überrascht, mich zu sehen. Was ihm am besten gefiel, war, dass ich es einfach getan hatte und damit genauso impulsiv war wie er selbst. Ich befürchtete, ein anderes Mädchen könnte bei ihm sein oder seine Mutter wäre zu Hause und hätte etwas gegen meinen Besuch. Aber er war alleine.
Wir hörten uns etwas Musik an, redeten eine Weile, und plötzlich lag ich in seinen Armen und küsste ihn. Wir brauchten nicht lange, um uns auszuziehen und ins Bett zu gehen. Ich hatte sehr große Angst, aber nicht vor ihm. Ich hatte Angst vor mir selbst, Angst davor, unter Mommys Problem zu leiden, was auch immer es war, und Lloyd würde mich dann nicht mehr mögen, so wie mein Vater meine Mutter nicht mehr mochte. Ich wollte das jetzt wirklich herausfinden.
Lloyd war überrascht, als er feststellte, dass ich keine Jungfrau mehr war, aber er war nicht ärgerlich darüber. Er ließ sich Zeit und war behutsam, viel sanfter und romantischer als Charles Allen mit all seinem Reichtum und seiner Erfahrung.
Wir begannen sehr langsam. Ständig befürchtete ich, große Schmerzen zu spüren, aber stattdessen empfand ich großes Vergnügen. Ich wusste, dass ich leichtsinnig war, weil er kein Verhütungsmittel benutzte, aber ich fühlte mich trunken von meinen Gefühlen, raste über erotische Highways und hatte keine Angst vor Zusammenstößen.
Hinterher war ich so glücklich. Ich hatte das Gefühl, mir bewiesen zu haben, dass ich normal war und dass der Mann, der mich heiratete, nicht feststellen musste, dass ich frigide war, und sich von mir scheiden lassen musste.
Lloyd und ich kamen uns näher, aber ich hatte Angst, Lloyd nach Hause einzuladen. Ich wusste, was meine Mutter von ihm denken würde, wenn sie ihn sah, wie sie reagieren würde, und dass sie mir das Leben zu Hause noch mehr zur Qual machen würde. In der folgenden Woche heckten Lloyd und ich einen Plan aus, eine ganze Nacht gemeinsam bei ihm zu Hause zu verbringen.
Am Mittwoch war er jedoch sehr deprimiert, als ich ihn in der Schule traf. Er erzählte mir, dass seine Mutter zu Hause sein und das Wochenende dort mit ihrem Freund verbringen werde. Ich hatte versucht, eine Freundin zu finden, der ich vertrauen konnte und von der ich behaupten konnte, sie hätte mich übers Wochenende eingeladen. Jetzt bestand keinerlei Grund mehr dazu.
Dann rief mein Vater an. Ich hatte vergessen, dass ich laut Terminplan das Wochenende mit ihm verbringen sollte, aber wie das so häufig der Fall war, musste er den Termin absagen. Er war wieder unterwegs auf einer Geschäftsreise.
Nur diesmal«, sagte ich und strahlte Star dabei an, »erzählte ich meiner Mutter nichts davon. Sie glaubte, ich sei das ganze Wochenende bei meinem Vater.«
»Cool«, meinte Star.
»Hattest du keine Angst, dass sie es herausfinden würde?«, fragte Cat. Sie hatte ganz still dagesessen, sich kaum gerührt und sich verhalten wie ein kleines Mädchen, das von seiner Mutter oder der Lehrerin eine Geschichte vorgelesen bekommt und Angst hat, irgendjemand oder irgendetwas würde sie unterbrechen.
»Das war mir egal. Vielleicht wollte ich erwischt werden«, sagte ich ihr. Sie schaute rasch zu Boden.
»Wohin wolltet ihr beide denn, in ein Motel?«, fragte Jade.
»Nein. Ich hatte eine bessere Idee. Daddy hatte mir verraten, wo er den Ersatzschlüssel zu seiner Wohnung aufbewahrte für den Fall, dass ich ihn einmal besuchte und er oder Ariel noch nicht zu Hause waren. Er steckte hinter einem Wandschränkchen an seinem Parkplatz in der Tiefgarage.
Wir gingen in die Wohnung. Lloyd war sehr beeindruckt davon. Er bediente sich an Daddys Barschrank, und ich machte uns etwas zu essen. Wir taten so, als sei es wirklich unsere Wohnung und wir wären verheiratet. Wir sahen fern, und dann packte uns die Leidenschaft. Es war meine Idee, Daddys Schlafzimmer zu benutzen und nicht meines. Es schien riskanter zu sein. Wir schliefen miteinander, danach machte ich das Bett wieder. Wir duschten beide. Ich gab Lloyd einen von Daddys Morgenmänteln, dann kehrten wir ins Wohnzimmer zurück, rollten uns auf dem Sofa zusammen, sahen wieder fern. Dabei schliefen wir beide ein.
Kurz nach Mitternacht kamen Daddy und Ariel nach Hause und fanden uns dort.«
»Du machst Witze!«, rief Star.
»Wow!«, machte Jade.
Cat sah aus, als hätte sie Angst um mich.
»Daddy war natürlich wütend. Er sagte einige hässliche Sachen zu Lloyd, und ich sagte einige noch hässlichere Sachen zu ihm. Ariel unternahm einen schwachen Versuch, alles zu beschwichtigen, aber Daddys Wut richtete sich dann gegen sie, worauf sie sich rasch zurückzog. Lloyd zog sich an und ging. Daddy rief Mommy an, um ihr zu erzählen, was passiert war. Natürlich gab er ihr die Schuld.
Ich konnte nicht viel schlafen. Am nächsten Morgen brachte Daddy mich nach Hause. Mommy wartete im Wohnzimmer. Seit er mein Zimmer fotografiert hatte, war er nicht mehr im Haus gewesen und war deshalb überrascht über einige der Veränderungen, aber es war nicht der rechte Zeitpunkt, darüber zu reden. Er beschrieb, was er vorgefunden hatte, als Ariel und er in die Wohnung zurückkehrten.
›Du hast mich angelogen‹, sagte Mommy und schüttelte den Kopf, als sei das unfassbar für sie.
›Jeder in diesem Haus lügt‹, fauchte ich sie an.
›Hüte deine Zunge‹, schrie Daddy.
›Du hast mich angelogen‹, entgegnete ich. ›Du hast gesagt, du wärst nicht zu Hause und deshalb könnte ich nicht das Wochenende bei dir verbringen.‹
Er wirkte schuldbewusst, ertappt. Er warf meiner Mutter einen Blick zu und wandte sich dann wieder an mich.
›Meine Pläne haben sich geändert. Das passiert manchmal, Misty, aber das gibt dir keine Entschuldigung für das, was du getan hast‹, sagte er und kehrte dann auf das vertraute Schlachtfeld mit meiner Mutter zurück. ›Ist dir klar, wozu sie fähig ist, Gloria?‹
›Sie hat ja das perfekte Vorbild für moralisches Handeln, dem sie folgen kann‹, sagte meine Mutter und starrte ihn an. ›Schau dir doch an, wie du lebst. Schau dir an, was sie sieht, jedes Mal, wenn sie dich besucht. Was erwartest du eigentlich? Was kann ich denn da schon tun?‹
Sie stürzten sich in eines ihrer schlimmsten Wortgefechte, und ich verzog mich nach oben in mein Zimmer. Zumindest im Augenblick richteten sie ihre Gehässigkeiten gegeneinander statt auf mich. Nachdem Daddy gegangen war, kam Mommy zu mir herauf und fragte mich, was ich getan hatte und wie lange schon.
Sie tat sehr verletzt. Ich halte sie zum Narren, verletze sie, mache alles für sie noch schwieriger. Es ging immer nur um sie, sie, sie. Daddy hatte etwas früher genau das Gleiche getan und mir gesagt, dass mein Verhalten alles nur noch schwieriger machte für ihn, ihn, ihn.
Natürlich wollte Mommy wissen, wer der Junge war. Wer waren seine Eltern? Wo wohnte er? Das schien wichtiger zu sein als alles andere. Ich weigerte mich, ihr irgendetwas über Lloyd zu erzählen, und zum guten Schluss gab sie mir einen Monat Hausarrest. Ich musste jeden Tag sofort nach der Schule nach Hause kommen und auch die Wochenenden zu Hause verbringen. Außerdem verbot sie mir auch zu telefonieren, aber diesmal hatte sie zu meiner Überraschung die Telefongesellschaft angerufen und meinen Anschluss sperren lassen.
Ich glaube, noch nie im Leben habe ich mich so elend gefühlt. Lloyd gab sich die Schuld. Er meinte, er hätte es besser wissen und das erwarten müssen. Im Laufe der Woche, ich glaube am Mittwoch, fand Mommy heraus, wer mein Freund war. Clara Weincoups Mutter erzählte es ihr. Als ich nach Hause kam, erwartete meine Mutter mich bereits und kriegte einen Wutanfall wegen meines Verhaltens.
Wie konnte ich mich nur mit so jemandem herumtreiben? Besaß ich denn überhaupt keine Selbstachtung? ›Mein Freund ist vielleicht nicht reich, seine Eltern leben nicht in einem großen, teuren Haus, aber zumindest kann ich es genießen, eine Frau zu sein‹, brüllte ich sie an, und sie wurde knallrot.
Sie jagte hinter mir her und wollte wissen, was ich damit gemeint hatte. Sie hielt sich dran, bis ich schließlich wutentbrannt damit herausplatzte, was Daddy mir bei jenem ersten Mittagessen erzählt hatte, als ich ihn fragte, warum sie sich scheiden ließen. Sie wurde noch bleicher als die abgestorbenen Oleanderblätter an Dr. Marlowes Büschen draußen. Ich befürchtete schon, sie fiele in Ohnmacht. Ohne einen Laut öffnete und schloss sie den Mund. Ich bekam es richtig mit der Angst zu tun. Sie musste sich an der Rückenlehne eines Stuhls festhalten.
Dann drehte sie sich um und verließ das Zimmer. Wir sprachen nie wieder darüber, aber später fand ich heraus, dass ihr Anwalt Daddys Anwalt angerufen hatte. Es wurde damit gedroht, zum Richter zu gehen und Daddys Besuchsrecht widerrufen zu lassen.
Anscheinend wurde alles immer schlimmer. Anfang der darauf folgenden Woche geriet Lloyd in einen Streit mit einem anderen Jungen. Als Mr Levine sie zu trennen versuchte, schlug Lloyd ihn und wurde der Schule verwiesen. Ich erfuhr es später am Nachmittag. Darlene konnte es gar nicht abwarten, mir das mitzuteilen.
›Dein Freund steckt in großen Schwierigkeiten‹, platzte sie heraus und erzählte, was in der Turnhalle passiert war. Sie und die anderen freuten sich diebisch. Es schien zu beweisen, dass sie Recht hatten mit Lloyd und mir.
Aber ich sagte: ›Lloyd hatte Recht in Bezug auf euch! Ihr seid alle ein Haufen von Beverlys. Fahrt zur Hölle!‹, schrie ich sie an.
Ich rannte davon, und nach der Schule ging ich zur Wohnung von Lloyds Mutter, wo aber niemand öffnete. Ich war sehr niedergeschlagen und enttäuscht. Mein Telefon war immer noch gesperrt. Wie konnte er mich denn anrufen? Ich hoffte, dass er zu mir nach Hause kommen würde, aber an jenem Tag tat er das nicht. Ich versuchte, ihn vom Apparat meiner Mutter aus anzurufen, wenn sie gerade nicht aufpasste, aber niemand ging ans Telefon.
Ich fand es grauenhaft, am nächsten Tag zur Schule zu gehen, und verhaute prompt einen Mathetest. Ich hatte nicht einmal ins Buch hineingeschaut, um mich darauf vorzubereiten. Die Mädchen tuschelten ständig über mich. Während der Mittagspause blieb ich die ganze Zeit auf der Toilette, weil ich keine Lust hatte, mich in der Cafeteria ihren spöttischen Blicken auszusetzen. Fast hätte ich geschwänzt und Lloyd gesucht. Als endlich die Schulglocke klingelte, sauste ich aus dem Gebäude hinaus und zu seiner Wohnung. Wieder war niemand zu Hause.
Als ich nach Hause kam, war meine Mutter nicht da. Ich saß grübelnd in meinem Zimmer, als ich plötzlich ein Moped hörte und aus dem Fenster schaute. Lloyd fuhr gerade die Auffahrt herauf. Er saß auf seinem Motorrad und hupte; ich rannte hinaus.
›Wo warst du?‹, rief ich und stürzte mich in seine Arme. ›Ich bin zwei Tage hintereinander zu eurer Wohnung gegangen.‹
›Ich bin durch die Gegend gefahren‹, meinte er, ›und habe nachgedacht. Zwei Tage lang war ich bei einem Freund in Encino, und schließlich habe ich eine Entscheidung getroffen.‹ ›Welche Entscheidung?‹
›Ich verlasse Kalifornien‹, teilte er mir mit. Mich verließ der Mut.
›Wo gehst du denn hin?‹, fragte ich ihn.
›Nur weg von hier. Ich habe einen Cousin in Seattle, der eine eigene Autowerkstatt besitzt. Ich glaube, da gehe ich hin, arbeite eine Weile für ihn und sehe mal, wie’s läuft.‹
›Was ist mit deiner Mutter?‹
›Sie hat mich praktisch aus dem Haus geworfen‹, sagte er, ›als sie herausfand, dass ich von der Schule geflogen bin. Sie sagte, ich machte ihr zu viel Schwierigkeiten. Sie werde nicht mehr mit mir fertig. Es mache sie alt und krank.‹
›Das sagt meine Mutter auch über mich‹, stöhnte ich.
›Vielleicht … solltest du mitkommen‹, schlug er vor, und ich dachte, warum nicht?
›Vielleicht mache ich das‹, erwiderte ich.
Eine ganze Weile starrten wir einander nur an, und er las in meinen Augen, dass ich es wirklich tun würde.
›Pack eine kleine Tasche ein‹, sagte er. Ich zögerte nur einen Augenblick, dann rannte ich ins Haus, um meinen Rucksack zu packen.
Am schwierigsten war zu entscheiden, was ich mitnehmen sollte. Ich musste ein paar wesentliche Kleidungsstücke, ein Paar Schuhe und ein Paar Stiefel mitnehmen, aber was würdest du von all den Sachen, die du besitzt, von all den Sachen, die du geschenkt bekommen hast, auswählen, wenn du nur ganz wenige Sachen mitnehmen könntest und natürlich nichts Großes oder Schweres?
Plötzlich erschien mir nichts mehr so wichtig wie früher. All die Sachen, die meine Eltern mir geschenkt hatten, waren nur noch Gegenstände. Es gab da eine Puppe, meine erste richtige Puppe, die auf meinem Bett lag, eine weiche Stoffpuppe. Die nahm ich mit, aber keinen Schmuck. Das hätte ich wohl tun sollen. Das Geld hätten wir gebrauchen können, wenn ich ihn verkauft hätte. Ich packte meine Zahnbürste, eine Haarbürste und drehte mich dann im Kreis, um zu entscheiden, was sonst noch wichtig war.
Lloyd begann zu hupen. Ich schnappte mir die Lederjacke aus dem Schrank, warf einen letzten Blick auf mein Zimmer, das Zimmer, das so lange Zeit meines Lebens meine ganze Welt bedeutet hatte. Diese Mauern bargen all meine Geheimnisse, hatten all meine Tränen gesehen und mein angstvolles Geflüster gehört.
›Auf Wiedersehen‹, flüsterte ich und rannte die Treppe hinunter. Ich schaute mich nicht einmal um und hinterließ meiner Mutter auch keine Nachricht.
Ich trat aus dem Haus, schulterte meinen Rucksack und stieg schnell hinter Lloyd auf das Motorrad. Er wandte den Kopf, lächelte mich an und los ging’s. Mein Herz klopfte so heftig und so schnell, dass ich Angst hatte, ohnmächtig zu werden und auf die Straße zu fallen. Da schloss ich die Arme um ihn und hielt mich auf Gedeih und Verderb an ihm fest. An jenem Tag war es überwiegend wolkig und sehr stürmisch. Der Wind peitschte durch mein Haar und blies mir ins Gesicht, aber ich dachte weder ans Wetter noch an sonst etwas. Ich glaubte wirklich, ich sei frei, frei von all den Streitereien, frei von dem Hass und den Schmerzen. Ich träumte, ich würde meinen Eltern jahrelang nicht schreiben, und wenn ich es dann tat, mussten sie akzeptieren, was geschehen war und wo ich mich befand.
Ich saß nicht besonders bequem, stundenlang auf dem Rücksitz dieses kleinen Motorrades. Wir fuhren durch einen kurzen Regenschauer, und es wurde schnell kühler. Schließlich hielten wir zum Abendessen an einem Restaurant neben der Straße und zählten unser Geld. Ich hatte alles aus meiner Schublade zusammengekratzt, aber das war nicht viel.
Lloyd meinte, es sei warm genug, um zumindest die erste Nacht unweit der Straße zu verbringen. Für mich war es immer noch ein Abenteuer, daher machte es mir nichts aus, mich unter einer kleinen Brücke in seine Arme zu kuscheln. Wir machten alle möglichen Pläne und redeten uns so in den Schlaf. Vielleicht war ich eine Närrin, aber ich schlief in dem Glauben ein, dass alles möglich sei. Er würde Arbeit finden; ich würde Arbeit finden. Wir könnten uns eine kleine Wohnung leisten, und im Laufe der Zeit hätten wir genug Geld, um richtig zu leben. Endlich waren wir beide all diese Heuchler los.
›Wo wir hinfahren, gibt es keine Beverlys‹, versprach Lloyd mir, während wir uns durch unsere Fantasiewelt treiben ließen.
In der Nacht war es kälter, als wir erwartet hatten. Ständig wachte ich auf, und mir war es nicht besonders behaglich. Am nächsten Morgen sahen wir beide völlig erschöpft aus. Wir fanden ein kleines Restaurant, in dem ich mich waschen und kämmen konnte. Wir verspeisten ein warmes Frühstück, und danach ging es uns viel besser.
Lloyd machte sich Sorgen, dass wir nicht genug Geld hatten, um bis nach Seattle zu kommen. Als wir an jenem zweiten Tag aufbrachen, hatte unser Enthusiasmus stark nachgelassen. Den Kopf gegen ihn gelehnt, schlief ich immer wieder ein. Er murmelte irgendetwas, dass wir in der kommenden Nacht in einem richtigen Bett schlafen müssten. Etwa zwei Stunden später fuhr er auf den Parkplatz eines kleinen Geschäftes und bat mich, auf dem Motorrad zu warten. Ich dachte, er wollte uns nur eine Kleinigkeit zu essen holen, aber als er herauskam, rannte er. Er sprang auf das Motorrad und fuhr so schnell los, dass ich beinahe nach hinten überkippte. Als er losraste, schrie ich ihn an, warum er so schnell fuhr. Aber er antwortete nicht, sondern beschleunigte immer weiter. Ich hatte richtig Angst. Etwa eine halbe Stunde später schaute ich mich um und sah, dass ein Polizeiauto näher kam.
›Du solltest besser langsamer fahren und anhalten. Ich glaube, er ist hinter uns her‹, rief ich Lloyd zu, aber er fuhr immer schneller und versuchte den Polizeiwagen abzuhängen, indem er in einer Kurve den Highway verließ. Beinahe wären wir gestürzt, und dann musste er langsamer fahren, weil die Straße in einem Kiesweg auslief.
Ich war überrascht, als ich die Sirene hörte und sah, dass das Polizeiauto immer noch hinter uns war. Es holte uns ein und fuhr neben uns. Als der Polizist ausstieg, hatte er seine Waffe gezogen. Ich hatte solche Angst, dass ich anfing zu weinen.
Er brachte Lloyd dazu, abzusteigen und sich mit dem Gesicht nach unten hinzulegen, damit er ihm Handschellen anlegen konnte, und dann machte er mit mir das Gleiche. Danach verfrachtete er uns auf den Rücksitz seines Autos.
›Sie verhaften uns, nur weil wir zu schnell gefahren sind?‹, schrie ich ihn an.
›Nein, Madam‹, erwiderte er, ›nur weil Sie den Laden da hinten ausgeraubt haben.‹
Lloyd ließ den Kopf hängen. Ich fragte ihn, ob das stimmte. Er nickte und gab zu, dass er ein Messer gezogen und damit die verängstigte ältere Dame hinter der Theke bedroht hatte.
›Ich dachte, wenn wir nur ein bisschen mehr Geld hätten, würden wir es schaffen‹, sagte er. ›Es tut mir Leid, dass ich dich in Schwierigkeiten gebracht habe‹, entschuldigte er sich bei mir, und ich weinte den ganzen Weg zur Polizeiwache, weinte für uns beide.
Ich durfte ein Telefongespräch führen. Am schwierigsten war die Entscheidung, wen ich anrufen sollte, Daddy oder Mommy? Ich erinnere mich, wie ich mit dem Hörer in der Hand dastand und auf die Nummern starrte.
›Du hast nicht den ganzen Tag Zeit‹, ermahnte die Polizistin mich, und da rief ich Daddy an. Ich hatte Angst, Mommy würde hysterisch werden und vergessen, mir zu helfen. Er war nicht zu Hause, deshalb rief ich in seinem Büro an. Er hörte zu und sprach dann wie jemand, der aus dem Grab telefoniert. Er bat mich, ihm einen der Polizeibeamten zu geben. Ich reichte den Hörer weiter und trat beiseite.
Ich wollte nur noch sterben, bevor ich meinen Eltern wieder ins Gesicht sehen musste.«