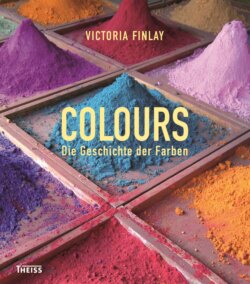Читать книгу Colours - Victoria Finlay - Страница 7
Mangan SCHWARZ KUNST IN DER EISZEIT
ОглавлениеAn einem Donnerstag im September 1940, mitten im Zweiten Weltkrieg, brachen vier Jungen und ein Hund namens Robot zu einer Entdeckungsreise auf. Es waren unruhige Zeiten: Die Deutschen waren in jenem Sommer nach Frankreich vorgedrungen und standen nur wenige Kilometer nördlich des südwestfranzösischen Dorfes, aus dem die Jungen kamen. Der Älteste aus der Gruppe, der 18-jährige Marcel Ravidat, kannte Geschichten von uralten Gängen unter den nahe gelegenen Wäldern und wollte deshalb den Eingang zu einem Erdloch erkunden, das Robot zwischen den Wurzeln eines umgestürzten Baums entdeckt hatte. Seine drei Begleiter waren der 14-jährige Jacques Marsal, der 15-jährige Georges Agnel und Simon Coencas, ein 13-jähriger jüdischer Flüchtling aus Paris.
Marcel hatte einen Spaten und einige Lampen mitgebracht. Nachdem die Jungen die Öffnung vergrößert hatten, rutschten sie durch einen langen Schacht etwa zwölf „schreckliche“ Meter in die Tiefe hinab. Unten angekommen, entdeckten sie – beinahe wie Alice im Wunderland – eine surreale, unterirdische Welt, in der nichts ganz so war, wie es schien.
Die Jungen fanden sich in einer riesigen Kalksteinhöhle wieder, in der unzählige Stalaktiten von der Decke herabhingen und Stalagmiten vom Boden aufragten. Marcel hielt eine der Petroleumlampen hoch, und im flackernden Licht erkannten sie riesenhafte Tieraugen, die ihnen von den Wänden ringsherum entgegenstarrten. Da waren Pferde und Hirsche, Bisons und sogar ein Bär. Und in der Mitte, an der Decke hoch über ihren Köpfen, thronte ein gewaltiger, über fünf Meter langer Stier. Die Malereien muteten so realistisch an, dass sie fast zu atmen schienen. Die Rücken und Flanken der Tiere waren in kräftigen Rot- und Gelbtönen gemalt und mit dicken schwarzen Linien umrahmt. Die vier Jungen waren die ersten Menschen, die diese Malereien seit ihrer Entstehung am Ende der Eiszeit, vor etwa 17.000 Jahren, erblickten. Wie sich später herausstellte, sollten sie zu den wenigen Menschen gehören, die sie jemals mit vollständig erhaltenen, leuchtenden Farben sahen.
Höhlenmalerei von Lascaux, Frankreich, jüngere Altsteinzeit
Marcel, Jacques und Robot, Frankreich, um 1940
Rot. Gelb. Schwarz. Weiß. Braun. Das waren die Farben der ersten bekannten künstlerischen Darstellungen auf dieser Erde. Sehr erstaunlich scheint dies nicht zu sein, handelt es sich doch um Farben, die leicht in der Natur zu finden sind. Roter und gelber Ocker kommen natürlicherweise in eisenhaltigem Boden vor. Schwarz erhält man durch das Verbrennen eines Zweigs zu Holzkohle oder aus den Rußrückständen eines Feuers. Weiß lässt sich aus Kalkstein oder Kreide gewinnen. Und Braun ist die Farbe von Erde und Schlamm. Wenn man diese Materialien zu Pulver zerreibt und mit tierischem Fett oder einem anderen Bindemittel vermischt, damit sie haften bleiben, dann können sie bei den richtigen Witterungsverhältnissen jahrtausendelang auf Kalksteinwänden überdauern. Das ist allerdings noch nicht die ganze Geschichte der Farben in der Höhle, die von den Jungen entdeckt wurde – und die wir heute als die „Höhle von Lascaux“ kennen.
In den 2000er Jahren nahmen französische Wissenschaftler eine winzige Probe von der Nase des großen Stiers. Sie fanden heraus, dass das Schwarz nicht nur aus Ruß oder Holzkohle bestand. Es enthielt auch ein seltenes Manganoxid, Hausmannit, welches durch die Erhitzung von stark manganhaltigem Gestein künstlich hergestellt werden kann. Das Verfahren erfordert jedoch eine Temperatur von ungefähr 900 Grad Celsius, und es ist schwer vorstellbar, dass die steinzeitlichen Menschen in ihren offenen Feuerstellen so hohe Temperaturen erzeugt haben könnten. Vielleicht hat es ein lokales Vorkommen gegeben, von dem wir heute nichts mehr wissen. Es ist aber ebenso möglich, dass der Hausmannit aus den etwa 240 Kilometer entfernten Pyrenäen stammte.
Die Höhle von Altamira
In Europa wurden Höhlenmalereien erstmals in der Nähe der spanischen Ortschaft Santillana del Mar entdeckt. Im Jahr 1879 erkundete der spanische Grundbesitzer Don Marcelino Sanz de Sautuola hier mit seiner kleinen Tochter Maria eine Höhle. Während er einige steinzeitliche Werkzeuge untersuchte, die wenige Jahre zuvor entdeckt worden waren, spielte seine Tochter auf dem Höhlenboden. Plötzlich rief das kleine Mädchen ganz aufgeregt: „Papa, schau mal, da sind Stiere!“ Und tatsächlich: An der Wand über ihren Köpfen, in Rot, Gelb, Schwarz und Weiß gemalt, tobten ganze Herden von Wisenten vorüber. Seine Zeitgenossen beschuldigten Sanz de Sautuola zunächst der Fälschung, weil sie nicht glauben konnten, dass die Menschen in der Steinzeit solche Kunstwerke geschaffen hatten. Aber sie irrten sich.
Darstellung eines ausgestorbenen Steppenbisons in der Höhle von Altamira, Spanien, jüngere Altsteinzeit
Cueva de las Manos, Patagonien, um 11.000–7000 v. Chr.
An einem abgelegenen Ort in den Bergen Patagoniens, weit im Süden von Argentinien, liegt die Cueva de las Manos („Höhle der Hände“), an deren Wänden eine erstaunliche Sammlung von Handabdrücken zu sehen ist. Es handelt sich größtenteils um die Abdrücke linker Hände, was darauf schließen lässt, dass die Künstler, die ihre Blasrohre hielten, vorwiegend Rechtshänder waren.
Offensichtlich wissen wir nicht genau, wie der Hausmannit zur Höhle von Lascaux gelangt ist. Vielleicht wurde er von Händlern mitgebracht, oder der Stamm schickte junge Männer aus, um ihn herbeizuschaffen; möglicherweise kamen auch die Schöpfer dieser Höhlenmalereien, auf ihrem Weg zu einem anderen Ort, von jenseits der Pyrenäen. Jedenfalls könnte es sein, dass manche Farben vor 17.000 Jahren sehr wertvoll waren und es sich lohnte, sie über eine weite Strecke zu transportieren.
Aus der Höhle von Lascaux erfahren wir allerdings noch etwas anderes. So waren zum Beispiel Hilfsmittel oder Werkzeuge nötig, um die verschiedenen Effekte in den Malereien zu erzeugen. Die Farbe des großen Stiers wurde aufgetragen, indem man zermahlene Minerale mit einer Flüssigkeit vermischte und die Farbe dann mit dem Mund aufsprühte – entweder direkt oder durch ein Blasrohr. Es schmeckte wahrscheinlich fürchterlich, aber auf diese Idee kamen in der Steinzeit viele Menschen überall auf der Welt. In anderen Höhlen kann man ähnliche Techniken erkennen, und zwar nicht nur in Europa, sondern ebenso in Australien (in 40.000 Jahre alten Malereien), in der Kalaharisteppe in Afrika, in den patagonischen Bergen in Argentinien oder in Baja California in Mexiko. An einigen dieser Orte kann man sehen, wie die Künstler mit unterschiedlichen Effekten experimentierten und sich die Farbe auch über ihre Hände sprühten, um Handabdrücke zu erzeugen. Andere Farben in Lascaux wurden auf vorhersehbarere Weise aufgetragen – mit den Fingern oder mit Pinseln, die vermutlich aus dem Haar von Rotwild angefertigt worden waren. Manche Konturen zeichnete man jedoch mit Ruß, der mit wachsartigem Lehm vermischt wurde, was darauf schließen lässt, dass die Menschen selbst vor so langer Zeit bereits Farbstifte hergestellt und verwendet haben.
Aber welchem Zweck dienten diese erstaunlichen Gemälde? Und wie konnten ihre Schöpfer in der riesigen Höhle so hoch hinaufgelangen? Waren die Künstler Jäger, die ihre Abenteuer darstellten? Oder Priester, die von den Göttern ein günstiges Schicksal erbaten? Vielleicht wurden die Tiere von professionellen Künstlern gemalt, die von Höhle zu Höhle zogen, wie es später im Mittelalter die reisenden Handwerker beim Bau der großen Kathedralen taten. Womöglich stammten die Malereien auch von gelangweilten Eiszeit-Teenagern, die während des langen Winters nach einem Zeitvertreib suchten. Wir werden es wohl nie erfahren.
Pigmente und Farbstoffe
Das Wort „Pigment“ leitet sich von dem lateinischen pingere („malen“) her. Vielleicht sollte es deshalb eher „Pingment“ lauten. In der Kunst werden damit die farbigen Pulver bezeichnet, die mit einem Bindemittel wie Leim, Öl, Ei oder Acryl vermischt werden können, um Malfarben herzustellen. Pigmente bestehen gewöhnlich aus Mineralien, obwohl sie – wie wir noch sehen werden – auch aus Insekten, Knochen und anderen Materialien erzeugt werden können. Das Wesentliche an den Pigmenten ist, dass sie sich im Bindemittel nicht auflösen, sondern frei darin schweben. Farbstoffe sind dünner und lösen sich auf. Sie werden hauptsächlich zum Färben von Stoffen verwendet und müssen normalerweise auf dem Stoff „fixiert“ werden, damit sich die Farbe nicht auswäscht. Die Substanz, die dazu eingesetzt wird, heißt Mordant (Beize) – aus dem lateinischen Wort für „beißen“, weil sich die Farbe durch das Mittel an den Fasern „festbeißt“ und sie hoffentlich nicht mehr loslässt. Beizen enthalten Metalle, Urin oder Alaun, und wie man gelegentlich hört, soll auch Rauch in engen Räumen eine solche Wirkung haben. Farbstoffe können nicht aus Pigmenten erzeugt werden, wohl aber Pigmente aus Farbstoffen, indem man sie mit einem Beizmittel auf einem weißen Trägermaterial fixiert, wie etwa Ton, Knochenmehl oder Salz. Aus Farbstoffen hergestellte Farben werden als Farblacke bezeichnet.
Was wir allerdings wissen, ist, dass die Höhle beleuchtet war, als die Tiere gemalt wurden – in der Dunkelheit konnten die Bilder nicht entstanden sein. Ebenso gab es Licht, wann immer jemand kam, um sie zu betrachten. Und schaut man sich die Tiere ganz aus der Nähe an, so kann man sehen, dass die Künstler oder Künstlerinnen vor 17.000 Jahren, indem sie bestimmte Farbtöne auswählten und die Schattierung, die Dicke und den Auftrag der Farben variierten, den Eindruck erzeugten, als würde sich das Sonnenlicht auf dem Rücken von lebendigen Wesen widerspiegeln. Wie viele Künstler nach ihnen setzten sie Farbe ein, um Dinge mit Licht und Leben zu erfüllen, die zuvor nur in ihrer Erinnerung oder Vorstellung existierten.
Zuerst wollten die Jungen die Höhle geheim halten und niemandem davon erzählen, nicht zuletzt deshalb, weil sich feindliche Soldaten in der Nähe befanden. Doch nach wenigen Tagen strömten bereits die Besucher herbei (Marcel stand am Eingang und verlangte 40 Centimes für eine Besichtigung). In der ersten Zeit rutschte man auf einem Stück Holz oder, wie es der Fotograf des Life-Magazins Ralph Morse später beschrieb, „mit dem Hosenboden auf der blanken Erde“ hinab. Auch der weltberühmte Experte für prähistorische Kunst Abbé Henri Breuil, der sich zufällig in einer nahe gelegenen Stadt aufhielt, eilte sofort herbei, als er davon hörte. Und nachdem er die Höhle mit Taschenlampe und Lupe untersucht hatte, bestätigte er nicht nur die Echtheit der Felsmalereien, sondern erklärte zudem, dass es sich dabei wahrscheinlich um die größten bisher entdeckten prähistorischen Kunstwerke überhaupt handelte.
Simon kehrte ein paar Tage später nach Paris zurück und kam in ein Internierungslager. Weil er noch nicht 16 Jahre alt war, wurde er jedoch wieder freigelassen, und es gelang ihm, sich während des gesamten Kriegs versteckt zu halten. (Im Jahr 2014, als dieses Buch entstand, war er als Einziger der Gruppe noch am Leben.) Auch Georges kehrte kurz darauf nach Hause zurück, um wieder in die Schule zu gehen. Jacques wurde 1942 festgenommen und als Zwangsarbeiter nach Deutschland geschickt. Marcel schloss sich dem französischen Widerstand, der Résistance, an und versteckte sich in Höhlen nahe jener, die er mit den anderen Jungen entdeckt hatte. Nach dem Krieg wurden er und Jacques zu offiziellen Führern von Lascaux und erzählten immer wieder die Geschichte, wie es gewesen war, durch das Erdloch zu klettern und den großen Stier zum allerersten Mal zu erblicken.
1948 öffnete der Grundbesitzer, dem das Land über der Höhle gehörte, einen Durchgang, und bald darauf strömten täglich über 1000 Besucher in die Höhle von Lascaux, fast 400.000 Menschen in einem Jahr. Ihr Atem und die warme Luft, die nun in die kalte Höhle gelangte, überzogen die Wände mit einer tauartigen Feuchtigkeit. Dadurch und aufgrund der neuen elektrischen Beleuchtung begannen die kräftigen Farben zu verblassen. In nur 20 Jahren wurden die Malereien, die in der Dunkelheit so viele Jahrtausende überstanden hatten, nahezu unsichtbar.
Und dies ist ein weiterer charakteristischer Punkt in der Geschichte der Farben in der Kunst: Erst sind sie da, und dann verschwinden sie. Sie bleiben nicht gleich – und jedes Mal, wenn man ein Gemälde betrachtet, dann verändert man es auch ein ganz klein wenig.