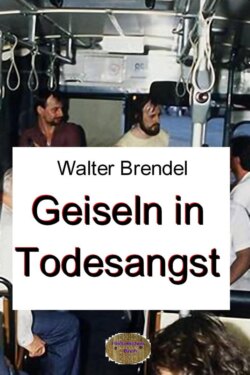Читать книгу Geiseln in Todesangst - Walter Brendel - Страница 6
Banküberfall und erste Geiselnahme 16.08.1988
ОглавлениеUm 07:55 Uhr verschafften sich Degowski und Rösner vor Schalteröffnung Zugang zu einer Filiale der Deutschen Bank im Gladbecker Stadtteil Rentfort-Nord. Die Bank befand sich im hinteren Zugang des Atriums des Geschäftszentrums Rentfort-Nord an der Schwechater Straße 38. Auf der Gebäuderückseite befanden sich hoch gelegene, vergitterte Oberlichter, die zu einem um den gesamten Gebäudekomplex verlaufenden breiten Versorgungsweg führten. Das Atrium konnte durch zwei weitere überdachte Zugänge erreicht werden, von denen einer auf der gegenüberliegenden Seite des Atriums lag. Ladenlokal befanden sich Links der Bank. Die Beobachtung für Degowski und Rösner aus der Bank heraus, um mögliche Fluchtwege zu beobachten, wurde schwierig. Lediglich einen Teileinblick ins Atrium sowie die Sicht auf die zwei überdachten Zugänge zum Atrium waren noch möglich. Der aus der Bank heraus gesehen rechte Zugang führte zu Straße, der linke Zugang auf einen für den öffentlichen Verkehr gesperrten Versorgungsweg.
Um 08:04 Uhr klingelte das Notruftelefon der Polizei. An Apparat ein Arzt, dessen Praxis sich im ersten Obergeschoss des Gebäudes befand. Er hatte die Täter beim Eindringen beobachtet. Die ersten eintreffenden Beamten parkten ihren Streifenwagen direkt vor dem zur Straße liegenden Zugang!
Damit war für das Gangsterduo klar, dass ihr Plan, die Bank um das verwahrte Geld zu erleichtern, schiefgegangen ist.
Die Gewohnheitsverbrecher nahmen sich zwei Bankangestellte als Geiseln und verschanzten sich im Kassenbereich.
In Sichtweite der Bank wurde der Krisenstab der Polizei eingerichtet. Bewohner aus den umliegenden Häusern wurden in Sicherheit gebracht.
8.30 Uhr traf der Innenminister von NRW, Herbert Schnoor, aus seiner Wohnung kommend im Bürokomplex in der Düsseldorfer Haroldstraße ein. Auf dem Weg zu seinem Büros hörte er beiläufig die „Wichtige-Ereignis-Meldung“ an, die ihm, gegen neun Uhr, der Leiter der Polizeiabteilung vorträgt: „Banküberfall mit Geiselnahme in Gladbeck. Zwei bewaffnete Täter haben zwei Angestellte der Deutschen Bank in ihrer Gewalt; Forderung: 300 000 Mark Lösegeld, Fluchtfahrzeug, freier Abzug; Sondereinheiten sind angefordert“. Für Schnoor kein Grund zur Be-unruhigung. Bisher wurden solche Fälle immer schnell gelöst.
Gerade hatte der Minister wieder Kriminalstatistik vorgestellt und betonte mit Genugtuung wie erfolgreich seine Einsatzkräfte dieses Delikt der Geiselnahme bekämpften: „Geiselnehmer haben bei uns im Land keine Chance.“
Doch der markige Spruch täuscht. Der sich seit 1980 im Amt befindliche Herbert Schnoor ist kein rigider Verfechter von Law und Order. Der aus Ostfriesland stammende gelernte Verwaltungsjurist ist ein liberaler Innenminister. Der damalige NRW-Ministerpräsident und späterer Bundespräsident Johannes Rau rühmt seinen Innenminister gern als Garanten sozialdemokratischer Rechts- und Sicherheitspolitik.
Noch konnte Schnoor nicht ahnen, dass ihn jener Dienstag im August 1988 fast den Posten gekostet hat.
Zunächst nimmt er beruhigt zur Kenntnis, dass sein langjähriger Mitarbeiter, der 47-jährige Friedhelm Meise, seines Zeichens Leitender Kriminaldirektor, vom Polizeipräsidium Recklinghausen den Einsatz leitet. Schnoor weiß, dass „Meise in der Polizei einen guten Ruf hat“.
Meise hat sich seine Verdienste vor allem am Schreibtisch erworben. Vor seinen Aufstieg 1987 zum Kripochef in Recklinghausen bearbeitete der Verwaltungsfachmann Akten im Referat Kriminalpolizei des Düsseldorfer Innenministeriums.
Noch davor saß er acht Jahre lang im Landeskriminalamt, war Dezernent für Organisierte Kriminalität. Praktische Erfahrungen im Umgang mit Kapitalverbrechern sammelt Meise nach dem Geiseldrama als Mitglied einer Beratergruppe. Verantwortlicher Krisenmanager vor Ort war für ihn Neuland.
Die Nachfrage im Düsseldorfer Untersuchungsausschuss, ob er vor Gladbeck Erfahrungen als Einsatzleiter hatte, muss er acht Monate nach den Ereignissen mit „Nein“ beantworten.
In Gladbeck ist eine Lage entstanden, wo selbst erfahrene Einsatzleiter überfordert wären. „Neuling“ Meise stellt fest: In der Bank die immer gereizter reagierenden Täter Hans-Jürgen Rösner und Dieter Degowski, in deren Gewalt die von panischer Angst erfassten Bankangestellten Reinhold Alles und Andrea Blecker sind; draußen über 300 Polizisten, darunter Spezialkommandos aus ganz Nordrhein-Westfalen.
Diese treffen am Tatort mehr oder weniger schlecht orientiert ein und versuchen, sehr mangelhaft koordiniert, die Arbeit aufnehmen.
Das Einsatzprotokoll vermerkt, dass um 10.10 Uhr in der Einsatzzentrale, im Polizeiamt am Gladbecker Jovyplatz, Meise seine ersten Anordnungen trifft: Absperrungen verstärken, provozierende Aktionen vermeiden, Telefongespräche abhören, präpariertes Fluchtfahrzeug bereitstellen, Notzugriff vorbereiten.
In der Bank spürt Degowski, dass er und sein Kumpel Rösner in der Falle sitzen. Von einer Stehleiter und vom Dach der Kassenbox erspähen sie durch das Oberlicht stahlhelmbewehrte Männer eines Spezialeinsatzkommandos (SEK), die mit Maschinenpistolen in Stellung liegen. Anders als in der Anfangsphase, in der Rösner auf einen Zivilbeamten feuert, zwingt er sich diesmal zur Beherrschung. Obwohl er einen SEK-Mann direkt im Visier hat („Ich hätte jetzt schon so auf den Mann schießen können“), drückt er nicht ab.
Übermächtiger innerer Druck lastet auf Rösner und Degowski. Nur durch wildes Herumballern in der Bank können sie sich davon befreien; sie schießen um sich wie volltrunkene Cowboys. Komischerweise funktioniert das Telefon. Die Telefonnummer 02043/24092, unter der die Zweigstelle der Deutschen Bank in Rentfort-Nord erreichbar ist, wird zum Geheimtipp für Journalisten aus der ganzen Republik. Reporter und Zeitungen rufen an, darunter auch Vertreter des WDR. Rösner fühlt sich nicht ernst genommen. Er feuert mit seinen „Colt Government“-Pistole (Kaliber neun Millimeter Luger) in die Decke. Degowski, dem ebenfalls die Nerven durchgehen, jagt mit seinem Trommelrevolver „Highway Patrolman“ eine Kugel in das Lamellendach des Kassenraums.
Andrea Blecker verkriecht sich in der Kassenbox, schreit, dass sie „das Knallen nicht mehr ertragen“ kann.
Sie ist der Hysterie nah. „Mach den Mund auf, wenn's kracht, dann ist es nicht so schlimm“, empfiehlt Rösner.
Der aus Essen angereiste Staatsanwalt Hans-Christian Gutjahr will Rösner und Degowski mit einer nicht unproblematischen Zusage ködern, um die Geiseln zu erlösen. Ein sehr ungewöhnlicher Plan.
Am Telefon wird den Tätern „ein optimales, großzügiges Angebot“ durch den 41-jährige Polizeioberrat Horst Tiemann, der sich als Gutjahr ausgibt, unterbreitet. Wenn sie bedingungslos kapitulieren und ihre Geiseln innerhalb einer Stunde freilassen, werde die Staatsanwaltschaft vor Gericht nur sechs Monate Freiheitsstrafe beantragen. Andernfalls droht Tiemann alias Gutjahr, ihnen „die ganze Härte des Gesetzes zukommen zu lassen“.
Dieses Angebot ist ungewöhnlich aber juristisch zulässig.
Das Strafgesetzbuch sieht vor, dass ein Geiselnehmer, der „das Opfer unter Verzicht auf die erstrebte Leistung in dessen Lebenskreis zurückgelangen lässt“, mit einer Mindeststrafe von sechs Monaten davonkommen kann. Das wird jedoch nicht so von der Öffentlichkeit geteilt, denn die missverständliche Wortwahl in Interview lässt den Schluss zu, dass der Staatsanwalt den Gladbecker Geiselnehmern ein Sonderrecht einräumen will. Es hagelt öffentlich Kritik.
Trotz seines mangelnden Intellekts verfügt Rösner über eine Art „Bauernschläue.“ Auch die jahrelange „Knasterfahrung“ verbietet ein Aufgeben, selbst zu Sonderkonditionen.
Zum einen misstraut er dem staatsanwaltlichen Ehrenwort: „Ich kenn die gesamte Justiz und die Polizei.“
Und zum anderem weiß er, dass er ohnehin noch eine Reststrafe von 437 Tagen zu verbüßen hat und selbst, wenn ein Gericht Milde walten lässt, für lange Zeit wieder hinter Gitter muss. : „Lieber geh ich kaputt, bevor ich noch mal in die Kiste geh.“, so Rösner.
Und sich einschüchtern lässt Rösner schon gar nicht. „Der Hund mit seiner Härte, soll er doch mal die Härte machen“, bemerkt er zu der Polizei.: „Dann, eh, is hier alles zu Ende, für uns alle vier. Entweder kommen wir weg oder wir gehen kaputt.“
Rösner mimt den starken Mann, auch mit der Angst im Nacken, „Bedrohen lassen wir uns grundsätzlich nicht. Wenn einer bedroht, ne, dann sind wir das . . . Wir haben die Waffengewalt hier, und wir bestimmen über Leben und Tod.“
Nun, nachdem die Bemühungen um ein schnelles Ende gescheitert sind, setzt der beispiellose Rummel der Medien ein, der die Geiselnahme von Gladbeck zur öffentlichsten Gewalttat in der Kriminalgeschichte der Bundesrepublik macht.
Das Telefon in der Bank steht nicht mehr still. Die Polizei hat die Leitung nicht gekappt, weil sie hofft, dass sich über Telefon eventuell Komplizen melden. „Mein Gott, man kann Sie einfach anrufen, das ist unglaublich“, staunt ein Redakteur des „Hamburger Abendblatts“, als tatsächlich die Geisel Reinhold Alles den Hörer abnimmt.
Aus Stuttgart klingelt „Radio Media“ wegen eines Exklusiv-Interviews mit den Geiselnehmern an. Aus Würzburg meldet sich „Radio Gong“ und will mit den Opfern sprechen. Aus West-Berlin hakt der Privatsender „Radio 100,6“ nach. Mehrfach erkundigen sich Redakteure detailliert nach den Täterforderungen.
Hier wird bereits der Boden für das Presse geile Auftreten vorbereitet. Man gibt Rösner und Degowski Gelegenheit, Drohungen gegen die Polizei auszustoßen.
Rösner nutzt die Informationssucht, um Druck auf die Einsatzkräfte auszuüben. Um seine hochgradige Gefährlichkeit unter Beweis zu stellen, schwadroniert Rösner etwa gegenüber dem damaligen Chefreporter der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“, Hans-Jürgen Pöschke, im dicksten Kohlenpott-Platt: „Wir haben zwei dicke Pusten im Moment in der Hand und wenn da irgendwat unternommen wird, wat mich in Gefahr bringt und meinen Kumpel, dann is vorbei, ne, dann klink ich aus, dann gibt dann oben ein Peng inne Birne, und dann wern wir wohl alle sterben.“
Die Journalisten verlassen im Übereifer die Distanz des Beobachters, sie dienen sich den Tätern als Handlanger an, werden damit selber zu Tätern. Die Grenze, zwischen Informieren und Agieren wird fahrlässig, wenn nicht gar vorsätzlich überschritten. Hier in diesen Mittagsstunden beginnt jener journalistische Aktivismus, der darin gipfeln wird, dass sensationsgierige Reporter bei Verfolgungsjagden von den Geiselnehmern beschossen werden oder gar zu den Gangstern ins Fluchtauto steigen, weil sie ihre Story exklusiv haben wollen, sowie es in der Sendung bei Maischberger am 7. März 2018 demonstriert wurde.
Die neuen Privatsender wollen gleich am Anfang richtig mitmischen. Als erster offeriert ein forscher Mitarbeiter des Fernsehsenders RTL plus („Was kann ich für Sie tun?“) seine Hilfe. Er merkt nicht, dass er weder Rösner noch Degowski am Telefon hat, sondern den Bankkassierer Reinhold Alles.
Er verhandelt über Lösegeld und Fluchtwagen („Okay, und dann lasst ihr die Geiseln auch frei?“), bis er seinen Irrtum bemerkt. In demutsvollen Ton fragt ein Mitarbeiter des Deutschen Fernsehens bei Rösner an, ob er „Ihnen ja irgendwie vielleicht auch helfen“ könne, und bietet gleichzeitig die Veröffentlichung eines Aufrufs der Geiselnehmer an.
In diesen Mittagsstunden weiß die Einsatzleitung, die alle diese Gespräche mithört, noch nicht, wer die Täter sind.
Doch den dümmsten Beamten wird klar, dass die Geiselnehmer um jeden Preis zum Durchhalten entschlossen sind.
Das erste Stockwerk des Polizeiamts Gladbeck wird eilig zur Führungszentrale umgerüstet. Es herrscht Alarmstimmung. Klingelnde Telefonen und piepsende Funkgeräten sorgen für die nötige Akustik. Dutzende von „Experten“ verschiedener Spezialkommandos bereiten den Sturm auf die Bank vor. Sie kämpfen sich durch Bauzeichnungen und Lageskizzen suchen Zugriffsmöglichkeiten im oder am Bankgebäude. Vor Ort wird versucht, mit Spezialgeräten das Geschehen im Innern des Gebäudes zu beobachten und die Gespräche zu belauschen.
Sie bugsieren vom Keller der Bank aus ein Mikrofon durch die Rohre der Klimaanlage in den Kassenraum zu schieben, verstehen aber nur Wortfetzen. Aus ihrer Deckung heraus versuchen sie mittels eines Fibriskop, ein biegsames Guckrohr, in den Schalterraum zu blicken.
Vom Frontalangriff bis zum Überraschungscoup werden die unterschiedlichsten Eingreifvarianten erwogen.
Da könnte man mit einem Panzerwagen durch die Glas-front in den Kassenraum vorzuwalzen oder mit Schrotpatronen die Scheiben zu zerschießen und in die Bank zu hechten.
Sprengsätze werden durch die Feuerwerker des Spezialeinsatzkommandos herbei geschafft. Es ging hier nicht darum, die Bank in die Luft zu sprengen, sondern nur einen Horror-Lärm zu produzieren Das soll die Täter so schocken, dass die geschulten Nahkämpfer bei gleichzeitigen Angriff überrumpeln können, ohne auf Wieder stand zu stoßen. Mehrere solcher Sandkastenspiele wurden in Erwägung gezogen. Doch die Praxis sah zu dieser Zeit anders aus.
Auf den angrenzenden Dächern und Balkons postierten sich Scharfschützen, um in die Bank hineinschießen zu können. Mitglieder einer Verhandlungskommission versuchten über Telefon, Rösner und Degowski mit psychologischen Mitteln auszutricksen.
Eine in Dortmund stationierte Spezialeinheit wurde angefordert. Diese besteht aus einem halben Dutzend psychologisch geschulter Polizeibeamten. Diese werden immer dann zurate gezogen, wenn es notwendig ist, solche Situationen zu beenden. Durch geschickten, einfühlsame Fragen gilt es herausfinden, ob es sich bei dem jeweiligen Täter um einen gefährlichen Gewaltverbrecher oder um einen Aufschneider handelt. Dann natürlich, den oder die Täter zum Aufgeben zu überreden.
Polizeioberrat Tiemann, der Leiter der Gruppe mimt den Staatsanwalt. Die Verbindung zu den Tätern soll der Kriminalhauptkommissar Manfred Doerks, herstellen. Er wird in den nächsten Stunden der alleinige Ansprechpartner für Täter und Geiseln. Über Lautsprecher werden die Gespräche mitgehört und Kollegen schieben ihm während der Telefonate Zettel mit Stichworten und Verhandlungstipps zu.
Die Einsatzleitung hat Doerks beauftragt, Unverein-bares zu vereinbaren. Er soll das Vertrauen der Täter gewinnen, sie aber zugleich aushorchen und beschwindeln; er soll so beruhigend auf die Täter einreden, dass sie ihre Geiseln nicht erschießen, zugleich aber Rösner und Degowski derart verunsichern, dass sie womöglich doch noch aufgeben; er soll die schnelle Erfüllung ihrer Forderungen vortäuschen, zugleich jedoch mit hinhaltenden Nachfragen Zeit gewinnen.
Die Sache war zum Scheitern verurteilt, denn die Täter durchschauten sofort das Doppelspiel (Rösner: „Ich hör das ganz genau raus, dass du mir einen in die Tasche labern willst“), so verkommt der Dialog zeitweise zum bloßen Ritual. Unnachgiebig beharren die Geiselnehmer auf ihren Forderungen, und ebenso hartnäckig versucht Doerks, sie immer wieder umzukrempeln. „Ich bin 'n Verbrecher - du bist 'n Bulle“, stellt Rösner die Fronten klar. „Ich hab Bulle gelernt und du hast Klauen gelernt“, pflichtet Doerks dieser groben Vereinfachung bei.
Um sich als Kumpel anzudienen, verfällt der Hauptkommissar in den Gossenjargon der Ganoven. Als hätte er mit ihnen schon in einer Zelle gesessen, spricht er mit Rösner und Degowski über „Muffe“ (Angst) und „Blagen“ (Kinder), „Brocken“ (Geld), „linken“ (reinlegen) und „abknipsen“ (erschießen).
In einem vertraulichen Polizeipapier (lag dem Untersuchungsausschuss vor) wird später, bei einer Analyse der Tonbandprotokolle, kritisiert, dass die Verhandlungsgruppe zu einseitig darauf hingearbeitet habe, einen „guten Kontakt zum Täter herzustellen“. Bei künftigen Telefonaten mit Verbrechern dürfe die Strategie nicht nur auf „Verzögerung, Anpassung und Nachgiebigkeit“ beschränkt bleiben, sondern müsse „als gleichwertiges Element die Erzeugung von Druck beinhalten“.
Doch davon ist in Gladbeck nichts zu spüren. Bis zur Selbstverleugnung biedert Doerks sich an. „Ich bin 'n norddeutscher Typ“, versucht er sich als gradlinig und verlässlich darzustellen, „du kannst mit mir reden wie mit 'nem Doofen, ich bin 'n Kumpel aus'm Leben.“
Doch Rösner erfasst instinktiv, dass alles nur Masche ist. Als Doerks, wie zufällig, ihn zum wiederholten Male mit „dem Ding vom Staatsanwalt“ nervt, dem Angebot, gegen eine milde Strafe von sechs Monaten aufzugeben, höhnt der Bankräuber nur: „Schön so, psychologisch reden, ne.“
Es wirkt komisch und plump zugleich, wie der Kriminalhauptkommissar sein psychologisches Training verniedlicht:
„Ach, hör mal, ich bin doch gar nicht geschult, ehrlich nicht, du“, versucht sich Doerks rauszustottern, „ich hab sicher wohl - da - so'nen, so'nen Kommissar-Lehrgang gemacht - dat freut mich, weil ich mehr Moos kriege, verstehst. Nur ich bin doch nicht so ein unheimlicher Psychologe, das musst nicht meinen, du.“
Wir stellen also fest, dass zu diesem Zeitpunkt den Verbrechern Rösner und Degowski weder mit Worten, noch mit Waffen beizukommen ist.
Wie und wo die Spezialkommandos auch immer einen Angriff erwägen - es ist, so der Düsseldorfer Kriminaloberrat Dieter Höhbusch, „praktisch kein Durchkommen“.
Von vorn können Angreifer durch die breite Fensterfront aus Sicherheitsglas gesehen werden, hinten müssten sie sich durch schmale Oberlichter zwängen; links grenzt der Schalterraum ans Nachbarhaus, durch die Fenster rechts würden Nahkämpfer im Frühstücksraum landen.
Und alle Angriffspläne haben den gleichen entscheidenden Nachteil: In jedem Fall würde das Eindringen in die Bank länger als fünf, sechs Sekunden dauern - es bliebe allemal Zeit genug für die Täter, die Geiseln zu erschießen. Mit hängenden Schultern meldet ein Sonderkommando-Führer seinem Einsatzleiter Meise: „Keine Chance, null.“
In ihrer Hilflosigkeit prüfen die Spezialisten am Tatort, wie eine Woche später Polizeiführer Heinz Hermey in einer nicht öffentlichen Ausschusssitzung des nordrhein-westfälischen Landtags preisgibt, „ob die Möglichkeit bestanden hätte, hier im Objekt selbst einen finalen Rettungsschuss anzuwenden“.
Im Klartext: Rösner und Degowski hinterrücks zu erschießen.
Dieser Entschluss musste nicht im Düsseldorfer Innenministerium bestätigt werden, denn er hatte nicht die geringste Erfolgsaussicht. Weil Lamellen den Einblick in die Bank verhindern, haben Scharfschützen ohnehin keine Chance.
„Bloß keinen Sturm“, bekniet der 56jährige Gladbecker Bankdirektor Wolfgang Schöning die Einsatzleitung.
Der hochgewachsene, leicht distinguiert wirkende Banker sorgt sich um seine Angestellten, die er seit Jahren schätzt.
Andrea Blecker, zur Tatzeit 24 Jahre, hat er selber als Lehrling eingestellt. Seinen Mitarbeiter Reinhold Alles, 35 Jahre alt, schätzt der Direktor seit sieben Jahren als „zuverlässigen Kassierer“, weiß auch, dass dessen Frau im dritten Monat schwanger ist.
Um seinen Teil dazu beizutragen, dass den Geiseln nichts passiert, kümmert sich der Direktor persönlich um die Bereitstellung des Lösegeldes. Innerhalb weniger Stunden organisiert er, dass 300 000 Mark, wie gewünscht in kleinen Scheinen, aus der Düsseldorfer Landeszentralbank ins Gladbecker Polizeiamt transportiert werden, wo das Geld präpariert wird.
Den Tätern gegenüber täuscht die Polizei jedoch vor, die Geldbeschaffung bereite Schwierigkeiten.
Doch auch hier ging etwas schief. Ohne es zu wollen, durchkreuzt Schöning, der nach der Geldübergabe an die Polizei wieder die Einsatzleitung verlassen musste, diese Hinhalte-Tricks. Kurz nach drei Uhr, als er mit Andrea Blecker telefoniert („Herr Dr. Schöning, was tut sich?“), gibt der Bankdirektor preis: „Das Geld ist bei der Polizei.“
Wütend stellt Rösner wenige Minuten später seinen Gesprächspartner Doerks zur Rede: „Ihr habt die Kohle doch gekriegt, da, von dem Bankfritzen da.“ Doerks: „Das erste, was ich höre, du - ehrlich! Ich krück dich nicht an, wenn ich sage, dass ich nichts davon weiß.“ Rösner: „Wenn du mich verarschen willst, dann sag das doch sofort.“
Das Missgeschick beunruhigt die Beamten umso mehr, da sie inzwischen wissen, dass sie es mit Hans-Jürgen Rösner zu tun haben.
Seine Ex-Frau Uschi hat ihn auf dem Polizeiamt an der Stimme erkannt.
Als Doerks weisungsgemäß die Geiselnehmer wie beiläufig auf den Namen anspricht („Rösler oder Rösner, so genau weiß ich das auch nicht mehr“), wiegelt sein Gesprächspartner ab: „Ist doch scheißegal.“ Und Degowski ruft aus dem Hintergrund: „Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts.“
Wie Rösner im Zorn reagiert, wissen die Fahnder aus der Täterakte. Ohne Vorwarnung hatte er im Juli 1983 in der Justizvollzugsanstalt Gütersloh einem Oberregierungsrat ein selbstgebasteltes Stilett in den Bauch gerammt. Weil Rösner aus dem offenen Vollzug geflohen war, hatte der Justizbeamte 14 Tage Arrest über ihn verhängt.
Rösner empfindet die Strafe als große Gemeinheit. Er befürchtet, dass er nun die nächsten Monate keinen Ausgang mehr bekommt, die Ehe mit seiner Frau Uschi in die Brüche geht. Er hat erfahren, dass sie es satt hat, allein zu leben und ihren Mann nur alle paar Wochen im Gefängnis zu besuchen.
Landesmedizinaldirektor Karl Wiedenfeld qualifiziert Rösner in seinem psychiatrischen Gutachten, wenig differenziert, als „eine völlig haltlose, diffus triebbestimmte, sittlich abgestumpfte Persönlichkeit mit ausgeprägten kriminellen Zügen“. Mit „das Schlimmste“ sei „fast ein moralischer Schwachsinn, keine moralische Gesinnung“.
Ganz so, als wolle Rösner das anmaßende und vernichtende Urteil bestätigen, spielt er bei der Geiselnahme die ihm zugeteilte Rolle. Offenbar mitleidlos versetzt er, etwa in Bremen, selbst Kinder mit der Waffe in Todesangst.
„Mir kann keiner wat erzählen, von Moral nicht und von andere Schoten auch nicht“, tönt er gegenüber der Polizei.
Auf die Bitte, mit den Geiseln doch „ein bisschen menschlich“ umzugehen, stellt Rösner, womöglich ein Schlüssel für sein Verhalten, der Polizei die Gegenfrage: „Menschlich, wer geht mit mir menschlich um?“
Nun war die Polizei mit ihrem Latein erst mal am Ende.
Um die Bank-Geiseln vor Kurzschlusshandlungen der Gangster zu bewahren, muss sie notgedrungen auf die Bedingungen der Täter eingehen. Ab 15.12 Uhr, nach rund sieben Stunden, wird über Details der Forderungen - 300 000 Mark, zweiter Tresorschlüssel, Fluchtwagen - verhandelt. Man spekuliert darauf, Rösner und Degowski bei der Geldübergabe auszutricksen.
Doch auch die Geiselnehmer wissen, dass sie mit einer List rechnen müssen, denken an alles. Obwohl sie sich mit ihrem Aufputsch-Cocktail aus „Vesparax“-Tabletten und Dosenbier gedopt haben und auch noch eine Flasche Sekt aus dem Kühlschrank der Bank geleert haben, bleiben sie hellwach.
Bei der Geldübergabe lassen sie der Polizei keine Chance.
Fast nackt, nur in Badehose, muss sich der Geldbote dem Eingang nähern. Die Banknoten müssen in Klarsichtbeuteln transportiert werden. Rösner zu Doerks am Telefon: „Versuch da keine Tricks.“
Die Polizei versucht's dennoch. Das Geldpaket wird nicht, wie gefordert, direkt vor dem Bankeingang, sondern zwei, drei Schritte von der Tür versetzt deponiert.
Damit will die Einsatzleitung, wie der Düsseldorfer Experte Höhbusch die vermeintliche Panne später erläutert,
„Täter oder Geiseln möglichst weit aus dem Windfang herausbekommen“ und so eventuell „einer der Geiseln die Möglichkeit einer Flucht eröffnen“.
Rösner passt auf. „Bin ich nicht mit einverstanden, wie dat da liegt“, moniert er. Mit einem Besen muss der Badehosen-Polizist das Geld in die gewünschte Position schieben.
Mit kaltblütiger Professionalität lassen die Geiselnehmer die drei Plastiktüten mit dem Geld in die Bank schaffen. Millionen Fernsehzuschauer werden Zeugen eines abstoßenden Schauspiels:
Ein Würgeband um den Hals, muss Kassierer Reinhold Alles auf allen vieren zur Tür kriechen. Wie ein Kettenhund hat Rösner ihn mit einem Elektrokabel angebunden, richtet zusätzlich die Waffe auf ihn. Damit nicht die Spur einer Eingriffschance besteht, hält Kumpan Degowski Andrea Blecker mit seinem Revolver in Schach.
Durch den Türspalt zieht Alles die Tüten mit den 300 000 Mark in die Bank. Rösner meldet Doerks auf Nachfrage („Habt ihr die Tüten?“) Vollzug: „Ja, ist ja alles in Ordnung.“
Und wieder erlebt die Polizei eine Enttäuschung. Statt sich in der ersten Begeisterung über den gelungenen Beutezug gierig auf den Geldhaufen zu stürzen, reklamiert Rösner die fehlenden Zweitschlüssel für den Haupt- und Nachttresor.
„Mensch, hol doch die Tüte da 'rein, fertig ist die Laube“, versucht Doerks ihn vor die Tür zu locken. Und er lässt sich auch jetzt nicht irreführen.
Rösner lässt konsequent den Kassierer Reinhold Alles die demütigende Prozedur wiederholen.
Rösner brennt darauf, einmal im Leben „in einen solch großen Tresor hineinsehen“ zu können. Mit Hilfe von Blekker und Alles, die schon am Morgen die Zahlenkombination auf Druck preisgegeben hatten (Rösner: „Beiden haben wir die Pistole untern Hals gesetzt“), öffnen die Bankräuber die Stahltüren und raffen das Papiergeld zusammen.
Für eine Flucht ins Ausland vorbeugend, stopft sich Rösner auch Dollars, Gulden, Schweizer Franken und Francs in die Taschen. Eine Rolle Markstücke, als Zigarettengeld, steckt er auch noch ein.
Beim Ausräumen des Nachttresors offenbart sich Rösners diffuser Ehrenkodex. Die Geldbomben vom co-op-Super-markt (7560 Mark) und vom Friseurgeschäft Gresch (900 Mark) plündert er. Die dritte Geldbombe mit 870 Mark lässt er unberührt. Alles hat ihm gesagt, dass die „einem Pommesbuden-Besitzer“ gehören. Und mit Geld von „diesem armen Schwein“, mit dem er sich identifizieren kann, will Rösner sich nicht bereichern.
11 Stunden nach der Bankbesetzung wirkt Rösner gelöst. Gegen 19.10 Uhr sagt er zu Doerks: „Ja, so was freut man sich drüber“, noch bevor er das Geld in seiner Sporttasche verstaut hat. „Aber die große Freude kommt erst, wenn wir das Auto haben und weg sind.“
Was die Gangster noch nicht wissen können: Bereits am Nachmittag hat Einsatzleiter Meise nach Rücksprache mit allen Spezialisten eine der umstrittensten Entscheidungen des ganzen Geiseldramas getroffen: die Täter mit Opfer und Geld fahren zu lassen.
Dieser Entschluss, der zum Startschuss für die blutige Irrfahrt wird, ist die polizeitaktische Konsequenz aus der politischen Vorgabe. Denn zu den Grundsätzen der Sicherheitspolitik des Ministers gehört, dass Staatsräson nicht um jeden Preis durchgesetzt werden muss. Und erst recht nicht, wenn ein Sturmangriff, wie der Sonderkommando-Führer Hermey prophezeit, „zu etwa 90 Prozent zum Tod der Geiseln und auch einiger Eingriffskräfte geführt hätte“.
Die Beamten sind sich der Rückendeckung ihres obersten Dienstherrn sicher. Nahezu stündlich haben sie seit den Morgenstunden ausführliche Lageberichte an die „Nachrichten- und Führungszentrale“ des Innenministeriums geschickt. Jeden einzelnen Schritt haben sie vorgetragen und erläutert.
Und kein einziges Mal hat es Widerspruch aus Düsseldorf gegeben.
Offiziell beteuert Einsatzleiter Meise zwar, dass er „durch niemanden beeinflusst worden“ sei. Aber ob nicht doch, zumindest indirekt, der Ablauf der Ereignisse von Schnoor und seinem Stab mitbestimmt wurde, beschäftigt noch Wochen später die Abgeordneten im Untersuchungsausschuss.
Der damalige Ausschussvorsitzende Heinz Lanfermann kommt in seinem 68 Seiten umfassenden Zwischenbericht zu dem Urteil, dass Schnoor „zumindest mittelbar persönlich“ sowie durch seinen Mitarbeiterstab „an dem Ablauf des Einsatzes verantwortlich mitgewirkt hat“. Die Rolle Schnoors ist unter den Parlamentariern bis heute umstritten.
So berichtet das Regierungspräsidium: „Aufgrund des intensiven Informations- und Meinungsaustausches, sei der Eindruck entstanden, der Innenminister trage - möglicherweise sogar höchstpersönlich - die Entscheidungen mit oder habe sogar unmittelbar Weisungen gegeben“.
Dies wird auch durch das Direktorium der Deutschen Bank geteilt, dass Minister Schnoor den Einsatz dirigiert. Das Institut, sorgsam auf seinen guten Ruf bedacht, möchte die leidige Angelegenheit schnell, human und geräuschlos erledigt wissen.
Die Meldungen aus Gladbeck haben auch im Frankfurter Glaspalast, wo im 30. bis 32. Stock der Vorstand des mächtigsten deutschen Konzerns residiert, Hektik ausgelöst. „In all meinen 26 Jahren bei der Deutschen Bank“, erinnert sich der Gladbecker Bankdirektor Schöning, „habe ich nicht so oft mit dem Vorstand gesprochen wie in diesen Stunden.“
Bankchef Alfred Herrhausen wird im Urlaub aufgestöbert, sein Vorstandskollege Michael Endres nimmt sich der Sache persönlich an.
Die Bänker erwarten von Schnoor, dass er, der Not gehorchend, mit einem rechtsstaatlichen Prinzip bricht: Wenn Rösner und Degowski die Geiseln freilassen, sollen sie mit der Beute - Geld spielt keine Rolle - unbehelligt davonfahren dürfen. Und Schnoor persönlich soll ihnen im Rundfunk garantieren, dass sie 24 Stunden nicht verfolgt werden.
Doch Schnoor lehnt das Ansinnen der Bank ab. Die Einsatzleitung hatte ihm signalisiert, dass die Geiselnehmer wohl in keinem Fall ohne die Geiseln abziehen würden.
Allerdings sind die Fahnder zuversichtlich, dass Rösner und Degowski - wenn man sie denn gehen lässt - sich mit Blecker und Alles nicht allzu lange belasten werden. Bei früheren Geiselnahmen wurden die Opfer zumeist nach drei, vier Stunden wieder freigelassen.
Bei dieser überaus komplizierten Fahndungsmethode sollen die Täter einerseits das sichere Gefühl haben, nicht verfolgt zu werden, andererseits muss die Polizei, gut getarnt, jedoch stets so nahe dran bleiben, dass sie bei einer günstigen Gelegenheit jederzeit zugreifen kann. Deshalb bereitet die Einsatzleitung einen „scheinbar verfolgungsfreien Abzug“ vor.
Man schätz die Lage jetzt günstiger ein.: Wortführer Rösner ist identifiziert, von seinem Komplicen wird vermutet, dass es sich um Degowski handelt. In den Nachbarstädten stehen Sondereinsatzkommandos bereit, selbst in den Niederlanden und in Belgien sind Polizeieinheiten in Alarmbereitschaft; an Tankstellen und vor dem Haus der Eltern Rösners lauern Polizeibeamte in Zivil.
Und zum ersten Mal ist es der Polizei gelungen, die Geiselnehmer auszutricksen. Mit der simplen Ausrede, bei Mietwagenfirmen sei der gewünschte schnelle BMW 735i nicht aufzutreiben („Du vergisst die Urlaubszeit, Mensch“), gelingt es Kommissar Doerks von der Verhandlungsgruppe, Rösner einen weitaus langsameren Audi 100 aufzuschwatzen: „Das ist doch ein Schlitten, Junge, den können wir von interRent kriegen.“ Rösner: „Ja, ist gut, nehmen wir den.“
Der Wagen wird präpariert.
Das Mobile Einsatzkommando Essen hat ihn technisch aufgerüstet:
Mit versteckten Mikrophonen können die Gespräche im Wageninnern abgehört werden, über einen eingebauten Sender können die Verfolger vom Hubschrauber und vom Auto aus den Wagen anpeilen; mittels einer Fernsteuerung kann die Motorzündung ausgeschaltet, das Fahrzeug gestoppt werden.
Doch Rösner ist von Anfang an klar, dass ihm kein normales Auto überlassen wird. „Im Knast hatte ich vorher schon mal gehört, dass in solchen Autos Mikrofone, Wanzen und Peilanlagen eingebaut sind.“ Deshalb ist er entschlossen, das Auto nach der Abfahrt so schnell wie möglich auszutauschen.
Zunächst geht's den Geiselnehmern jedoch darum, heil aus der Bank herauszukommen. Zwar hat Doerks ihnen immer wieder versichert, dass die Polizei nicht eingreifen wird: „Wir sind nicht bekloppt, wir fangen nicht an zu ballern. Vorrangig wollen wir kein Blutvergießen.“ Rösner bleibt misstrauisch:
„Wenn von eurer Seite was kommt, dann knallt das sofort.“
Elfeinhalb Stunden hat der psychologisch geschulte Kriminalhauptkommissar Manfred Doerks mit den Geiselgangstern in der Bank telefoniert, um ihre Namen zu erfahren. Einige Auszüge aus dem Dialog zwischen Doerks und den sich in der Bank befindlichen Personen, die sich in den Untersuchungsberichten befanden:
DOERKS: Können wir uns denn nicht irgendwie mit Namen ansprechen?
TÄTER: Ja höma, ja glaubse, ich bin der Papst, oder wat?
DOERKS: Nein, nein, nicht der Papst, aber es ist doch besser, wenn ich zu dir Karl oder Josef sag und du zu mir Manfred, oder wat.
TÄTER: Ah, ich sach dir gar nichts.
DOERKS: Okay.
TÄTER: Du sagst einfach „Eh“ zu mir.
DOERKS: „Eh“ sag ich zu dir.
TÄTER: Das sag ich ja auch zu dir.
Gegen elf Uhr gibt Doerks den Bankräubern eine Telefonnummer durch, unter der er ständig zu erreichen ist. Er verlangt einen der Täter als Gesprächspartner.
DOERKS: Wen spreche ich jetzt von den beiden der Herren?
TÄTER: Ja, wen wohl?
DOERKS: Ja, einer hat gesagt, ich soll ihn „Eh“ nennen.
TÄTER: Ja, ja genau, der ist das.
DOERKS: Egon vielleicht, Egon?
TÄTER: Genau der ist das.
DOERKS: Gut, dann sagen wir Egon.
TÄTER: Lass dir doch 'nen schöneren Namen einfalln.
DOERKS: Ernst, Erwin. Erwin ist gut.
TÄTER: Lass mal bei Egon sein.
DOERKS: Okay. Gut, sach ich Erwin. Ich wollte eigentlich mal so'n bisschen von Mensch zu Mensch mit Ihnen sprechen. Wir ham uns die Sache hier überlegt, ihr habt ja eigentlich das alles nicht gewollt, was da eingetreten ist.
TÄTER: Hör mal, bist du am Spinnen, du Pimpf?
Der Hörer wird aufgelegt. Doerks ruft wieder an, spricht mit der Geisel Reinhold Alles.
DOERKS: Haben die beiden noch Masken auf?
ALLES: Sicher haben die Masken auf.
DOERKS: Ja, mmh, und haben Pistolen in der Hand oder im Gurt stecken, oder in der Jacke oder was?
ALLES: Im Rücken halten se mir se jetzt gerade.
DOERKS: Ja, dann geben Sie mir doch mal einen der Herren.
Das Gespräch wird beendet, erst später meldet sich wieder ein Geiselnehmer.
TÄTER: Ja.
DOERKS: Ja, ist Erwin, ja? Hier ist Doerks nochmal. Ich spreche hier von der Polizei, wir haben immer zusammen gesprochen oder versucht.
TÄTER: Nee, ich bin der andere.
DOERKS: Ach, der andere bist du. Also, ich übergebe jetzt. Ihr wart ja damit einverstanden, dass ihr mit dem Staatsanwalt sprecht.
TÄTER: Ah ja, richtig.
Den Tätern wird angeboten, dass sie mit einem Strafantrag von sechs Monaten davonkommen, wenn sie innerhalb einer Stunde die Geiseln freilassen.
TÄTER: Passen Se mal auf. Wie Sie so labern, ne, glauben Sie das nicht, dass wir Ernst machen, ne. Aber eins kann ich Ihnen sagen, passiert das nicht bald, dass wir die Forderung kriegen, dann lösen wir unsere Masken, und dann können Sie sich ja vorstellen, dass die Geiseln tot sind. - Weil sie uns hier erkennen. Und wir sind auch kein unbescholtenes Blatt mehr.
Rösner und Degowski hören im Rundfunk, dass sie noch nicht identifiziert sind. Um 14.40 Uhr kommt der Polizei-Unterhändler auf das Angebot der Staatsanwaltschaft zurück:
DOERKS: Habt ihr euch mal die Sache durch den Kopf gehen lassen?
TÄTER: Dann müsst ich ja wahnsinnig sein.
DOERKS: Warum denn, Junge?
TÄTER: Warum? Hör mal. Lieber geh ich kaputt, bevor ich nochmal in die Kiste gehe.
DOERKS: Ach, Kerle . . .
TÄTER: Oder meinst du, ich glaub die Tricks von dem Staatsanwalt? Der kann mich am Arsch lecken.
Mit Verhandlungen über Lösegeld und Fluchtauto versucht Doerks, die Täter hinzuhalten, verwickelt sie in Gespräche über ihre Kindheit.
DOERKS: Mit deiner Einstellung, mit deiner Lebensgesinnung, mit deiner, entschuldige, wenn ich das so sage, passt vielleicht nicht zu dir, aber, vielleicht lachst du darüber, mit Ethik und Moral. Hast' davon mal was gehört?
TÄTER: Moral, wat is das denn?
DOERKS: Ja, Moral.
TÄTER: Hab ich nie gehört. Hab keine Moral.
DOERKS: Du bist ja auch geboren worden, von einer Mutter. Du bist doch auch irgendwo mal . . .
TÄTER: Ach, Scheißmutter . . .
DOERKS: . . . im Arm zärtlich gehalten worden. Du bist mal getauft worden. Du bist mal zur Kirche gegangen und so was alles.
TÄTER: Ich zur Kirche? - Bei dem Himmelskomiker, was soll ich denn da?
DOERKS: Ja, du bist doch konfirmiert, Junge, das weiß ich ganz genau.
TÄTER: Tja, natürlich.
DOERKS: Deine Eltern haben dich zur Konfirmation geschickt, irgendwo hast du auch mal was vom lieben Gott gehört. - Und alles, diese Kacke ist dir gar nichts mehr wert?
TÄTER: Nö. - Wenn ich jetzt so weiter drauf eingehe, so auf mein Leben und so weiter, kann man Puzzle zusammensetzen, und auf einmal dann weiß man schon irgendwie, wer das sein könnte, ne?
DOERKS: Hm, hm - tja, ich mein, mir könntest du 1000 Dinge noch erzählen, ich wüsste immer noch nicht, wer du bist.
Inzwischen hat Uschi Rösner bei der Polizei auf Tonband die Stimme ihres Ex-Mannes identifiziert. In den 17-Uhr-Nachrichten bekommen die Geiselnehmer mit, dass es sich bei den Tätern um „ausgebrochene Häftlinge“ handeln soll.
RÖSNER: Hier, wie ist das denn eigentlich hier mit, eh, wat die da in den Nachrichten, wer soll das denn sein hier, eh, eh, entflohener Häftling und so . . .
DOERKS: Hör mal, gibt es bei euch einen, eh, Hans-Jürgen Rösner, oder was haben die gesagt?
RÖSNER: Wo, hier?
DOERKS: Heißt einer von euch beiden Hans-Jürgen?
RÖSNER: Nee.
DOERKS: Rösner?
RÖSNER: Nee.
DOERKS: Das soll doch ein ausgebrochener Häftling Hans-Jürgen Rösner sein?
RÖSNER: Nee, wo soll der denn ausgebrochen sein?
DOERKS: Ja, was weiß ich . . . Na ja, ich meine, was sollte das denn auch, dann hättest du mir das mit Sicherheit gesagt, oder?
RÖSNER: Ja, sicher!
Gemurmel im Hintergrund.
DOERKS: Ach ja, da erinner ich mich noch. Du, hör mal, der soll irgendwie tätowiert sein an den Armen, der Typ.
RÖSNER: Bin ich tätowiert?
DOERKS: Ja, weiß ich nicht, Junge, ich kenn dich nicht.
RÖSNER: Nee, versteh ich nicht (leises Lachen).
DOERKS: Was soll das denn, am Telefon darüber zu fachsimpeln, ob du das bist oder nicht, oder dein Kumpel, was weiß ich!
RÖSNER: Ist doch scheißegal.
Gegen 19.30 Uhr gibt Doerks zu erkennen, dass er den Namen des Täters im Radio gehört hat.
RÖSNER: Ich weiß überhaupt nicht, wie die hier auf den Namen kommen.
DOERKS: Mit allen Tricks arbeiten die.
RÖSNER: Ja, vielleicht bin ich dat ja auch, der Rösner.
DOERKS: Eh, haste mich gelinkt, Junge?
RÖSNER: Wieso?
DOERKS: Bist du der Hans-Jürgen Rösner oder Rösler, wie soll er heißen?
RÖSNER: Weiß ich nicht.
DOERKS: Kerle, du. Ich glaub, wir beide gehn doch noch mal ein Bier trinken, du.
RÖSNER: Ha, das glaub ich nicht.
Um 20.16 Uhr rollt das Fluchtauto vor, die Geiselgangster rüsten zum Aufbruch.
RÖSNER: Ich habe die Maske schon ab.
DOERKS: Du hast die Maske schon ab?
RÖSNER: Du weißt ja, wer ich bin, ne.
DOERKS: Ja, ich hab dich nicht gesehen, ich weiß nicht, wer du bist.
RÖSNER: Ja, hast du doch vorhin gesagt.
DOERKS: Ja, bist du doch der Hans-Jürgen?
RÖSNER: Ja.
DOERKS: Na ja, hast mich ganz schön linken wollen.
RÖSNER: Na, ich musste aufpassen, nich.
DOERKS: Also soll ich dir was sagen, (atmet tief durch) Mann, du bist doch ein blöder Kerl, du.
RÖSNER: Nö, bin nicht blöd.
DOERKS: Wärste nur auf das andere eingegangen, was wir dir geboten haben.
RÖSNER: Nein, nein, ich hab elf Jahre hinter mir und diese dreckige Justiz, ne.
DOERKS: Soll ich dir was sagen, Junge, du hast das hinter dir, aber sonne große Latte hast du doch gar nicht vor dir!
RÖSNER: Nee, die haben mich kaputtgemacht da drin!
Und ich gehe keinen Tag mehr da rein. Ich hab mir das geschworen: Inne Kiste - einmal irgendwann geh ich drauf, egal, ne.
***
Dass der Wechsel in den Fluchtwagen ein hohes Risiko birgt, wissen beide Täter. Sie vermuten, dass Scharfschützen beim Verlassen der Bank gezielte Schüsse abgeben. „Ich kenn die Tricks“, prophezeit Rösner seinem Gesprächspartner, „da sagen die, da haben wir 'ne Chance, da schießen wir in die Zwiebel rein.“
Ohne weitere Tricks wird der weiße Audi 100 vor den Bankeingang gerollt. Wie besprochen, steht die Kofferraumklappe offen, sind die Türen unverschlossen.
Dutzende von Journalistenteams aus der ganzen Bundesrepublik blockieren mit ihren Fahrzeugen die Zufahrtswege, besonders gewiefte Reporter haben sich Logenplätze auf den Balkons der Nachbarhäuser gesichert. Die Einsatzleitung fürchtet, dass unbedachte Zeitungsleute bei der Flucht dazwischenfunken und so Rösner und Degowski zu einer Kurzschlusshandlung verleiten könnten.
Als könnte er hellsehen, die Entwicklung der nächsten Tage voraussagen, warnt Polizeisprecher Doerks: „Die fahren hinterher, du, die riskieren Kopf und Arsch für 'n Bild und für 'n Interview.“ Und Rösner prophezeit, was beide Geiselnehmer später tatsächlich tun werden: „Dann müssen sie sich nicht wundern, wenn ihnen die Kugeln um die Ohren pfeifen.“
Um Spuren zu verwischen, muss Andrea Blecker noch Gläser und Tassen spülen und das Telefon abwischen. Rösner sammelt Zigarettenkippen ein und wirft sie ins Klo. Zwar hat Rösner inzwischen gegenüber Doerks seine Identität eingeräumt („Ich habe die Maske schon ab, du weißt ja, wer ich bin“). Dass die Polizei Degowski als Mittäter in Verdacht hat, wissen die beiden jedoch nicht.
So eiskalt wie die Täter die Geldübergabe organisiert haben, so cool verläuft ihr Abzug. Ihren Geiseln haben sie die Hände mit langen Elektrokabeln vor dem Bauch gefesselt, führen sie „wie an der Hundeleine“ (Rösner).
Als erste tauchen Rösner und Alles aus der mittlerweile abgedunkelten Bank auf, zwängen sich in den Audi. Degowski will auf dem Weg zum Wagen die Geisel Blecker auf fast pervers anmutende Art bedrohen. Mit einem Spültuch hat er sorgfältig den Lauf seines Trommelrevolvers abgewischt, um ihr das Rohr in den Mund zu stecken. Nur mit dem flehentlichen Hinweis auf ihre „empfindlichen Zähne“ erreicht die Bankangestellte, dass Degowski davon ablässt. Stattdessen hält er seinem Opfer die Waffe an den Hals.
Um 21.47 Uhr, nach fast 14 Stunden Nervenkrieg, haben Rösner und Degowski erreicht, was sie wollten: Geld, Auto, freien Abzug.
Unter dem Blitzlichtgewitter von Pressefotografen und vor laufenden Fernsehkameras rollt der Fluchtwagen im Schritttempo vom Gelände des Einkaufszentrums. Rösner sitzt am Steuer, Degowski zwischen den beiden Geiseln auf den Rücksitzen. Die Polizei hat ihnen durch den Pressepulk eine Schneise freigesperrt, eskortiert das Fahrzeug auf den ersten Kilometern durch Gladbeck.
Weil die Täter sicher sind, dass der Wagen verwanzt ist, wird kein Wort gesprochen. Doch die Geiseln sind zuversichtlich, dass die Tortur bald ein Ende haben wird.
Degowski verspricht Andrea Blecker kurz vor der Abfahrt die Freilassung: „In ein paar Stunden lassen wir euch raus.“
Rösner aber hat zunächst vor allem einen Wunsch: Er will den neu gewonnenen Reichtum mit seiner Freundin Marion Löblich teilen. Nach der aber fahndet die Polizei vergebens seit dem Nachmittag.
Deren 13-jährige Tochter Nicole kommt gegen Mittag ganz aufgeregt aus der Schule. Überall sei Polizei, berichtet das Mädchen seiner Mutter, halb Gladbeck sei abgesperrt.
Neugierig schaltet Marion Löblich das Radio ein, hört im Westdeutschen Rundfunk die Nachricht von einem Bankraub in Rentfort-Nord. Zwei unbekannte Männer haben am Morgen, kurz vor acht, die Filiale der Deutschen Bank im nahe gelegenen Einkaufszentrum überfallen und zwei Geiseln in ihre Gewalt gebracht.
Marion Löblich, die halbtags im Altenzentrum der Arbeiterwohlfahrt arbeitet, hat ein „ungutes Gefühl“. Sie weiß, dass ihr Freund Hans-Jürgen Rösner die gemeinsame Haushaltskasse mit Einbrüchen und Überfällen aufbessert. Längst fragt sie nicht mehr nach der Herkunft, wenn Rösner mal wieder unverhofft bündelweise Hundertmarkscheine auf den Küchentisch packt. Sie weiß auch, dass Rösner mit Haftbefehl gesucht wird. Mit ihrem Einverständnis hat er sich im Kinderzimmer einen Verschlag gezimmert, hinter dem er sich selbst, Einbruchswerkzeug und Diebesbeute verstecken kann.
In böser Vorahnung nimmt Marion Löblich ihre Tochter Nicole und flüchtet zu Rösners Schwester Renate. „Die Bank, die Bank, ich glaub', der Hanusch ist da drin“, stammelt sie weinend. Von einem Verwandten erfährt sie telefonisch, dass die Polizei ihre Wohnung durchsucht. Nun ist sie ganz sicher, dass Rösner sein Versprechen, irgendwann „einen großen Coup“ zu landen, wahr gemacht hat. Fortan hat sie nur noch eine fixe Idee: „Ich muss zum Hanusch.“
Dass sich diese schüchterne, unsicher wirkende Frau, die ebenfalls die Sonderschule besucht hat, auf ein derart kriminelles Abenteuer einlässt, erklärt sich nur aus der ganz besonderen Beziehung zu ihrem Geliebten. Auf ihrer lebenslangen Suche nach einem festen Halt glaubt sie in Rösner endlich jenen „harten Kerl“ gefunden zu haben, auf den man sich verlassen kann.
Animiert durch Rösner, berauscht sie sich wie er mit Bier und Vesparax-Tabletten, lässt sich, um Rösner „einen Gefallen zu tun“, nach einem Gelage zum Sex mit Degowski überreden. „Sie tat alles, was ich ihr sagte“, beschreibt Rösner das Verhältnis, „sie war mir hörig.“
Das psychiatrische Gutachten, das dem Essener Landgericht zum Prozess vorliegt, scheint Rösners Einschätzung zu bestätigen. Die Gerichtsmediziner bescheinigen Marion Löblich „eine labile und unberechenbare Persönlichkeit“ mit „Neigung zur Abhängigkeitshaltung“.
Nur ihr fast unterwürfiges Verhältnis zu Rösner macht begreiflich, warum sich Marion Löblich auch nach der Geiselnahme für ihn bereithält. Da sie bei Rösners Schwester Renate, die mit der ganzen Sache nichts zu tun haben will, nicht bleiben kann, sucht sie am Nachmittag bei Rösners Schwester Monika und deren Ehemann Zuflucht.
Aufgeregt verfolgt sie die Rundfunkberichte über den Bankraub, hofft, dass sich Hanusch nach der Flucht bei seiner Schwester melden wird.
Um ihre Aufregung zu dämpfen, schluckt Marion Löblich abends Vesparax-Beruhigungstabletten, ausnahmsweise mal ohne Bier, legt sich ins Bett und wartet auf ihren Freund Hanusch. Doch der aber hat ganz andere Pläne, verblüfft Polizei und Freunde.
Kaum rollen die Geiselnehmer um 21.47 Uhr mit ihren Opfern im Fluchtwagen aus der Passage vor der Deutschen Bank, irritieren sie die Fahnder durch „völlig atypisches Verhalten“ (Polizeibericht). Anstatt möglichst unauffällig in der Dunkelheit unterzutauchen, bleiben sie in Gladbeck, zeigen sich ganz offen.
Weil Rösner und Degowski dringend Bier und Vesparax-Tabletten brauchen, um sich weiter aufzuputschen, und die Geiseln Andrea Blecker und Reinhold Alles, die den Tag über kaum etwas gegessen haben, hungrig sind, starten sie mit dem von der Polizei bereitgestellten weißen Audi zu einer irrwitzigen Einkaufsfahrt.
An einer Esso-Tankstelle muss ein zufällig vorbeikommender Bekannter Rösners („Kalle, komm mal her“) drei Stangen Zigaretten holen. Vor einem Kiosk winken die Täter einen Jungen heran, der Bier und Süßigkeiten einkauft und auf sein Trinkgeld verzichtet: „Ich weiß, wer ihr seid.“
In die Imbissstube „Mostar“ geht Rösner persönlich rein: „Hier ist der Bankräuber aus Gladbeck, macht keinen Scheiß, wir wollen nur was zu essen.“ Mit vorgehaltener Waffe ordert er zehn Frikadellen, ein Hähnchen und ein Kotelett. Die Rechnung begleicht er mit einem Hundertmarkschein aus der Beute.
An der nächsten Station, der Barbara-Apotheke in der Innenstadt, werden die Bankräuber schon erwartet. Durch das im Wagen versteckte Mikrofon wissen die Polizeibeamten, dass die Täter Tabletten kaufen wollen. Die Polizei informiert vorsorglich den Apotheker, der die von Rösner geforderte rezeptpflichtige Vesparax-Packung anstandslos herausrückt.
Für den Bankangestellten Alles, dem die Aufregung auf den Magen geschlagen ist, steckt der Bankräuber noch ein Mittel gegen Übelkeit und Erbrechen ein.
Zur Flucht ins Ausland fehlt nach Ansicht Rösners jetzt, wo die Marschverpflegung komplett ist, nur noch ein Wagen ohne Polizeiwanzen. Den will er sich vor einer Kneipe „wegfiedeln“, die dafür bekannt ist, dass ihre Gäste „immer dicke Autos“ fahren.
Mit gezückter Pistole stürmt der bärtige Rösner an die Theke der Raststätte „Berg“ am Gladbecker Stadtrand: „Der Nikolaus ist da! Wem gehört der 635er vor der Tür?“ Da er keine Antwort bekommt, haut Rösner mit der Waffe in der Hand auf den Tresen, ballert los.
Die Kugel zischt nur wenige Zentimeter über den Kopf eines Gastes hinweg, der Rösner, ohne es zu wissen, überhaupt erst das Rüstzeug für die Geiselnahme geliefert hat: Gerd Meyers.
Der gelernte Schweißer, der „Waffen faszinierend“ findet, hatte an einen Mittelsmann zwei schwere Waffen verkauft: eine Selbstladepistole Modell „Colt Government“ (Kaliber 9 Millimeter Luger) und einen Trommelrevolver Typ „Highway Patrolman“, Kaliber 357 Magnum.
Dass die Waffen ausgerechnet an den in der Gladbecker Szene berüchtigten Rösner weiter verhökert wurden, will Meyers nicht gewusst haben.
Ausdrücklich sei der Vermittler vergattert worden, die Waffe nur an „eine vernünftige und seriöse Person“ weiterzugeben, „die nicht gleich an der nächsten Ecke jemanden erschießt“.
Erst 20 Stunden nach dem Schuss in der Gaststätte, der ihn so knapp verfehlte, dämmert Meyers, in wessen Besitz die Waffen tatsächlich gelangt sind. In einem Fernsehbericht über die Buskaperung in Bremen erkennt er in Rösners Hand seinen eigenen Colt, kann es kaum fassen: „Das wär' ja ein starkes Stück, wenn ich mit meiner eigenen Waffe erschossen worden wäre.“
Den geforderten Fluchtwagen bekommt Rösner bei seinem Pistolero-Auftritt allerdings nicht. Selbst nachdem Degowski von außen ungeduldig durch die Scheibe geschossen hat, gibt sich keiner der Gäste als Besitzer des BMW zu erkennen. Wütend zieht Rösner ab.
Eine Viertelstunde später hält Rösner schon dem nächsten die Pistole unter die Nase. Vor einer Spielhalle zwingt er einen verdutzten Autobesitzer zum Aussteigen, übernimmt den Wagen als neues Fluchtfahrzeug. Der schwarze BMW (amtliches Kennzeichen: E - MW 263) erweist sich jedoch als Flop: Der Wagen ist über 200 000 Kilometer gefahren, der Motor zieht nicht, die Karosserie klappert. Vor allem aber stört die Täter, dass im BMW ein Radio fehlt, mit dem sie die neuesten Rundfunkmeldungen verfolgen können.
Um das schadhafte Fahrzeug einzutauschen, steuert Rösner, zum zweiten Mal, die Esso-Station an der Horster Straße an. Diese Tankstelle soll in der nächsten halben Stunde für die Polizei zum Schauplatz eines gelungenen Coups als auch einer unsäglichen Panne werden.
Nun die nächste polizeiliche Panne, die auch heute noch nicht gern erwähnt wird. Weil die Beamten in der Funkzentrale über den Fluchtverlauf nicht auf dem laufenden sind, den falschen Kanal eingeschaltet haben, liefern sie einen ahnungslosen Kripomann dem Geiselgangster Rösner aus. Der ortsfremde Beamte, der sich auf dem Rückweg vom Bankeinsatz bei seinen Kollegen in der Zentrale nach der günstigsten Tankmöglichkeit erkundigt, wird ausgerechnet zu jener Esso-Station beordert, an der Rösner schon Autofahrer bedroht.
Mit den Worten „Leg ab, ich hab' einen Ballermann“ zwingt Rösner den Polizisten, seine Dienstwaffe „P 6“ mit zwei Fingern aus dem Halfter zu ziehen und ihm, samt Reservemagazin, auszuhändigen. Und obgleich der Beamte im Auto noch einen Diensthund mitführt, greift sich Rösner auch noch das Handfunkgerät vom Beifahrersitz. Rösner:
„Der Hund bellte fürchterlich, befand sich aber hinter einem Gitter.“
In einer vertraulichen Fehleranalyse des Düsseldorfer Innenministeriums („Einsatznachbereitung Gladbeck“) wird der „Koordinationsfehler“ als besonders gravierend herausgestellt: „Hierdurch wurde die gesamte weitere Fahndung beeinträchtigt.“
Denn der Funkverkehr auf dem Zwei-Meter-Band, über das bisher die Verfolgung gesteuert wird, muss auf einen anderen Kanal umgestellt werden, was weit über Gladbeck hinaus zu einem Chaos bei der Nachrichtenübermittlung führt.
Zudem besitzen die Täter nunmehr eine dritte Waffe, mit der Rösners Freundin Marion Löblich tags darauf im gekaperten Bremer Bus Fahrgäste bedrohen wird.
Und Rösner gelingt, scheinbar, gleich noch ein Husarenstück. Er sieht einen hellblauen Mercedes 230 E an die Zapfsäule rollen, „der richtige weitere Fluchtwagen“.
Obwohl der Wagenbesitzer vom Kassenhäuschen aus protestiert, erklärt Rösner den Wagen für beschlagnahmt. Zusammen mit Degowski und den Geiseln packt er Beute und Vorräte aus dem alten BMW in den neuen Mercedes um, Kassierer Alles muss volltanken.
Mit neuem Fahrzeug geht die Flucht weiter, doch ist mit dem neuen Wagen auch alles in Ordnung?