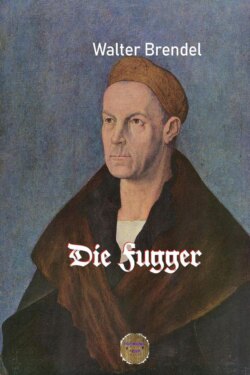Читать книгу Die Fugger - Walter Brendel - Страница 9
Die Gründung der Dynastie
ОглавлениеIm vierzehnten Jahrhundert zog es viele Menschen unter dem Motto „Stadtluft macht frei“ in die Städte. Warum ausgerechnet dieses Motto? Der Ausspruch „Stadtluft macht frei nach Jahr und Tag“ umschreibt einen Rechtsgrundsatz im Mittelalter.
Aus Siedlungen rund um Burgen und Klöster, die etwa ab dem 11. Jahrhundert von freigekauften Leibeigenen und anderen Angehörigen des 3. Standes gegründet wurden, entstanden neben den alten römischen oder auch germanischen Gründungen weitere Städte. Dabei setzten sich immer mehr Leibeigene in die Städte ab, wo sie für ihre Grundherren zumeist unauffindbar waren. So wurde es Rechtsbrauch, dass ein in einer Stadt wohnender Unfreier nach Jahr und Tag nicht mehr von seinem Dienstherrn zurückgefordert werden konnte und somit ein Insasse (auch Stadtbewohner) wurde. Diese Regelung wurde freilich durch das Statutum in favorem principum (1231/32) zugunsten der Fürsten aufgegeben.
Die Stammtafel des Hauses Fugger von der Lilie beginnt mit Maria Fugger-Meissner aus Kirchheim, die mit ihrem Mann Hans Fugger zu Graben an der Straße auf dem Lechfeld lebte. Sie war die Mutter des Webers Hans Fugger, der 1367 nach Augsburg zog, wohl wissend, dass in der Reichsstadt tüchtigen Handwerkern guter Verdienst winkte. Das Bürgerrecht und die Handwerkgerechtigkeit konnten damals auf zweierlei Art erworben werden: entweder durch Heirat mit einer Tochter oder Witwe eines Webmeisters oder durch den Kauf des Bürgerrechts.
Hans Fugger zog also von Graben nach Augsburg. Er hatte offenbar erkannt, dass er als Landweber auf dem Dorf keine allzu großen Zukunftschancen besaß. Die Landweber waren voll kommen abhängig von den Kaufleuten aus der Stadt, welche ihnen die Rohware brachten und die fertigen Stoffe wieder mitnahmen. Landweber wurden schlecht entlohnt - pro Tag verdienten sie etwa zehn Kreuzer. Da, machte einen Gulden in der Woche und fünfzig Gulden im Jahr - vorausgesetzt, es war immer genug Arbeit da. Die Weber in der Stadt verdienten mehr, und das war einer der Gründe, weshalb die Augsburger Verlagsherren, wie man die entsprechenden Kaufleute nannte, lieber die bescheideneren Dörfler beschäftigten. Gewoben wurde auf einfachen Webstühlen, und zwar vornehmlich der Barchent, ein fester, auf einer Seite angerauhter Stoff aus Baumwolle und Flachs. Er wurde zu den groben Kleidern der Bauern und Bürger verarbeitet, wohlhabende Kaufleute und der Adel dagegen bevorzugten Seidenstoffe und Damast. Hans Fugger hatte es jedoch nicht leicht, denn es gab schon viele Weber in Augsburg.
Hans Fugger allerdings hatte vorgesorgt. Er durfte sich noch im Jahr seiner Ankunft als selbständiger Weber in Augsburg niederlassen. Vermutlich hatte schon der Vater Beziehungen zu Augsburger Webern angeknüpft, die dem Sohn eine Aufenthaltsgenehmigung verschafften. Dass Hans I. nicht als Habenichts ankam, dokumentiert ein Eintrag aus dem Jahr 1367 in den Steuerbüchern der Stadt, aus dem hervorgeht, dass er Vermögen besaß. Wie hoch dieses war, ist unbekannt. Seine erste Steuerzahlung jedenfalls lautete über 44 Pfennige.
Nach etwa drei Jahren, um 1370, hatte er es geschafft. Der Weber Hans Fugger verheiratete sich 1367 mit Clara Widolf, der Tochter des Zunftmeisters der Weber, Oswald Widolf. Die Dame war, wenngleich mit bescheidenen äußeren Vorzügen ausgestattet, so doch eine glänzende Partie. Hans wurde am Tag der Eheschließung Bürger Augsburgs, Mitglied der Weberzunft und außerdem Empfänger einer ansehnlichen Mitgift. Die erste Behausung der Fugger in Augsburg war bescheiden. Hans und Clara wohnten bei den Schwiegereltern hinter dem Stift Heiligkreuz in der Frauenvorstadt, einer Gegend, in der 70 bis 80% der Weber in Häusern mit sechs und mehr Familien wohnten. Die hygienischen Verhältnisse waren schlecht, die Wohnverhältnisse bedrückend, aber immer noch besser als in der Jakobervorstadt oder im Lechviertel. Es ist nicht bekannt, wie die Weberhäuser innen aussahen bzw. wie viele Zimmer als Wohn- und Arbeitsräume zur Verfügung standen. Anhand der Steuerlisten der Stadt Augsburg konnte errechnet werden, dass die Wohnverhältnisse der Weber weit ungünstiger waren als die der nicht weberischen Bevölkerung.
Dass die Partnerwahl jenes ersten Fuggers nicht oder zumindest nicht ausschließlich von zarten Gefühlen bestimmt war, bewies er zwölf Jahre später. Nach Clara Widolfs frühem Tod entschloss sich Hans Fugger 1382 zu einer Wiederverheiratung mit Elisabeth Gfattermann, der Tochter eines reichen Ratsherrn und bedeutenden Mitglieds der Weberzunft. Durch seine Ehe mit Elisabeth Gfattermann, einer ebenso klugen wie energischen Frau, schaffte er den Aufstieg in den »Zwölferausschuss« der Weber. Fugger war damit einer der führenden Zunftmeister. Über den Tod seiner ersten Frau ist nichts bekannt geworden. Höchstwahrscheinlich war sie erheblich älter als ihr Mann, schon zum Zeitpunkt der Eheschließung ein »spätes Mädchen« also, deren Eltern vermutlich froh waren, sie unter die Haube gebracht zu haben.
Nach der Eheschließung zog das Paar in ein beim "Gögginger Tor vor dem Brunnen" gelegenes Anwesen, das der Schwiegermutter Gfattermann vom Chorherrenstift St. Moritz lehen bar gemacht wurde. "Auf den Leib verliehen" wurde die "Hofsach" für sie, ihren Tochtermann Hans Fugger, dessen Hausfrau und Söhne. Nach dem Tod der Schwiegermutter Gfattermann wurde dieses Anwesen für die Familie "die erste Fuggerische Behausung, die sie eigentümlich bewohnte".
Wer als Weber ein eigenes Haus für seine Familie besaß, verfügte über einen ansehnlichen Besitz. Im Jahre 1397 schaffte Hans Fugger bereits den Sprung in die Oberstadt. Durch seine eigene Arbeit und die "Habe seiner Frauen" konnte er das prächtige "Haus am Rohr" (heute Maximilianstraße 21; eine Gedenktafel erinnert an Jakob Fugger) erwerben, direkt an der Reichsstraße gegenüber dem Zunfthaus der Weber und der St. Moritz-Stiftskirche: Ein bedeutender sozialer Schritt aus dem armen Weberviertel in die spätere Maximilianstraße, weitaus bedeutungsvoller als der folgende Erwerb der Häuser am Rindermarkt!
Die Nachbarn waren angesehene Familien, so z.B. Konrad Kräslein und Joseph Artzt. Aus der letztgenannten Familie stammte die spätere Ehefrau des im "Haus am Rohr" 1459 geborenen Jakob Fugger. Schräg gegenüber wohnte die Familie Lang, aus der zwei Nachkommen Geschichte und Geschichtchen machten: Matthäus Lang, der spätere Kardinal von Gurk und Erzbischof von Salzburg, Vertrauter und Reichskanzler Kaiser Maximilians I., und Appolonia Lang, die als Hofdame der zweiten Gemahlin des Kaisers, Bianca Sforza, die Favoritin Herzog Georgs von Bayern wurde.
Die Mutter im Hause Lang, Margarete Sulzer, war die Schwester der späteren Schwiegermutter von Jakob Fugger.
Die Geschäfte gingen gut im Hause Fugger. Hans Fugger gehörte bereits 1396 zu den 74 Personen der Stadt, die ein Vermögen von mindestens 1200 ungarischen Gulden versteuerten.
Während Hans Fugger ohne besondere Rücksicht auf Gefühle Karriere machte, traf sein jüngerer Bruder Ulin in Augsburg ein. Er durfte nur auf wenig Beistand des älteren hoffen und musste deshalb als schlecht bezahlter „Knecht“ eines Webers anfangen.
Erst ab 1382 wurde er in den Steuerbüchern als „Vermögender“ geführt. Immerhin brachte es auch dieser Fugger zu einigem Wohlstand. Er heiratete die Bürgertochter Radigunde Mundsam und eröffnete ebenfalls eine eigene Weberei. Zeitweilig zahlte er sogar höhere Steuern als sein Bruder, was jedoch eher für seine Ehrlichkeit als für seine Tüchtigkeit spricht. Als der Vater, Hans der Alte, in Graben gestorben war, zog die Mutter nach Augsburg. Aber bezeichnenderweise nicht zum Erstgeborenen, sondern zu Ulin, dem Nesthäkchen. Hans war ihr zu kalt und egoistisch. UIin Fugger war den rauen Sitten, die damals im Geschäftsleben herrschten, nicht gewachsen. Ein Bleicher, der ihm Geld schuldete, erschlug den jüngeren der Fuggerbrüder, als er es von ihm eintreiben wollte. Kurz darauf, im Jahr 1402, brannten die drei Häuser Ulins ab, vermutlich durch Brandstiftung. Ulins Söhne waren ebenfalls vom Pech verfolgt. Hans wollte Kaufmann werden, wurde aber an der Landesgrenze bei Salzburg der Zollprellerei überführt und in den Kerker geworfen. Sein jüngerer Bruder Konrad blieb Weber, verarmte und sein Name schied bald aus den Steuerbüchern der Stadt aus. Das einzige, was aus diesem Zweig der Fuggerdynastie übrig blieb, sind zwei schöne Stücke alten Gewebes, Arbeiten Konrad Fuggers.
Hans hielt es offenbar nicht für erforderlich, der Familie seines Bruders unter die Arme zu greifen. Dafür war er ganz damit beschäftigt, neben der Weberei einen Textilhandel aufzuziehen. Er muss schon sehr tüchtig gewesen sein, jener erste Fugger.
Sein Vermögen, über dessen wahre Höhe nur er allein Bescheid wusste, wuchs selbst in seinen Steuererklärungen von Jahr zu Jahr. In Augsburg sah er, wie das Geschäft der Kaufleute funktionierte: Man kaufte Baumwolle aus dem fernen Ägypten in Venedig ein, brachte sie über die Alpen und ließ sie von den Webern mit Flachs zu Stoffen verarbeiten. Warum sollte nicht auch er an den enormen Preisunterschieden zwischen Rohware und Endprodukt verdienen?
Da sich seine Tüchtigkeit in Graben und den umliegenden Dörfern schnell herumgesprochen hatte, vertrauten ihm bald einige Bauern und Landweber kleinere Summen an, in der Hoffnung, der Fugger in der Stadt werde schon mehr daraus machen.
Sie wurden selten enttäuscht. Im Jahr 1385 versteuerte er bereits ein Vermögen von 1.500 Gulden. Er war ein wohlhabender, erfolgreicher Kaufmann und hatte nichts mehr mit dem armen, schüchternen Webergesellen aus Graben gemein.
Nach der altbekannten Mär, die Juden sind schuld am ganzen Unglück und sie haben unseren Herren verraten, wurden auch im Augsburg die Juden vertrieben. Die Juden erkannten frühzeitig die Lücke im Wirtschaftssystem des christlichen Abendlandes.
Dass sie damit zu Wohlstand gelangten, machte sie in den Augen der braven Christen keinesfalls sympathischer. Immer wieder kam es zu Pogromen, bei denen sich die Deutschen mit Gewalt zurückholten, was ihnen die frühen Vorfahren der Rothschilds mit List und überlegenem Finanzgeschick abgeknöpft hatten.
Auch Hans Fugger profitierte von der Vertreibung der Juden, schon dadurch, dass er sein neues Haus – was am „Judenberg“ stand - sehr billig erwerben konnte. Sein Vermögen hatte damals beträchtlich zugenommen hat. In der Rangliste der 2930 abgabepflichtigen Bürger Augsburgs - die Stadt hatte rund 15000 Einwohner – stand er mit seinem versteuerten Vermögen an 41. Stelle.
Nun war es an der Zeit, auch die Mitbürger wissen zu lassen, dass man es zu etwas gebracht hatte. So kaufte er 1397 für 500 Gulden das stattliche „Haus am Rohr“ von dem Gürtler Heinrich Grau. Fuggers neues Domizil lag unweit des Weberzunfthauses, mitten im Geschäftszentrum der Stadt. Wenn es trotzdem vergleichsweise preiswert zu haben war, hing das damit zusammen, dass es an den „Judenberg“ grenzte. In jenem Viertel lebten die zwar wohlhabenden, aber verachteten jüdischen Geldhändler, die gerade wieder einmal, wie so oft, aus der Stadt vertrieben wurden.
Klar, dass dadurch der Wert des neuen Fuggerhauses sofort stieg.
Bis zu seinem Tod im Jahr 1409 gelang es ihm, zahlreiche öffentliche Ehrenämter, nicht zuletzt das eines Richters der westfälischen Feme, und rund 3000 Gulden anzusammeln.
Dennoch war seine Lebensleistung nun nicht so überragend, dass er hätte damit in die Geschichte eingehen können und außerhalb von Augsburg kannte ihn fast kein Mensch. Der reichste Augsburger Bürger besaß immerhin etwa sechzehnmal soviel wie der Fugger, und der Abstand zu den ganz großen Familien jener Tage, etwa den Medici, war gewaltig. Doch dass sollte sich noch ändern.
Als Hans Fugger starb, waren seine beiden Söhne Andreas und Jakob noch nicht volljährig. Deshalb kümmerte sich die Mutter um die Firma. Elisabeth Gfattermann- Fugger überlebte ihren Ehemann um 28 Jahre. Die Witwe erwies sich als äußerst geschäftstüchtig. Sie verhinderte eine Zersplitterung des Familienvermögens durch Erbteilung und erhielt ihren Nachkommen den städtischen Hausbesitz und die ländlichen Liegenschaften, darunter Güter zu Burtenbach, Scheppach und Hiltenfingen.
Clara Fugger-Widolf und Elisabeth Fugger-Gfattermann, Ehefrauen des Hans Fugger. Aus: „Geheimes Ehrenbuch des Fuggerschen Geschlechts“ 1545/47, Zeichnung von Jörg Breu d.J, Fuggermuseum Schloss Babenhausen
Vom Jahre 1411 an hatte Elisabeth Fugger ihre Mutter bei sich wohnen, welche 3 Gulden Steuer an die Stadt bezahlte. Ihr Tod ließ die Steuer der Tochter von 24 Gulden auf 26 Gulden ansteigen. 1428 versteuerte Elisabeth ein Vermögen von 3960 Gulden, am Ende ihres Lebens sogar 5000 Gulden.
"Am 8. November 1414 bekannt die Witwe Elsbeth Fugger, vom Augsburger Dominikanerkloster St. Katharina einen Garten vor dem Gögginger Tor, den sie zu Lebzeiten besessen, als Zinslehen erhalten zu haben".
In den Missivbüchern der Stadt Augsburg findet sich Elisabeth Fugger im Jahre 1423 erwähnt. Auf Ersuchen seiner Bürgerin, der Fuggerin, verwandte sich der Rat der Stadt für einen ihrer Hintersassen zu Burtenbach bei Ritter Hans von Knöringen.
In der Ausstellung "Fugger und WeIser" in Augsburg 1950 wurde eine im Antiquariatshandel kurz vorher wieder aufgetauchte Urkunde gezeigt, die sich aus der Generation des Einwanderers Hans Fugger und seiner zweiten Frau erhalten hat. Die Urkunde gibt Einblick in das ausgedehnte ländliche Grundvermögen und besiegelt den Verkauf einer Hofstatt zu Hiltenfingen durch Elsbeth Gfattermann und ihre Söhne Andreas und Jakob Fugger.
Aus der ersten Ehe des Hans Fugger mit Clara Widolf stammten die Töchter Kunigunde, die ledig blieb, und Anna Fugger, die etwa 1384 mit Conrad Meuting, einem Weber, verheiratet wurde.