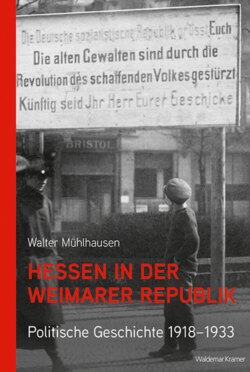Читать книгу Hessen in der Weimarer Republik - Walter Mühlhausen - Страница 10
3. Auftakt der Demokratie
ОглавлениеTrotz des umfassenden Krisenmanagements in der problembeladenen Zeit des Umbruchs wurden grundlegende Reformen umgesetzt, die man im Kreise der neuen Machthaber für unabdingbar und zudem für konsensfähig unter den demokratischen Kräften hielt. Der Achtstundentag, das zentrale sozialpolitische Ziel der Arbeiterbewegung, wurde sogleich am 12. November vom Berliner Rat der Volksbeauftragten reichsweit verordnet. Darüber hinaus wurden mit der gleichzeitigen Verfügung von Frauenwahlrecht und Verhältniswahlsystem Pfeiler der Demokratie gesetzt.
Diese neuen wahlrechtlichen Prinzipien schlugen sich auch in der von der Darmstädter Revolutionsregierung am 3. Dezember 1918 erlassenen „Verordnung über die Wahlen für die verfassunggebende Volkskammer der Republik Hessen“ nieder, die – 73 Artikel umfassend – mit Gesetzeskraft in ihren Bestimmungen dem Gesetz zu den Wahlen der reichsweiten Nationalversammlung folgte.120 Wählen durften nunmehr Männer und Frauen über 20 Jahre; errechnet wurde die Mandatszahl der jeweiligen Partei auf der Grundlage der Verhältniswahl, wobei das Land einen einzigen Wahlkreis bildete. Von nun an fiel keine Stimme mehr unter den Tisch, wie das beim reinen Mehrheitswahlrecht des Kaiserreichs der Fall gewesen war, weil die Stimmen der unterlegenden Kandidaten auf keiner Landesliste angerechnet wurden, wo weitere Mandate verteilt worden wären. In monarchischer Zeit, als die SPD politisch ausgegrenzt worden war, sah sie sich spätestens bei der Stichwahl einem einheitlichen bürgerlichen Block gegenüber, so dass das auch bei den Reichstagswahlen geltende Mehrheitswahlrecht die Sozialdemokratie stark benachteiligte. Das Verhältniswahlrecht galt als wesentlich gerechter, auch weil es kleineren Parteien ermöglichte, Mandate zu erzielen. Denn eine Prozenthürde, die man überspringen musste, um Sitze zu erringen, wurde nicht eingeführt, was wiederum die Zersplitterung der Parlamente förderte. Die Legislaturperiode im Volksstaat wurde auf drei Jahre begrenzt.
Mit der Demokratisierung des Wahlrechts stieg die Zahl der Wahlberechtigten auf fast 59 Prozent der Bevölkerung, knapp drei Mal so viel wie nach der halbherzigen Wahlrechtsreform von 1911. So erfolgten am 26. Januar 1919 – eine Woche nach den Wahlen für die Nationalversammlung – die ersten demokratischen Landtagswahlen in Hessen (-Darmstadt). Bürgerinnen und Bürger bestimmten die Zusammensetzung der Volkskammer. Ursprünglich sollte das Wahlgesetz auch eine Wahlpflicht enthalten. Doch das wurde gestrichen, offenkundig, so überliefert der juristische Berater von Regierung und Parlament in Sachen Verfassungsschöpfung, der Gießener Staatsrechtler Hans Gmelin, „weil die Sozialdemokraten keine Veranlassung hatten, die erhoffte Lauheit der bürgerlichen Wähler abzuschwächen“.121 Die SPD war sich der hohen Mobilisierung ihres Klientel sicher, während viele im Bürgertum sich in einer an Apathie grenzenden Orientierungslosigkeit befanden.
Die SPD sollte mit dieser Einschätzung Recht behalten. Denn bei einer Wahlbeteiligung von 81 Prozent kam sie auf 44,5 Prozent, gefolgt von den fast gleichstarken Parteien DDP (18,9 Prozent) und Zentrum (17,6 Prozent). Die USPD rangierte mit 1,5 Prozent nahe der Bedeutungslosigkeit, während die beiden Rechtsparteien, die DVP (10,1 Prozent) und die Hessische Volkspartei (HVP) als Landesverband der republikfeindlichen DNVP (Deutschnationale Volkspartei; 7,4 Prozent), gemeinsam ein Sechstel der Wählerschaft auf sich vereinigen konnten. Von den 70 Abgeordneten der hessischen Volkskammer kamen 31 von der SPD, je 13 von der Demokratischen Partei und vom katholischen Zentrum, sieben von der DVP, fünf von den Deutschnationalen und einer von der USPD.122
Wie im Volksstaat, so wurde auch in Preußen der Landtag am 26. Januar 1919 gewählt. In der Provinz Hessen-Nassau lag dabei die SPD mit 40,2 Prozent weit vorn (DDP 21,6, Zentrum 18,9, DVP 6,2 und DNVP 9,6 Prozent). SPD und DDP erzielten in der Provinz signifikant einen höheren Stimmenanteil als im Landesschnitt (dort 36,4 bzw. 16,2 Prozent). Die USPD blieb hier mit 3,5 Prozent unbedeutend, während sie im gesamten Preußen immerhin 7,4 Prozent einfuhr. Im radikalen Hanau erreichte die USPD jedoch den Spitzenwert in Hessen-Nassau mit etwa einem Viertel der Wähler. Von den 22 hessen-nassauischen Vertretern in der preußischen Landesversammlung gehörten neun der SPD, je fünf der DDP und dem Zentrum, zwei der DNVP und einer der DVP an.123 Waldeck-Pyrmont zog erst am 8. April 1919 mit den Wahlen zur „verfassunggebenden Waldeck-Pyrmonter Landesvertretung“ nach; das Resultat nach Sitzen: SPD 7, DNVP 6, DDP 4, Waldeckscher Volksbund 3 und DVP 1.124
Mit den Landtagswahlen wurden in Hessen und in Preußen die Ergebnisse der Voten zur Nationalversammlung eine Woche zuvor bestätigt. In allen hessischen Gebieten hatte dabei die SPD dominiert: mit beachtlichen 47 Prozent im Volksstaat, 44 Prozent im Regierungsbezirk Kassel und 37 Prozent im Regierungsbezirk Wiesbaden sowie 39 Prozent in Waldeck. Ihr folgte die linksliberale DDP – mit jeweils zwischen 19 Prozent und 23 Prozent –, während die Zentrumspartei in den katholischen Gebieten wie Fulda sehr gute Ergebnisse vorweisen konnte. Im Vergleich zu den letzten Reichstagswahlen 1912 brachten die ersten in der Republik doch Verschiebungen zugunsten der SPD, aber auch zugunsten des Linksliberalismus, der DDP.125 Das preußische Hessen-Nassau, das wie auch der Volksstaat Hessen in der gesamten Weimarer Zeit einen der zunächst 37 (später 35) Großwahlkreise – unter Einschluss des Freistaates Waldeck und des Kreises Wetzlar – bildete126, schickte 15 Mandatsträger in die im thüringischen Weimar tagende Nationalversammlung: sieben von der SPD, je drei von DDP und Zentrum sowie je einen aus DVP und DNVP. Neun kamen aus dem ebenfalls einen Wahlkreis bildenden gesamten Volksstaat, und zwar vier von der SPD, je zwei von DDP und Zentrum sowie einer der DVP.127 Eine herausgehobene Rolle bei den Verfassungsberatungen in Weimar spielte der Frankfurter Sozialdemokrat Max Quarck als einer von zwei stellvertretenden Vorsitzenden des 28-köpfigen Verfassungsausschusses.
Versammlung der SPD im Januar 1919 auf dem Frankfurter Römerberg zu den Wahlen für die verfassunggebende preußische Landesversammlung.
Die bürgerlichen Parteien hatten auch in Hessen einen verspäteten und schmerzvollen Gründungsprozess durchlaufen. Während die Sozialdemokratie den Umbruch als Chance für die Realisierung der Demokratie verstand und entschlossen zugriff, haderte das Bürgertum lange mit der Kriegsniederlage. Vom Trauma des Zusammenbruchs des Kaiserreichs erholte sich die bürgerliche Mitte nur langsam. Die „Frankfurter Volkszeitung“ als Sprachrohr des politischen (Links-)Katholizismus schrieb im Jahresrückblick auf 1918, man habe „vier Jahre vergebens gehofft, gekämpft, gelitten und geopfert“ und stehe nun vor einem Trümmerhaufen. Obwohl das katholische Bürgertum in Frankfurt bis zuletzt für die Monarchie eingetreten war, vollzog die dortige Zentrumspartei doch schneller als im Rest des Reiches die Hinwendung zur Republik.128
Die rechtsliberale DVP vertiefte mit der Verweigerung eines klaren Bekenntnisses zur Demokratie den Graben zur weiter linksstehenden Konkurrenz DDP und entzog damit jeglichen Gedanken an eine geeinte liberale Partei gänzlich den Boden – wie im gesamten Reich. Im ehemaligen Großherzogtum prangerte die sich pointiert vaterländisch gebende DVP das Zusammengehen der am 28. November 1918 gegründeten Demokratischen Partei mit der SPD scharf an.129 Demgegenüber förderten in antidemokratischer Grundhaltung die Deutschnationalen, die nach Wochen politischer Apathie erst Mitte Dezember 1918 begannen sich zu formieren, antisemitisches Denken. Dabei setzte sich bei vielen wie beim freikonservativen Marburger Professor und preußischen Landtagsabgeordneten Johann Victor Bredt bald die Erkenntnis durch, dass eine gewaltsame Restauration der Monarchie nicht möglich sei, man sich daher mit dem Neuartigen abzufinden und sich konstruktiv politisch betätigen sollte. Er tat dies zunächst in der DNVP.130
Bei den ersten Wahlen 1919 lag das rechtsorientierte Bürgertum noch in der durch den revolutionären Umbruch vom November 1918 ausgelösten politischen Schockstarre, rangen seine Organisationen noch um Profil, Mitglieder und Wähler. Demgegenüber konnte sich die Sozialdemokratie auf eine bewährte Funktionärselite und einen eingespielten Organisationsapparat stützen, um ihre mit der Revolution gewonnene Macht zu nutzen. Dort, wo die SPD bereits vor 1918 stark gewesen war, festigte sie sich noch weiter. Es nahm selbst für eine bäuerliche Tageszeitung in Friedberg kaum Wunder, dass der Unmut über das Vergangene, „der verlorene Krieg und alles, was damit zusammenhängt, den Sozialdemokraten“ zugutekam.131 Dabei fällt auf, dass die durch den Umbruch verunsicherten evangelischen Wähler, zuvor zu weiten Teilen Klientel der antisemitischen Parteien, zur Sozialdemokratie tendierten. Das führte in den Kreisen des Regierungsbezirks Kassel, wo bis 1918 die nun nicht mehr antretenden Antisemiten dominierten, zu signifikanten Wanderungen zur SPD (46,6 Prozent) und zur DDP (20,7 Prozent), ein Trend, der sich aber schon 1920 bei den nächsten Reichstagswahlen wieder in Richtung der alten Kräfteverhältnisse umkehrte, eben zu einer Stärkung von nationalkonservativer DNVP und rechtsliberaler DVP führte. Dagegen offenbarte der Regierungsbezirk Wiesbaden trotz eines leichten Zuwachses der SPD (36,7 Prozent) Kontinuität des Parteien- und Wählerspektrums; DDP (23 Prozent) und Zentrum (22,2 Prozent) lagen dort bei den Wahlen zur Nationalversammlung 1919 auf gleicher Höhe.132
Auch die nach der Verhältniswahl durchgeführten ersten Kommunalwahlen in Hessen-Nassau am 2. März 1919 bestätigten die Tendenzen – mit einigen bemerkenswerten Ergebnissen wie in der bürgerlich geprägten Universitätsstadt Marburg, wo die antirepublikanische DNVP mit 15 Stadtverordneten DDP (acht) und SPD (fünf) auf Distanz hielt. Bei den örtlichen Wahlen erlebte die DDP ein „Desaster“, verlor im Vergleich zu den Wahlen vom Januar die Hälfte ihrer Wähler, was nur noch von der SPD mit einem Verlust von 55 Prozent überboten wurde.133 Im katholischen Fulda konnte das Zentrum 20 der insgesamt 36 Mandate für sich verbuchen. Die Bischofsstadt, wo das katholische Milieu Weltkrieg und Revolution überdauerte, erlebte einen Einschnitt der besonderen Art, obwohl die Dominanz der Zentrumspartei weiter bestehen bleiben sollte: Nach fünfzig Jahren saßen nicht mehr nur allein Vertreter der katholischen Partei, sondern erstmals auch anderer Parteien im Stadtparlament, darunter je fünf von SPD und DDP.134 Kassel blieb eine sozialdemokratische Hochburg mit knapper absoluter Mehrheit von 37 der insgesamt 70 Stadtverordneten. Ähnlich dominierte das Zentrum im katholischen Limburg. Die SPD führte in Frankfurt deutlich mit 36 vor der DDP mit 23 Mandaten (bei insgesamt 96 Stadtverordneten), besaß aber auch mit der USPD (acht) keine Mehrheit. Die Weimarer Koalition vereinigte immerhin 72 Sitze auf sich. In Wiesbaden rangierte die SPD doch recht knapp mit 16 Mandaten an der Spitze, gefolgt von den gleichstarken DVP und DDP mit 14 der insgesamt 60 Sitze. Im linken Hanau belegte die USPD mit 29 Prozent Platz eins vor der DDP mit 27 Prozent und der SPD mit 25 Prozent (DVP 12 Prozent und Zentrum 8 Prozent). Von den 42 Sitzen belegten USPD und DDP je zwölf, die SPD elf.
Demokratieaufbau im Zeichen der Besetzung: französische Soldaten auf dem Schlossplatz von Wiesbaden.
Bei den ersten Nachkriegskommunalwahlen im volksstaatlichen Darmstadt am 15. Juni 1919 lagen DVP mit 17 und SPD mit 16 Mandaten (von 60) vorn, gefolgt von der DDP mit 11 (USPD fünf; Zentrum vier; Hessische Volkspartei mit Handwerks- und Gewerbevereinigung sieben). In Offenbach rangierte die SPD mit 32 Prozent vor USPD mit 24 Prozent und DDP mit 19 Prozent (Zentrum 14 und DNVP 10 Prozent).
Wo die SPD die Mehrheit besaß, wollte sie dies auch in politische Ämter ausgezahlt wissen. Ein Beispiel: Trotz wütender Proteste sämtlicher bürgerlicher Parteien nominierte die mit knapper absoluter Mehrheit ausgestattete Kasseler SPD im Dezember 1919 den vormaligen Reichsministerpräsidenten Philipp Scheidemann in der Nachfolge des im Oktober zum Reichsinnenminister beförderten Liberalen Erich Koch-Weser als neuen Oberbürgermeister.135 Die SPD ließ nicht mit sich handeln, hatte es sich doch seit der Revolution gerade auch in Nordhessen gezeigt, dass sich ihre politische Dominanz, wie sie in den äußerst guten Ergebnissen bei sämtlichen Wahlen am Anfang der Republik (in Reich, Land und Gemeinde) zum Ausdruck kam, nicht entsprechend auch in der Übernahme politischer Ämter niederschlug.
Im Sommer 1919 waren der in Kassel residierende Oberpräsident August von Trott zu Solz und auch der dortige Regierungspräsident Percy Graf von Bernstorff ausgeschieden, beide noch in der Kaiserzeit berufen (1917 bzw. 1905). Der Oberpräsident stand an der Spitze der Provinz, war Vertreter des Staatsministeriums und sollte „Brücke und Mittler“ zwischen Provinz und Zentralregierung sein.136 Die Regierungspräsidenten waren mit ihren Behörden die eigentlichen Träger der Landesverwaltung in den preußischen Mittelinstanzen. Der Dualismus von Oberpräsident und Regierungspräsident, besonders wenn diese an einem Ort wie in Kassel saßen und zudem unterschiedlichen politischen Lagern angehörten, mochte sich mitunter als unvorteilhaft erweisen.137 Das sollte schon 1919 der Fall sein, denn an die Stelle von Trott zu Solz und Bernstorff traten, von der preußischen Regierung in Berlin eingesetzt, mit Rudolf Schwander als erster Beamter in der Provinz Hessen-Nassau zum 8. Juli ein Mann der DDP und mit Gustav Springorum als Chef im Regierungsbezirk Kassel zum 1. Oktober ein Vertreter des bürgerlich-nationalen Lagers. Schwander war 1918 der letzte deutsche Statthalter in Elsass-Lothringen gewesen. Er blieb bis 1930, als ihm der Sozialdemokrat August Haas folgte, der 1932 im Zuge des Preußenschlags abgesetzt wurde. Nach Springorum kam der höchst unglücklich agierende, rechtskonservative Otto Stoelzel, der nach nur einem Jahr abberufen und durch den DDP-Mann Ferdinand Friedensburg ersetzt wurde.
Springorum war vor seiner Berufung nach Kassel stellvertretender Regierungspräsident in Wiesbaden gewesen. Dort war er von den Franzosen wegen Widerstand gegen ihre Anordnungen verhaftet, verurteilt und ausgewiesen worden. An der Spitze des Regierungspräsidiums Wiesbaden folgte auf den weithin als „Freund des Kaisers“ geltenden Regierungspräsidenten Wilhelm von Meister138, seit 1905 an dieser Stelle, der kaiserliche Karrierebeamte Wilhelm Momm, der sein Amt erst im März 1920 antreten konnte und im August 1922 von der Interalliierten Rheinlandkommission seiner Funktion enthoben wurde. Ende Januar 1923 folgte der ehemalige preußische Minister Konrad Haenisch von der SPD. Nach Haenischs frühem Tod 1925 im Alter von 49 Jahren trat der Polizeipräsident von Frankfurt, der Sozialdemokrat Friedrich (Fritz) Ehrler, an seine Stelle – bis 1933.
Von zehn Landratsposten, die seit dem Umsturz bis zum Ende des Jahres 1920 in den Kreisen des Regierungsbezirks Kassel frei wurden, sollte die SPD nur drei besetzen können. Viele der königlich-preußischen Landräte, die nach der Revolution zumeist zur republikfeindlichen DNVP stießen, hielten sich im Amt, wie der im August 1918 im überwiegend katholischen Kreis Hünfeld bestallte Walter Ludwig (bis 1935) oder sein 1907 berufener Kollege Gottfried Rabe von Pappenheim im sozialdemokratischen dominierten Kreis Kassel (bis 1930), der dann Landeshauptmann des Bezirksverbandes im Regierungsbezirk Kassel wurde und bis 1936 blieb. Die Neugestaltung mit einer Demokratisierung der Gebietskörperschaften führte dazu, dass das Vorschlagsrecht für die Besetzung der freiwerdenden Landratsposten von den Kreistagen als nunmehr demokratisch konstituierten Gremien gegenüber dem preußischen Ministerium mehr Gewicht besaß, das jedoch auch weiterhin nicht an einen Vorschlag gebunden war. Der Kreistag besaß nicht das Recht, über ein Misstrauensvotum einen Landrat zu verbannen.139 Wegen der veränderten Lage in den Kreistagen traten einige im Kaiserreich berufenen Landräte von sich aus zurück, darunter im Regierungsbezirk Kassel 1919 jene von Hofgeismar (Georg Riedesel zu Eisenbach, seit 1908 im Amt) und Eschwege (Alexander von Keudell, seit 1893), 1921 von Fulda (Karl von Dörnberg, seit 1912) und Hersfeld (Alexander von Grunelius, seit 1905) sowie 1922 von Fritzlar (Heinrich Noeldechen, seit 1890). Für Hessen-Nassau ist insgesamt eine geringe Zahl festgestellt worden, die nach der Revolution gegen ihren Willen aus ihrem Amt verdrängt wurde.
Als der seit 1910 amtierende Landrat von Kirchhain, Adolf von und zu Gilsa, ein Vertreter des rechtskonservativen Spektrums, 1928 vom Regierungspräsidenten Ferdinand Friedensburg (DDP) aus dem Amt geworfen wurde, weil er paramilitärische Treibereien in seinem Kreis geduldet hatte und somit untragbar geworden war, brach ein Sturm der Entrüstung über Friedensburg herein, der erst im März 1927 nach Kassel gekommen war. Friedensburg holte andererseits den Landrat von Schlüchtern, Bodo von Trott zu Solz, der in der Kritik stand, ein Monarchist zu sein, und darüber hinaus schlicht als unfähig galt, aus der Schusslinie und bot ihm 1927 im Regierungspräsidium Unterschlupf. 1933 hievten die Nationalsozialisten Gilsa auf den Landratsposten in Schüchtern (wo er bis 1945 blieb) und machten Trott zu Solz kurzzeitig zum kommissarischen Landrat in Hersfeld.140 Es scheint augenfällig, dass die neuen Machthaber über kein ausreichendes Reservoir an geschulten Verwaltungskräften, gar mit Führungsqualitäten verfügten, um das alte aus der Kaiserzeit kommende Personal gegen republiktreue Köpfe auszutauschen. Das galt auch für den Vertreter Hessen-Darmstadts beim Reich: Staatspräsident Ulrich bat den seit 1911 als Gesandten in Berlin amtierenden Maximilian Freiherr von Biegeleben, weiter die Interessen des Landes gegenüber der Reichsregierung und im Reichsrat wahrzunehmen. Biegeleben blieb bis 1927.141
Trotz des revolutionären Umbruchs und einer stärkeren Politisierung im kommunalen Raum mit dem vollkommenen Ende der bereits zuvor im Kaiserreich schrittweise schwindenden Honoratiorenherrschaft wurde doch nur eine geringe Zahl von Bürgermeisterstellen mit Sozialdemokraten besetzt, während auf der anderen Seite die SPD in Reich und Ländern zahlreiche Regierungen führte und Minister stellte. So sollte der im Dezember 1919 gegen eine einheitliche bürgerliche Front in Kassel zum Stadtoberhaupt gewählte Philipp Scheidemann bis 1933 der einzige Sozialdemokrat unter den hessen-nassauischen Oberbürgermeistern bleiben.142 Das war so nicht zu erwarten gewesen und überraschte letztendlich.
In der hessischen Landeshauptstadt Darmstadt überdauerte der seit 1909 amtierende Wilhelm Glässing den Umsturz, bis er nach 20 Jahren im Amt 1929 verstarb. Sein um zwei Jahre jüngerer Bruder, der 1913 zum Oberbürgermeister von Wiesbaden berufene parteilose Karl Glässing, behielt sein Amt, bis ihn die Franzosen 1919 ohne nähere Begründung für abgesetzt erklärten und auswiesen – ein Akt, den die Interalliierte Rheinlandkommission in Koblenz sanktionierte und gegen den der Einspruch der Stadt zunächst erfolglos blieb. Glässing empörte sich bei Reichsinnenminister Erich Koch-Weser über den Gewaltakt, den hinzunehmen, so der Wiesbadener Stadtobere, zwangsläufig zu einer Demoralisierung der Bevölkerung in den besetzten Gebieten führen müsse.143
In Frankfurt blieb der 1912 auf zwölf Jahre gewählte (links-)liberale Georg Voigt, der sich – preußisch-korrekt – just am 9. November 1918 vom Arbeiter- und Soldatenrat im Amt hatte bestätigen lassen, bis 1924 an der Spitze des Rathauses, als ihn sein DDP-Parteikollege Ludwig Landmann ablöste und er im Jahr darauf zum Oberbürgermeister im beschaulicheren Marburg gewählt wurde. In Offenbach änderte sich ebenfalls zunächst nichts: Der seit 1907 amtierende liberale Andreas Dullo, seinerzeit auch von den Sozialdemokraten gewählt, blieb, musste aber dann, weil der SPD sein Agieren in der Revolutionszeit missfiel, bald gehen. Ihm folgte im November 1919 der SPD-Mann Max Granzin.144 In dem von einer starken linksorientierten Arbeiterbewegung geprägten Hanau lenkte mit Kurt Blaum (DDP), auch von den Sozialdemokraten gewählt, erst ab Dezember 1921 in der Nachfolge des 1917 berufenen liberalen Karl Hild ein neuer Mann die Geschicke der Stadt. In Wetzlar sollte der 1914 gewählte Bürgermeister Heinrich Kühn bis zu seinem Tod 1930 im Amtssessel bleiben, obwohl die SPD von 1919 bis 1933 die stärkste Fraktion stellte. In Bensheim beschloss der Arbeiterrat im ersten Revolutionsmoment den seit 1913 amtierenden, zum Kriegsdienst eingezogenen Bürgermeister Karl Löslein alsbald abzusetzen, wogegen sich dieser nach Rückkehr aus dem Feld vehement wehrte, so dass Ministerpräsident Ulrich eigens im Februar zu Schlichtungsverhandlungen anreiste, die in einer Wiedereinsetzung Lösleins, allerdings mit Verzicht auf einige Kompetenzen zugunsten seines Stellvertreters, mündeten.145 Insgesamt jedoch zeigte sich im regionalen Raum überdeutlich, dass die Revolution keinen fundamentalen Elitenwechsel auf den unterschiedlichen Verwaltungsebenen gebracht hatte. Diese im Sinne einer Republikanisierung durchzuführen, war Aufgabe der kommenden, durch Wahlen legitimierten Regierungen und Körperschaften.
Die drei führenden Parteien bei der ersten Landtagswahl im Volksstaat – SPD, DDP und Zentrum –, hinter denen immerhin mehr als 80 Prozent der Wähler standen, setzten ihre Zusammenarbeit unter Ministerpräsident Carl Ulrich fort. SPD und DDP hätten auch allein mit ihren 44 Mandaten über eine recht komfortable Mehrheit verfügt, doch beharrten die Liberalen auf Einbezug der bislang mitregierenden Zentrumspartei, um mit deren 13 Abgeordneten der übermächtigen SPD Paroli bieten zu können. Bereits vor der am 13. Februar 1919 erfolgenden Konstituierung des Landesparlaments erklärte sich der revolutionäre Volksrat der Republik Hessen für aufgelöst und übergab seine Rechte den nun gewählten Vertretern.146 Der Dualismus zwischen provisorischer Regierung und revolutionärer Macht war damit beendet. In Preußen bildete der bisherige Ministerpräsident Paul Hirsch (SPD) nach den ersten Landtagswahlen eine Regierung der Weimarer Koalition, wie im Reich gestützt auf eine breite Mehrheit.
In ihrer Struktur unverändert blieben zunächst die Selbstverwaltungsorgane in der preußischen Provinz und in den beiden 1867 geschaffenen Regierungsbezirken. Es war eine Besonderheit, dass nach der preußischen Annexion des Herzogtums Nassau, des Kurfürstentums Hessen und der Freien Reichsstadt Frankfurt in der neuen Provinz für jedes der drei Gebiete ein Kommunalverband (und nicht wie in jeder preußischen Provinz nur ein Verband) geschaffen wurde. 1885 wurden sie auf zwei Bezirksverbände, Kassel und Wiesbaden, reduziert. An der Spitze der Verwaltung stand der Landeshauptmann. Den Kommunalverbänden oblagen in Selbstverantwortung bestimmte Bereiche (u. a. Straßenbau, Landesbanken und -versicherungen, Landeskrankenhäuser und Landesheilanstalten).147 Die Organisationen blieben im Umbruch unangetastet. Ihre parlamentarischen Vertretungen, die beiden Kommunallandtage, sollten dann 1920 erstmals nach den neuen Wahlrechtsprinzipien, zunächst direkt von den Stadtverordnetenversammlungen und Kreistagen, neu gewählt werden. Weiterhin bestand als gemeinsame Klammer und als ein lockeres Dach über den Regierungsbezirken der aus sämtlichen Vertretern beider Kommunallandtage beschickte Provin- ziallandtag.148
Nach Krawallen in Kassel am 21. Juni 1919: geplünderte Geschäfte.
Auf örtlicher Ebene existierten manche Arbeiter- und Soldatenräte als Ordnungsorgane über die Wahlen hinaus. Sie trugen wesentlich zur Sicherung und Stabilisierung der neuen Machtverhältnisse bei. Gleichwohl sollten dann im Frühjahr 1919 Unruhen folgen, wie etwa in Frankfurt Ende März, als es nach einer Senkung der Kartoffelration von fünf auf drei Pfund pro Woche und Kopf zu Plünderungen und Ausschreitungen mit 20 Toten kam. Die Mainmetropole erlebte dann im Juni 1919 Arbeitslosendemonstrationen. Auch in Kassel folgten Krawalle, die sich an der Weigerung eines Händlers entzündet hatten, Eier zum festgesetzten Richtpreis zu verkaufen. Am Ende waren vier Tote zu beklagen.149 Nach Plünderungen, auch von Waffen und Munition in Hanau wurde die Stadt, von linken und linksradikalen Kräften beherrscht, von Regierungstruppen im Februar 1919 kampflos besetzt.150
Es herrscht Ruhe in Hanau: Nach Unruhen und Plünderungen im Februar 1919 besetzen Regierungstruppen für einige Tage die Stadt (hier am Neustädter Markt). Zu Kämpfen kommt es nicht.
In sozialer Hinsicht hielt die Anspannung noch lange an. Die Lage verschärfte sich im Zuge von Inflation und Wirtschaftskrise. Die dauerhafte Versorgungskrise im ersten Nachkriegsjahr lässt sich allein daran ablesen, dass in den Monaten von März bis Juni 1919 nur ein Achtel des festgelegten Kontingents an Kohlen nach Frankfurt geliefert wurde.151 Politisch festigte sich die Situation jedoch recht rasch. So blieb der Offenbacher Karfreitagsputsch am 18. April 1919, als die von den Kommunisten angeführte radikale Linke gewaltsam die Macht an sich reißen wollte, letztlich eine gescheiterte Episode, die jedoch mit 17 Toten und 26 Verwundeten einen hohen Blutzoll forderte.152 Der Putsch war – für Hessen – der Höhepunkt der zweiten Welle der Revolution, die in den Zentren Berlin, wo es im Frühjahr zu bürgerkriegsartigen Unruhen kam, und München, wo eine linkssozialistisch-kommunistische Räterepublik von Regierungstruppen niedergeschlagen wurde, einen ungleich blutigeren Verlauf nahm.
Karfreitagsputsch in Offenbach am 18. April 1919: Demonstranten versuchen, die Stadtkaserne zu stürmen. Am Ende sind 17 Tote zu beklagen.
Die Demokratie war geboren; sie musste nun reifen, ausgebaut werden und sich festigen. Am 11. November 1918 hatte der hessen-darmstädtische Arbeiter-, Bauern- und Soldatenrat in einem Aufruf verkündet: „Die Vergangenheit ist abgeschlossen. Das Tor der Zukunft steht weit offen.“153 Die Vergangenheit war politisch tatsächlich abgeschlossen, doch überlebten rückwärtsgewandte Einstellungen und Mentalitäten, die die Republik bedrücken sollten. Insofern stand das Tor der Zukunft nicht weit offen. Viele politische Altlasten mussten mit in die Demokratie genommen werden; sie konnten nicht einfach entsorgt werden. Demokratie und demokratisches Denken und Handeln musste bei vielen erst reifen, denn antidemokratisches Gedankengut überdauerte die Zäsur von 1918/19. Doch zunächst ging es darum, den neuen Freistaaten Verfassungen zu geben, die das neue Staatsgebilde strukturierten und einen Orientierungs- und Wertmaßstab für das Zusammenleben in der Republik lieferten.
Das Ständehaus in Darmstadt – Sitz des Landtages bereits in Zeiten des Großherzogtums und nun auch in der Republik.