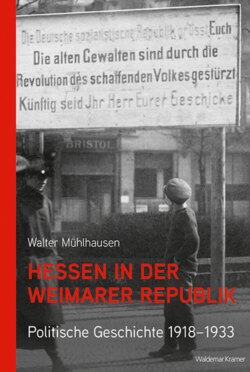Читать книгу Hessen in der Weimarer Republik - Walter Mühlhausen - Страница 8
1. Kriegslasten, Friedenssehnsucht und Demokratieerwartung
ОглавлениеAls im August 1914 der vom Deutschen Kaiserreich wesentlich verschuldete Erste Weltkrieg ausbrach, sorgte eine allgemeine Siegeszuversicht für einen weite Kreise der Bevölkerung erfassenden Jubel. Der überwiegende Teil der Deutschen war sich sicher, dass die Truppen spätestens zu Weihnachten wieder Zuhause sein würden, und zwar siegreich. Das sollte sich als Irrtum herausstellen, denn erst vier Jahre und drei Monate später endete der Krieg – mit der Niederlage Deutschlands. Mehr noch: Die Monarchie stürzte im November 1918. An ihre Stelle trat umgehend die Republik.
Das „Augusterlebnis“ sorgte bei vielen für ein Gefühl der Schicksalsgemeinschaft, der Einigkeit und Einheit über die Parteigrenzen und gesellschaftlichen Milieus hinweg.15 Es hielt nicht lange. Auch das bei Kriegsausbruch 1914 von offizieller Seite gezeichnete und sich in vielen Fotografien widerspiegelnde Bild vom Kriegstaumel übertünchte, dass sich, vor allem in den Arbeiterhaushalten, auch Angst vor der ungewissen Zukunft und Sorge um die ins Feld ziehenden Männer und Söhne breitmachte. Mit der in den ersten Wochen vorherrschenden Begeisterung über die militärischen Anfangserfolge war es bald vorbei. Denn das „Feld der Ehre“ wurde bald zum Massengrab für Hunderttausende. In den später an öffentlichen Gebäuden aushängenden Verlustlisten konnte dann nachgelesen werden, wen die menschenfressende Kriegsfurie hinweggerafft hatte. Für das heutige Hessen gibt es keine zuverlässigen Zahlen: Allein Frankfurt hatte 10.700 Kriegstote zu beklagen, für das Großherzogtum Hessen wurden 32.500 tote Soldaten errechnet, ein Achtel der Männer, die bei der Volkszählung 1910 zwischen 15 und 40 Jahren gewesen waren. Insgesamt ging die Bevölkerungszahl zwischen 1914 und 1919 wegen der Kriegsopfer und niedriger Geburtenraten zurück.
Im Krieg gesellte sich zur Sorge einer jeden Familie um die an der Front kämpfenden Angehörigen noch eine seit 1916 steigende Ernährungsnot.16 Seit Beginn des Jahres 1915 waren einige Grundnahrungsmittel wie Brot und Mehl nur noch über Karten zu bekommen; 1916 betraf dies auch Butter, Milch, Käse und Eier. Im Sommer 1916 versorgten etwa 30 Kriegsküchen in Darmstadt ca. 3.000 Bürger der Stadt. Der nachfolgende eisige Winter ging als Kohlrübenwinter in die Geschichte ein.
Am 7. August 1914 zieht das Leibgarde-Infanterie-Regiment 115 von Darmstadt aus in den Krieg – unter großer Beteiligung der Bevölkerung, aber ohne Jubelszenen, die Bilder aus anderen Orten vermitteln.
Die von Hunger und Kälte getriebene Stadtbevölkerung versuchte, sich durch „Hamstern“ auf dem Land und durch „Schleichhandel“ das Nötigste zu beschaffen. Mit zunehmender Versorgungskrise wuchs das Misstrauen zwischen Land- und Stadtbevölkerung. Mochte es auf dem Land graduell ein wenig besser aussehen, so sank die Stimmung in der Heimat schließlich auf den Nullpunkt. 1916 kam es vereinzelt zu Lebensmittelunruhen, zu ersten Ausschreitungen bei der Nahrungsmittelausgabe. Der Hunger führte zum „Zerfall der Staatsautorität“.17 Im Frühjahr 1917 folgten wegen der Herabsetzung der Brotration – wie im ganzen Reich – auch in Hessen lokale Streiks und Demonstrationen gegen die zunehmend schlechter werdende Ernährungslage. Es häuften sich Gerüchte über Unregelmäßigkeiten bei der Lebensmittelverteilung, Korruption und Besserstellung der Verantwortlichen. Das waren untrügliche Zeichen, dass die Einheit der Kriegsgesellschaft aufzubrechen drohte. Der Wiesbadener Regierungspräsident meldete im April 1917 nach Berlin: „Die Stimmung der Bevölkerung ist ernst, die Friedenssehnsucht groß, das Vertrauen zur Heeresleitung unerschüttert.“ Zur gleichen Einschätzung kam sein Kasseler Kollege. Zwar leitete der Wiesbadener seinen Quartalsbericht vom Oktober des Jahres mit dem Satz ein: „Die Bevölkerung ist nach wie vor vom felsenfesten Vertrauen auf die Oberste Heeresleitung erfüllt.“ Er musste aber sogleich einschränkend hinzufügen: „Immerhin darf nicht geleugnet werden, wie in manchen Schichten die Stimmung neuerdings gedrückter geworden ist.“ Als Grund führte er die Lebensmittelknappheit an. Im April hatte er „schon manche Zeichen von Unterernährung“ in den Städten und eine Zunahme der Todesfälle registriert.18 So hielt das Lebensmittelamt in Offenbach im März 1917 fest, dass es für viele Einwohner bereits „um Leben und Tod“ gehe.19 Auch wenn sich die Klassenspannungen verschärften und es örtlich zu eruptiven Protesten kam, blieb es insgesamt doch verhältnismäßig ruhig an der „Heimatfront“.
Auch die in Hessen an der Spitze der Gemeinden und Städte stehenden Kommunalpolitiker bemängelten das Versagen des Reiches in der Versorgung der Bevölkerung, beklagten die obrigkeitsstaatliche Bürokratie mit ihren extremen Effizienzverlusten, registrierten mit Unbehagen das scheinbar unaufhaltsame Vordringen der Militärbehörden in alle Lebensbereiche und in das Verwaltungshandeln, den enormen Machtzuwachs der militärischen Stellen im Bereich der Innenpolitik generell. Die Kriegsverwaltung durchdrang mit ihren Zwangsmaßnahmen das Leben in Stadt und Land – bis in jede Familie.
Der Kriegseinsatz in der Heimat verschaffte den im Kaiserreich ausgegrenzten Sozialdemokraten und Gewerkschaften Anerkennung, Letzteren im Besonderen mit dem Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienst vom Dezember 1916. Dadurch wurden die kriegstauglichen Männer bis zum 60. Lebensjahr zum Kriegsdienst außerhalb der Truppe herangezogen. In den Ausschüssen zur Steuerung der Personalreserven wirkten auch die Vertreter der Gewerkschaften mit, die so auf die innerbetrieblichen und überbetrieblichen Belange Einfluss nehmen konnten.20 Immer mehr ihrer Mitglieder gelangten in die kommunalen Ausschüsse, Kriegsämter und Kommissionen für Ernährung und Bewirtschaftung und konnten dort ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Die praktische Kommunalpolitik war ein ideales Exerzierfeld für die Zusammenarbeit zwischen den bürgerlichen Parteien und den Sozialdemokraten, ging es doch hier um die Krisenbewältigung vor Ort, um die Regulierung der Alltäglichkeiten, um die Beschaffung von Lebensmitteln und die Festsetzung von Höchstpreisen. Der Frankfurter Reichstagsabgeordnete Max Quarck (SPD) brachte das im Oktober 1916 auf einen Nenner: „Der Weltkrieg ist ein großer Demokrat. Während früher in Preußen ein Sozialdemokrat kaum Nachtwächter werden durfte, hat er uns die Beförderung von Sozialdemokraten zu Offizieren und die Mitregierung der Gewerkschaften in städtische und staatliche Wirtschaftsangelegenheiten gebracht.“21
Die Not wächst: Warteschlange vor einem Lebensmittelgeschäft in Wiesbaden.
Der Krieg wirkte bei der gesellschaftlichen Anerkennung der im Kaiserreich lange als Reichsfeinde ausgegrenzten Sozialdemokraten wie ein Katalysator, andererseits forcierte er den innerparteilichen Spaltungsprozess der SPD. Im April 1917 trennte sich nach langen internen Kämpfen die USPD aus Opposition gegen die Burgfriedenspolitik von der Mutterpartei. Im August 1914 hatte sich die SPD im Reich und in Hessen im Glauben an einen Verteidigungskrieg in die nationale Abwehrfront eingereiht und den „Burgfrieden“ geschlossen, mit dem man auf Aktionen gegen den Staat verzichtete. Gegen diese Stillhaltepolitik formierte sich eine immer größer werdende innerparteiliche Opposition, die zu Ostern 1917 den Schnitt vollzog und eine eigene Partei gründete. Damit war das Wirklichkeit geworden, was der auf dem rechten Flügel der SPD agierende Gießener Eduard David schon längst für notwendig erachtet hatte, nämlich die Burgfriedensgegner abzustoßen, das in seinen Augen den sozialdemokratischen Parteikörper schwächende „Geschwür“ herauszuschneiden.22
In Hessen war die neue linke Partei lokal vereinzelt zwar stark verankert (besonders in Hanau), rangierte aber insgesamt doch, wie die Wahlen von 1919 zeigen sollten, weit hinter der alten SPD, die bis in die letzten Kriegsmonate hinein die im August 1914 eingeschlagene Burgfriedenspolitik verteidigte, obwohl mit zunehmender Kriegsdauer die einst so geschlossen erscheinende Heimatfront kontinuierlich brüchiger wurde. Die Missstimmung offenbarte sich etwa in Frankfurt, als bei Nachwahlen zur Stadtverordnetenversammlung die Kandidaten der Linken in der SPD, die später zur USPD übergingen, gewählt wurden.23 In der Mainmetropole formierte sich um den führenden Metallgewerkschaftler und Parteilinken Robert Dißmann, seit 1912 Sekretär im hessen-nassauischen Agitationsbezirk, die neue Kerntruppe der USPD.24 Die Unabhängigen zogen Nutzen daraus, dass die von vielen in der Arbeiterbewegung so nachdrücklich geforderten politischen Reformen ausblieben. Denn zu mehr als unverbindlichen Absichtserklärungen war der Kaiser nicht zu bewegen.
In seiner Osterbotschaft 1917 kündigte Wilhelm II. zwar eine Änderung des Wahlrechts für das preußische Abgeordnetenhaus, der Zweiten Kammer des Landtages, an. Aber diese stellte er für die Zeit nach dem Krieg in Aussicht; „bei der Rückkehr unserer Krieger“25 sollte die grundlegende Reform durchgeführt werden, wobei das ungerechte Dreiklassenwahlrecht in Preußen (und auch andernorts), das die männlichen Wähler nach Steueraufkommen in drei Klassen teilte, überwunden und zudem die unmittelbare und geheime Wahl der Abgeordneten eingeführt werden sollte. Das preußische Wahlrecht benachteiligte die SPD enorm. So fielen bei den Wahlen zum preußischen Haus der Abgeordneten vor dem Krieg in Hessen-Nassau fünf Prozent der Wähler in die erste, 15 Prozent in die zweite und gar 80 Prozent in die dritte Abteilung. Da jede Abteilung die gleiche Anzahl an Abgeordneten nominierte, wog die Stimme eines in der Ersten Klasse Wählenden 16mal so viel wie die eines der Dritten Klasse zugeordneten Wählers.26 Und der sozialdemokratische Arbeiter mit geringeren Steuerzahlungen gehörte eben in die Dritte Klasse.
Im Gegensatz zu Preußen wurde im Großherzogtum 1911, das eine undemokratische Unterteilung der Wählerschaft nach Steuerlast nicht kannte, eine bescheidene Wahlrechtsreform durchgeführt. Hier galt die Verfassung von 182027, wonach sich die Landstände (Landtag) aus zwei Kammern zusammensetzten: Die Erste Kammer bestand aus erblichen (adligen) Vertretern, daneben weiteren, die kraft Amt einen Sitz hatten, sowie aus den vom Großherzog ernannten Mitgliedern. Die zunächst 50 Abgeordneten der Zweiten Kammer wurden gewählt, alle drei Jahre jeweils zur Hälfte. Der aus diesen zwei Kammern bestehende Landtag besaß zwar Mitwirkungsrechte bei der Gesetzgebung und bei der Budgetbewilligung, aber die Gesetzesinitiative lag bei der großherzoglichen Regierung. Die Volksvertreter konnten nur über Petitionen die Regierung zum Gesetzeshandeln auffordern; das Großherzogtum war eben „eine konstitutionelle Monarchie, keine parlamentarische“.28 Es blieb dabei: Der Monarch hatte „stets das letzte Wort“.29
Bei der Reform von 1911 trat an die Stelle der indirekten Wahl eine direkte und geheime mit Stichwahl bei fehlender absoluter Mehrheit eines Kandidaten im ersten Wahlgang. Zwar passte man durch Erhöhung der Anzahl der Abgeordneten für die überproportional expandierenden größeren Städte die Wahlkreiseinteilung den demographischen Verschiebungen an (von 50 auf zunächst 58) und gewährte allen (männlichen) Steuerzahlern ab dem 25. Lebensjahr das Wahlrecht. Doch damit war der Reformwille auch schon erschöpft.
Dieser letztlich unzulängliche Versuch einer Demokratisierung des überkommenen Wahlrechts sicherte darüber hinaus den über 50-jährigen Wählern unter dem Deckmäntelchen der „Lebenserfahrung“ eine zusätzliche Stimme – Sozialdemokratie war eben vor allem eine Bewegung der jungen Arbeiter, die eine solche Zusatzstimme nicht erhielten. Zudem wusste der Gesetzgeber wohl, was 1919 ein Abgeordneter der liberalen Deutschen Demokratischen Partei (DDP), Reinhard Strecker, vor der verfassunggebenden Volkskammer in Hessen(-Darmstadt) in seiner Kritik an der Novellierung 1911 herausstrich, dass nämlich vor dem Krieg die durchschnittliche Lebenserwartung eines Arbeiters bei 46 Jahren gelegen habe – damit weit unter dem anderer Bevölkerungskreise – und er im Schnitt gar nicht erst das für eine Zweitstimme berechtigende Alter erreicht habe.30
Während das Großherzogtum 1911 zumindest einen kleinen wahlrechtlichen Schritt der Reform wagte, geschah in Preußen nichts. Angesichts der Aussichtslosigkeit einer Kandidatur dachte die SPD bis 1903 gar nicht erst daran, bei den Wahlen überhaupt ins Rennen zu gehen. 1908 gelang es den Sozialdemokraten in Preußen erstmalig, Mandate für das preußische Abgeordnetenhaus zu erringen, allerdings auch diesmal nicht in Hessen-Nassau, was so bis zum Ende des Kaiserreiches bleiben sollte. Gegen das Dreiklassenwahlrecht war die SPD Sturm gelaufen. Sie hatte in vielköpfigen Wahlrechtskundgebungen die Massen auf die Straße gebracht. So fanden im Stadt- und Landkreis Frankfurt die ersten Demonstrationen gegen das Dreiklassenwahlrecht im Januar 1906 statt. In den nächsten Jahren wuchs die Zahl der Teilnehmer. Das Jahr 1910 begann mit einer Reihe von Veranstaltungen, wobei die Polizei mitunter scharf eingriff und zahlreiche Versammlungsteilnehmer verletzte, was wiederum einen erhöhten Zuspruch bei den nächsten Protestumzügen zur Folge hatte. Höhepunkt war zweifelsohne der 27. Februar, als dem Aufruf von SPD und linksliberalen Parteien eine auf 60.000 Köpfe geschätzte Menge folgte und für eine der größten Demonstrationen Frankfurts vor dem Ersten Weltkrieg sorgte.31 Aber es sollte sich auch im Krieg nichts tun. Die kaiserlichen Vertröstungen entschärften die Krisenstimmung im Innern nicht, sie verstärkten diese nur.
Die Kunde von der kaiserlichen Reformbereitschaft motivierte die hessische Sozialdemokratie zu einem Vorstoß im darmstädtischen Landtag. Die schlummernde Wahlrechtsfrage war nun wieder Thema. Als Großherzog Ernst Ludwig im März 1917 sein 25-jähriges Thronjubiläum feierte, lobte der Präsident der Zweiten Kammer, der Nationalliberale Heinrich Köhler, die Jahre unter dem Regenten als eine Zeit des Fortschritts und der Blüte. In diese Lobeshymnen auf den nach wie vor populären Großherzog stimmte die Sozialdemokratie aber nicht ein. Ihre Abgeordneten blieben dem Festakt fern. Ende April des gleichen Jahres untermauerte die SPD-Landtagsfraktion ihr Verlangen nach Einführung des allgemeinen und gleichen Wahlrechts. Die SPD im Volksstaat wurde geführt vom in Offenbach ansässigen Carl Ulrich, einem alten Haudegen der Arbeiterbewegung, einem Mann der ersten Stunde der Sozialdemokratie; 1885 war Ulrich gemeinsam mit dem Mainzer Franz Jöst als erster Sozialdemokrat in den Landtag gewählt worden. Ab 1890 saß er (mit Unterbrechung zwischen 1903 und 1907) im Reichstag und gehörte seit 1896 auch dem Stadtparlament Offenbachs an. Die Galionsfigur der Arbeiterbewegung in Hessen(-Darmstadt) sollte wesentlich den Weg in die Demokratie bahnen.32
Die SPD fand in ihren Forschungen die Unterstützung der linksliberalen Fortschrittspartei, die das sozialdemokratische Vorpreschen noch erweiterte, indem sie eine vollkommene „Umgestaltung und Weiterbildung der Rechte des Volkes im Staat, in den Kreisen und in den Gemeinden“ und hierfür die Einsetzung eines besonderen Ausschusses forderte.33 Wie auch auf Reichsebene im Reichstag, wo sich Zentrum, Liberale und Sozialdemokraten im Juli 1917 zu einem informellen Kooperationsgremium, dem Interfraktionellen Ausschuss, zusammenfanden und ihre Politik – wenn auch ohne große Durchschlagskraft – abstimmten, brach auch im Hessischen die Frontstellung der bürgerlichen Parteien gegenüber der Sozialdemokratie aus der Vorkriegszeit auf. Im Oktober 1917 erfolgte dann die Einsetzung eines von allen Fraktionen der Zweiten (gewählten) Kammer des großherzoglichen Landtages beschickten 14-köpfigen Verfassungsausschusses.
Mobilisierung aller Kräfte: Frauen und Kinder stellen in einer Munitionsfabrik in Ober-Ramstadt (südöstlich von Darmstadt) Granaten her.
Die Kommission sollte auf die weitere verfassungsrechtliche Entwicklung keinen nachhaltigen Einfluss ausüben, denn erst ein Jahr später signalisierte das großherzogliche Staatsministerium die Bereitschaft des Regenten zur Umsetzung von Reformen, um das Staatswesen auf eine neue verfassungsmäßige Grundlage zu stellen. In der Zwischenzeit hatte sich sowohl die Lage an der Front als auch in der Heimat dramatisch verschlechtert.
Die Stimmung sank auch deshalb so tief, weil sich das monarchische System als vollkommen unfähig zu demokratischen Reformen erwies und politisch erstarrte. Zu Beginn des Jahres 1918 erschallte der Ruf nach Frieden, Freiheit und Brot immer lauter. Im Januar schwappte die von den großen Streiks in den Berliner Munitionsbetrieben ausgehende Welle bis in die Provinz. Etwa 12.000 Arbeiter traten in Kassel, als Sitz des stellvertretenden XI. Armeekorps eine der militärischen Zentralen in der Heimatfront des Reiches und von jeher wichtige Rüstungsproduktionsstätte, in den kurzfristigen Ausstand.34 In Frankfurt, das im Verlauf des Krieges zu einem Zentrum der Rüstungsindustrie wurde, legten nur etwa 150 Munitionsarbeiter eines Betriebes die Arbeit nieder. Die örtliche SPD organisierte eine stark besuchte Kundgebung, die in einer Resolution die Sympathie mit den Streikenden in Berlin bekundete, aber nicht zum Streik aufrief. Zugleich wurde die Forderung nach Demokratisierung des Reiches und nach einem „Frieden ohne Annexionen“ – eben ohne Gebietsgewinn – erhoben35, der nach dem aus Kassel stammenden Sozialdemokraten Philipp Scheidemann weithin als „Scheidemann-Frieden“ bezeichnet wurde. Der glänzende Redner Scheidemann stieg im Ersten Weltkrieg zum prominentesten und populärsten Sozialdemokraten im Reich auf und wurde nach der Parteispaltung 1917 zum SPD-Vorsitzenden neben dem 1913 gewählten Friedrich Ebert bestimmt.
Bereits im Oktober 1916 hatte die SPD in Frankfurt in einer von 10.000 Teilnehmern besuchten Großkundgebung, zu der auch prominente Köpfe der Berliner Parteizentrale wie der spätere preußische Ministerpräsident Otto Braun und der spätere Reichskanzler Hermann Müller gekommen waren, nachdrücklich einen Verständigungsfrieden gefordert.36 Ende September 1917 fand dort eine weitere, gemeinschaftlich von SPD, Zentrum und Fortschrittspartei getragene große Friedensdemonstration mit mehreren Zehntausend Teilnehmern statt. Die Kasseler Sozialdemokraten hatten im August 1916 für eine solche Aktion 9.000 Menschen auf die Straße gebracht.37 Im Gegensatz dazu ereigneten sich in der Beamten- und Soldatenstadt Darmstadt zwischen 1916 und 1918 kaum Proteststreiks. So lobte der großherzogliche Innenminister Friedrich von Hombergk vor einem Ausschuss des Landtages Ende Januar 1918 die besonnene Haltung der hessischen SPD-Parteileitung, die dazu beigetragen habe, dass es im Großherzogtum nicht zu einem solchen „bedauerlichen Demonstrationsstreik“ gekommen sei.38 Dort wie generell auch in den Städten im Nassauischen nahm man den Berliner Streik vom Januar 1918 lediglich zur Kenntnis.
Hatte die Mehrheit der Deutschen 1914 noch geglaubt, um der Verteidigung willen in den Krieg gezogen zu sein, so wurde dies durch eine immer zügelloser werdende Kriegszieldiskussion im Innern in Frage gestellt. Mit Kriegszielforderungen preschte besonders die Anfang September 1917 gegründete Deutsche Vaterlandspartei vor, die den Schein des Verteidigungskrieges endgültig ad absurdum führte.39 Das Auftreten der besonders in Kassel starken Vaterlandspartei bewirkte eine Verhärtung der innenpolitischen Fronten. Vor dem hessen-darmstädtischen Landtag mahnte der Zentrumsführer Otto von Brentano nach dem Sieg gegen das Zarenreich im Osten, der in den von den Deutschen diktierten deutsch-russischen Friedensvertrag von Brest-Litowsk (März 1918) mündete, der Kriegszieldiskussion Einhalt zu gebieten und zu einem „ehrenvollen Verständigungsfrieden“ zu kommen, also auf territoriale Erweiterungen zu verzichten, aber auch „keinen Quadratmeter Landes, auch nicht in Bezug auf die Kolonien“ preiszugeben.40 Wenige Monate später brachen sich Unmut und Friedenssehnsucht Bahn, denn die Durchhalteparolen erreichten die Bevölkerung nicht mehr: „Die Zustände werden immer unhaltbarer und wuchs die Unzufriedenheit im Lande immer mehr“, notierte ein Chronist in Waldeck.41 Die durch den Krieg ausgelöste Traumatisierung betraf über die Soldaten hinaus eben auch die Zivilbevölkerung.42
Die Reichsleitung erstarrte in Agonie. In vollkommener Verkennung der aussichtslosen militärischen Lage und der zunehmenden gesellschaftlichen Aufheizung forderten Rektor und Senat der Universität Gießen und der Technischen Hochschule Darmstadt im Oktober 1918 zu „Einheit und Einigkeit für Kaiser und Reich!“ und zum „Vertrauen zu den Männern, die Deutschlands Geschicke“ leiteten, auf.43 Das Vertrauen aber hatte die politische Führung zu diesem Zeitpunkt nahezu gänzlich verspielt.
Trotz anfänglicher Erfolge bei der letztlich fehlgeschlagenen deutschen Frühjahrsoffensive 1918 trübte sich die Stimmung, wie in einer Limburger Volksschulchronik zu lesen war: „So treten Verzagtheit und Missmut trotz der Waffenerfolge immer stärker auf.“44 Und seit dem Sommer 1918 grassierte zudem die Tod bringende „spanische Grippe“. Die „arge Seuche“, wie der Marburger Theologieprofessor Martin Rade nach dem Verlust seiner der Epidemie zum Opfer gefallenen Tochter schrieb, raffte unzählige Menschen dahin.45 Vier Jahre Krieg, vier Jahre Entbehrung und Not, die die soziale Kluft vergrößert und die Klassengegensätze verschärft hatten, schlugen im November 1918 in Revolution um.
Am 26. Oktober 1918, genau ein Jahr nach Einsetzung des Verfassungsausschusses und im Moment der höchsten innenpolitischen Erosion, verkündete der hessische Staatsminister Carl von Ewald, dass der Großherzog die parlamentarische Umgestaltung der Verfassung akzeptiere und dass die Regierung ihre Demission anbiete. Damit wollte Hessen dem Reich folgen, wo Anfang Oktober unter Prinz Max von Baden erstmals eine parlamentarisch abgestützte Regierung mit Sozialdemokraten, darunter auch Philipp Scheidemann, aus der Taufe gehoben und mit den Ende Oktober verabschiedeten Reformen die lang angemahnte Demokratisierung verankert worden war. Doch die Reformen im Reich und die Bereitschaft des Großherzogs, auch in Hessen(-Darmstadt) durchgreifende Neuerungen in Richtung Demokratie vorzunehmen und eine mit dem Landtag abzustimmende Regierung einzusetzen, kamen viel zu spät. Sie erzielten bei der kriegsmüden Bevölkerung keine stimmungsaufhellende Wirkung mehr. So besaßen Carl Ulrichs Worte vom 29. Oktober 1918 große Berechtigung, als er vor dem Landtag auf sofortige demokratische Reformen mit der Mahnung drängte, dass man des Öfteren mit Entscheidungen „zu spät gekommen“ sei.46 Das war man in der Tat – wiederum.
Sozialdemokratie und Fortschrittspartei forderten die parlamentarische Monarchie, wobei der Großherzog auf rein repräsentative Aufgaben beschnitten werden, das Recht der Gesetzgebung allein beim Landtag liegen und die Regierung von der Volksvertretung bestimmt werden sollte. Am 31. Oktober verlangte eine Konferenz von SPD-Vertrauensleuten im Großherzogtum die Ausschaltung der Krone als gesetzgebender Faktor, aber eben nicht die Abschaffung der Monarchie als Ganzes. Das schlug sich auch in dem Entwurf zur Verfassungsreform nieder, der auf Transformation des Obrigkeitsstaates in den Volksstaat abzielte, wie Ulrich am 7. November 1918 vor dem Landtag unterstrich.47
Auch in anderen Ländern des Reiches wurden angesichts der zunehmenden Desintegration und im Sog der Berliner Entwicklung noch kurz vor Toresschluss überstürzt neue Regierungen unter Einbeziehung von Sozialdemokraten gebildet – in Sachsen am 26. Oktober, in Württemberg am 6. November – oder zumindest Reformen angekündigt wie im Großherzogtum Baden. In Bayern stimmte König Ludwig III. den zwischen Regierung und Landtagsfraktionen ausgehandelten Fortschritten zu; der Weg in eine parlamentarische Regierung war eigentlich frei.
Doch all diesen Neuerungen oder Plänen haftete von vornherein ein Manko an: Sie kamen viel zu spät. Die Chance für eine durch eine entschlossene und rechtzeitige Reformpolitik umgesetzte Demokratisierung der monarchischen Ordnung war längst verspielt. Auch auf der großherzoglichen Regierung und insbesondere dem zögerlichen Landesherrn lastete der Vorwurf einer Fehleinschätzung der politischen Gesamtlage.
Angesichts von Stagnation und revolutionärer Gärung, die ein unkontrollierbares Chaos befürchten ließen, setzte die SPD alles auf eine Karte. Sie wollte die Regie übernehmen und das Schicksal des Reiches nicht der Straße überlassen. Am 7. November nun drängte Ulrich, die Neuerungen, den Übergang in den Volksstaat, so schnell und so gründlich wie möglich zu vollziehen, während andere Abgeordnete des bürgerlichen Lagers in völliger Fehleinschätzung meinten, dass noch erst eine „Vertagung“ des Parlaments erforderlich sei, um sich noch eingehend beraten zu können.48 Zeit zur Beratung aber stand nun wahrlich nicht mehr zur Verfügung. Entschlossenes Handeln war notwendig. Doch man zögerte.
Auch in Hessen setzte selbst noch die SPD bis zuletzt auf einen reibungslosen Übergang in den monarchischen Reformstaat. So wirklich eilig schienen es die Verantwortlichen aber nicht gehabt zu haben. Am 8. November verabschiedete die Zweite Kammer die vom Verfassungsausschuss einstimmig beschlossenen Verfassungsänderungen, die 14 Punkte umfassten. Die Wertigkeit der Zweiten Kammer sollte gegenüber der nunmehr auch zu wählenden Ersten Kammer erhöht, die Minister auf Vorschlag der Zweiten Kammer ernannt werden, also die Regierung parlamentarisch gebunden sein. Übereinstimmende Beschlüsse von Erster und Zweiter Kammer sollten Gesetzeskraft erlangen; wenn die Erste einem Beschluss der Zweiten nicht zustimmte, hätte diese den Einspruch mit Zweidrittelmehrheit zurückweisen können. Die Zweite Kammer sollte alle fünf Jahre nach dem Verhältniswahlrecht ganz erneuert werden. Dieses sollte auf Landesebene das den Wählerwillen verzerrende, vor allem die SPD benachteiligende Mehrheitswahlsystem ersetzen und auch in den unteren Ebenen eingeführt werden. Nicht nur für den Zentrumsabgeordneten Brentano wäre mit der Umsetzung der Reformen die „Umwandlung des Obrigkeitsstaates in den Volksstaat […] eingeleitet und vollzogen“ worden.49 Mit neuem Selbstbewusstsein forderte das Parlament sogleich von der großherzoglichen Regierung die Einsetzung eines Staatsrates, für den man einstimmig zehn Männer aus seinen Reihen vorschlug. Doch die Chance für ein durch Verordnung von oben erwirktes Hinübergleiten in die Demokratie war vertan. Der am 8. November von Ernst Ludwig berufene Allparteien-Staatsrat aus je zwei Mitgliedern der fünf Landtagsfraktionen trat zwar am Mittag des 9. November zusammen, erlangte aber keine Bedeutung mehr. Denn der in den von Matrosen in den Marinestützpunkten an Nord- und Ostsee entfachte revolutionäre Funke griff nun auch auf Hessen über. Die Monarchie sollte gänzlich ausgelöscht werden und der parlamentarischen Demokratie Platz machen. Die Entscheidung fiel in Berlin.
Weniger Einsicht in die politischen Notwendigkeiten als Großherzog Ernst Ludwig offenbarte sein Vetter, Kaiser Wilhelm II. Am 31. Oktober 1918 trafen sich der erst seit vier Wochen amtierende Reichskanzler Max von Baden und Ernst Ludwig in der Reichshauptstadt. Vordringliches Thema des vom Kanzler gewünschten Gesprächs war die Abdankung des Kaisers. Zwar teilte der Hesse die Ansicht des Badeners, dass ein Rücktritt Wilhelms II. unabdingbar sei, wenn die Dynastie die eruptive Situation überstehen sollte, doch wollte er persönlich nicht den Sendboten des Unheils spielen und seinem im Großen Hauptquartier im belgischen Spa weilenden Cousin den Thronverzicht nahelegen. Auch der vom Reichskanzler als künftiger Regent anstelle von Wilhelm II. ins Auge gefasste, vom finnischen Parlament wenige Wochen zuvor zum König gewählte Landgraf Friedrich Karl von Hessen(-Kassel), der als politisch aufgeschlossen galt, lehnte es nach anfänglicher Bereitschaft ab, als Unglücksüberbringer zu seinem Schwager, dem Kaiser, zu reisen.50
Monarchie und Monarch verloren zum Kriegsende hin rapide an Ansehen, was der Kaiser und seine Getreuen bis zuletzt nicht wahrhaben wollten. Als Wilhelm II. im Spätsommer 1918 bei einem Aufenthalt im Schloss Wilhelmshöhe einigen Kasseler Fabriken wie den Henschel Lokomotivwerken, die 1917 auch mit dem Bau von Geschützen beauftragt worden waren, einen Besuch abstattete, sei er von den Arbeitern noch freudig begrüßt worden: „Alle nicht unbedingt an ihren Platz gefesselten Arbeiter folgten und drängten sich um ihn. Freude leuchtete aus aller Augen, aber der Glücklichste war der Kaiser.“ So zumindest erinnerte sich Kurt von Lersner, Verbindungsmann des Reichskanzlers und des Auswärtigen Amtes zur obersten militärischen Führung, als Augenzeuge dieser Geschehnisse.51 Geraume Zeit später, am 28. September, sollte der Kaiser Kassel, wo er dereinst 1876 das Abitur abgelegt hatte52, verlassen und nie wieder zurückkehren. Wenige Wochen später wurde er vertrieben und ging ins Exil in die Niederlande – für immer.
Hatte Lersner, der spätere Reichstagsabgeordnete der rechtsliberalen Deutschen Volkspartei (DVP), hier wirklich richtig beobachtet? Zweifel sind angebracht. Denn nur geraume Zeit später erscholl gerade aus den Reihen der Arbeiterschaft der Ruf nicht nur nach Frieden und Brot, sondern auch nach Abdankung des Kaisers, der immer mehr als das eigentliche Hemmnis für den ersehnten Frieden betrachtet wurde, denn die Siegermächte wollten nicht mit Wilhelm II. den Frieden schließen. In Hanau etwa fanden Friedensdemonstrationen statt, am 22. Oktober eine der MSPD und eine Woche darauf eine der USPD. Eine der eindrucksvollsten Kundgebungen spielte sich am Nachmittag des 8. November in Offenbach ab, wo mehrere Tausend ihre Arbeit niederlegten und auf dem Alice-Platz zusammenströmten, um unter sozialdemokratischer Führung Waffenruhe und Demokratie zu fordern.53 Selbst in kleineren Städten artikulierte sich Protest: In Oberursel legten am gleichen Tag 1.000 Arbeiter einer Motorenfabrik die Arbeit nieder und verlangten auf ihrer Protestversammlung eine bessere Versorgung und eine Änderung der politischen Verhältnisse: Es ging ihnen um die Republik.54 In der Heimat und an der Front griff immer mehr Kriegsverdrossenheit um sich, getragen von der Erkenntnis, dass der Frieden nicht mit denen erreicht werden konnte, die Deutschland im August 1914 sehenden Auges leichtfertig in den Weltenbrand geführt hatten. Das alte Reich brach im revolutionären Sturm wie ein Kartenhaus zusammen.
Revolution – auch im Taunusstädtchen Oberursel, wo sich am 11. Noember 1918 etwa 2.000 Einwohner auf dem Marktplatz versammeln.
An diesem 8. November vertagte sich der darmstädtische Landtag noch mit der Zuversicht, sich am 12. November gegen 10 Uhr wieder zu versammeln.55 Ein Irrglaube. Als in den Nachmittagsstunden des 8. November Darmstadts Oberbürgermeister Wilhelm Glässing politische und militärische Vertreter zu einer Besprechung über die Lage begrüßte, an der auch der Großherzog, der erst am 7. November aus Schloss Wolfsgarten in der Nähe von Langen gekommen war, teilnahm, sprach der Gewerkschaftsfunktionär und SPD-Stadtverordnete Heinrich Delp, der spätere Bürgermeister von Darmstadt (1926–1933) und Landtagspräsident ab 1928, davon, dass die Stimmung innerhalb der Arbeiterschaft ruhig und besonnen sei. Der Stadtkommandant berichtete dabei von Disziplin und Ordnung in den Kasernen. Beides entpuppte sich als Fehleinschätzung. Denn kurz darauf kam der Anruf, dass sich im Militärlager in Griesheim vor den Toren Darmstadts ein Soldatenrat gebildet hatte. Und in der Nacht drohten geschätzte 5.000 Soldaten das Neue Palais zu stürmen und den Großherzog festzusetzen, was Delp mit einer Beschwichtigungsrede gerade noch verhindern konnte. Es brodelte, zusehends, was auch außerhalb der Metropolen von den Verwaltungen registriert wurde: Beunruhigt über die Meldungen aus dem Reich empfahl das Kreisamt Bensheim am 9. November den Bürgermeistern seines Sprengels, Bürgerwehren zu bilden, um Unruhen und Plünderungen zu vermeiden. Zur Bildung einer Bürgerwehr kam es nicht mehr, denn auch im Kreisstädtchen an der Bergstraße bildete sich am 10. November ein Arbeiter- und Soldatenrat, der das Heft in die Hand nahm.56
Das Ende der Monarchie stand unmittelbar vor der Tür. „Revolution!“ titelte der „Hessische Volksfreund“, die Darmstädter SPD-Zeitung, schon am 8. November.57 Sie kam auch ins Hessische. Und sie sollte den Systemwechsel bringen, denn es war keineswegs nur eine „Massenkomödie, ausgeführt von dummen Jungens“, wie der Direktor des Frankfurter Lebensmittelamtes Alfred Schmude in totaler Verkennung von Wucht und Breite der revolutionären Bewegung am 9. November in sein Tagebuch notierte.58 Dieser Tag markierte das Ende des deutschen Kaiserreichs nach einer fast 48-Jährigen Lebensdauer – unumkehrbar. Der Systemwechsel vollzog sich ohne Verwerfungen: „[Es] hat jetzt bei uns eine große Umwälzung stattgefunden […]. Deutschland ist kein Kaiserreich mehr, es ist mit einem Schlag demokratisiert. […] es verläuft alles ruhig u. ohne Blutvergießen“, schrieb ein Griesheimer Händler am 10. November seinem Sohn an der Front, ohne das Wort „Revolution“ zu verwenden.59 Aber es war eine. Und der Krieg endete. Am 11. November wurde im französischen Compiègne der Waffenstillstand unterzeichnet, für die deutsche Seite nicht von den verantwortlichen Militärs, sondern durch den Zivilisten Matthias Erzberger, den Staatssekretär (Minister) der nun nicht mehr existierenden Regierung Max von Baden. Genau an diesem Tag verstarb der letzte Kriegstote aus Hanau in einem Lazarett in Ratzeburg. Er erlag seinen Verwundungen, die er im Mai des Jahres auf der Krim erhalten hatte.60
Die Träger der Revolution: Arbeiter- und Soldatenräte, hier eine Sitzung des Rates der Stadt Höchst am Main (heute Stadtteil von Frankfurt) im dortigen Bolongaropalast.