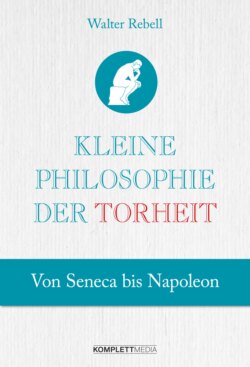Читать книгу Kleine Philosophie der Torheit - Walter Rebell - Страница 6
ОглавлениеKAPITEL 1
WAS SENECA NOCH NICHT WISSEN KONNTE
Grenzen, die der Vernunft gesetzt sind
Sie haben auf einer harten Steinbank im Halbrund eines Theaters in Griechenland Platz genommen. Es ist ein milder Sommerabend, unten auf der Bühne brennen links und rechts Fackeln, in der Mitte steht ein junger Mann, zupft an den Seiten seiner Zither und singt. Er singt nicht schlecht, aber auch nicht gut. Sie haben an diesem Abend schon bessere Sänger gehört. Aber Sie wissen, dass Sie diesem hier nachher den größten Applaus geben. Alle im Theater werden sich erheben, werden vor Begeisterung brüllen, Sie mit dabei, und der Preisrichter – es handelt sich nämlich um einen Wettstreit – wird diesem jungen Mann den Siegeskranz überreichen.
Er macht eine einjährige Tournee durch Griechenland, der junge Mann. Auf allen Festspielen tritt er auf. Bei zahlreichen anderen Gelegenheiten. Immer ist er der Sieger. Am Ende wird er 1808 Siegeskränze eingeheimst haben.
Eigentlich müsste der junge Mann in Rom sein. Um dort seinen beruflichen Pflichten nachzukommen. Aber diese Pflichten sind ihm lästig, er betätigt sich lieber als Sänger, auch als Dichter, auch als Wagenlenker.
Dieser junge Mann ist ein Tor. Ein Narr, aber ein gefährlicher. Einige Jahre vor der Griechenland-Tournee hat er in Rom Christen umbringen lassen. Er hatte Rom anzünden lassen, um aus dem Brand künstlerische Inspirationen zu gewinnen, und dann hatte er Sündenböcke gebraucht.
Diesem Mann mussten Sie an jenem Sommerabend in Griechenland im Theater Beifall spenden. Denn wehe, man hätte entdeckt, dass Sie sich verweigern …
Sie ahnen richtig: Wir sprechen hier von Kaiser Nero. Seine antiken Biographen Tacitus und Sueton erzählen von zig Torheiten, die er begangen hat.
»Nun ja …«, sagen Sie vielleicht.
Nichts »nun ja«! Zu all den Torheiten hätte es nach Adam Riese nicht kommen dürfen, denn Nero hatte eine Erziehung vom Besten, vom Feinsten genossen. Eine Erziehung, in der die Vernunft obenan gestanden hatte. Aus Nero sollte ein durch und durch vernünftiger Mensch werden, so wollte es sein Erzieher, so wollte es …
Warum mache ich hier eine Pause? Damit Sie überprüfen können, ob Sie richtig auf Ihrem Stuhl sitzen. Damit Sie nicht umfallen, wenn jetzt der Name kommt.
Neros Erzieher war niemand anderes als Seneca.
Seneca, der große Philosoph, der Theoretiker der Vernunft, lieferte als Meisterstück seiner philosophisch-pädagogischen Bemühungen Nero ab.
Wie konnte es dazu kommen? Weshalb gelang die Erziehung zur Vernunft nicht?
Wegen Neros Mutter Agrippina. Nero wurde schon mit 17 Jahren Herrscher, und eigentlich führte seine Mutter das Regiment. Oder wollte es, Nero musste sich beständig gegen ihre Einmischungen wehren. Tacitus beschreibt, wie sie sogar ihre weiblichen Reize einsetzte und zur Blutschande bereit war, um auch auf diese Weise über den Sohn Macht auszuüben. Nero ließ sie schließlich ermorden. Wie, das ist eine Geschichte für sich. Zunächst wurde ein Schiff präpariert, das auseinanderbrechen und untergehen sollte, aber Agrippina konnte sich schwimmend an Land retten. Daraufhin wurde sie auf konventionelle Weise getötet, von einem Zenturio mit einem Schwerthieb.
Ein junger Mann mit solch einer Sohn-Mutter-Geschichte im psychischen Gepäck konnte nicht normal werden.
Das wusste Seneca nicht. Das weiß man erst seit Sigmund Freud. Die Seele funktioniert nicht nach Adam Riese, dem Rechenmeister. Sie ist unberechenbar. Gegen seelische Komplexe kommt die Vernunft nicht an. Nero hätte einen Psychoanalytiker gebraucht, nicht einen Spezialisten für die Vernunft. Wer weiß, was Nero zu seiner grotesken Griechenland-Tournee getrieben hatte. Hing sie irgendwie mit der Mutter zusammen? Mit dem in Auftrag gegebenen Mord? Mit Schuldgefühlen? Nero machte sich in Griechenland zum Kasper, alle lachten heimlich über ihn. War das eine Art von Selbstbestrafung?
Eigentlich ist Seneca auch bei der Erziehung seiner eigenen Person gescheitert. Er konnte auch aus sich selbst keinen durch und durch vernünftigen Menschen machen, das sagt ja schon das Statement vom Lachen über sich selbst, das in der Einleitung zitiert worden ist. Aber Seneca gibt noch mehr von sich preis.
In seiner Abhandlung über den Zorn schreibt er, dass er jeden Abend Rechenschaft über seine Fehler ablegt: »Wenn das Licht entfernt und meine Gattin, bekannt mit meiner Gewohnheit, verstummt ist, überschaue ich meinen ganzen Tag und wäge meine Handlungen und Äußerungen ab; nichts bleibt mir verborgen, nichts übergehe ich. Warum sollte ich mich denn auch vor meinen Verfehlungen fürchten, da ich sagen kann: Gib acht, dass du das nicht wieder tust, für dieses Mal sei es dir verziehen?«
(Wir finden solche skrupulöse Selbsterforschung später im Pietismus wieder [religiöse Aufbruchsbewegung des 17./18. Jahrhunderts]; aber auch ein so gelehrter Mann wie Wilhelm von Humboldt, der jenen Typ von Universität geschaffen hat, der in Deutschland bis heute mehr oder weniger Gültigkeit besitzt, ließ keinen Tag vergehen, an dem er nicht sein eigenes Verhalten unter Anlegung strengster Maßstäbe Revue passieren ließ.)
Selbsterforschung gemäß Seneca und gemäß Freud
Mit seiner täglichen Selbsterforschung und dem Eingestehen der begangenen Fehler zeigt uns Seneca, dass es mit der Orientierung an der Vernunft offenbar nicht so recht klappt. Wir laufen der Vernunft immer wieder aus dem Ruder. Auch jemand wie Seneca, der so sehr darum kämpft, dass ihm das nicht passiert (fast möchte man sagen: der krampfhaft darum kämpft), stellt immer wieder fest: Etwas Nicht-Vernünftiges in mir war stärker gewesen.
Für dieses Stärkere haben wir heute ausgearbeitete psychologische Theorien. In uns gibt es, und das konnte Seneca noch nicht wissen, neben der Vernunft auch das machtvolle, nicht nach vernünftiger Logik arbeitende Unbewusste. Das spielt uns Streiche. Das zwingt uns zu Torheiten.
Deshalb kann es passieren, dass auch wir uns zum Kasper machen, wie Nero. Wir sind hinterher fassungslos darüber. Wie konnte das passieren? Es war doch so ein schöner Abend mit Gästen, die Atmosphäre war entspannt, man plauderte … Aber plötzlich war für uns Wettstreit. Wir griffen sozusagen zur Zither und sangen unser Lied. Unser Ehepartner schaute uns entsetzt an, aber wir machten weiter, wir wollten den imaginären Preisrichter beeindrucken, wir wollten den Siegeskranz einheimsen.
Der Abend war verdorben. Wir hatten ihn verdorben.
Und nun die Analyse dieser Torheit. Was hatte uns geritten? – Mit Seneca kommen wir nicht weiter, wohl mit Sigmund Freud. Seneca würde uns sagen: »Du hast gegen die Vernunft gehandelt, lieber Freund. Mach es beim nächsten Mal besser. Halt dich dann zurück, streng dich an.« Sigmund Freud würde sagen: »Geh in Gedanken noch einmal die Gäste durch. Hat dich einer von ihnen genervt? Auch wenn er gar nichts Besonderes getan hat?« – Richtig! Die bloße Anwesenheit von Karl hat mich genervt! Weil der nämlich Betriebsdirektor geworden ist, und ich bin es – in meinem Betrieb – nicht geworden. Ressentiments leiteten mich. Ich musste dem Karl einmal zeigen, wer ich bin, dass ich auch etwas drauf habe … Nur dann, wenn ich mir das eingestehe, wenn ich also auf einer Etage tiefer analysiere als Seneca bei seiner allabendlichen Selbstbespiegelung, habe ich die Chance, beim nächsten Zusammentreffen mit Karl tatsächlich eine Torheit zu vermeiden.
Selbsterforschung ist nicht einfach. Unser blinder Fleck hindert uns, die Motive unseres Handelns zu erkennen. Aber wir könnten Hilfe von außen suchen. Bleiben wir bei dem Beispiel des verdorbenen Abends …
Heinz (nennen wir den Haupt-Akteur einmal so) fragt also hinterher seine Ehefrau: »Jutta, was war eigentlich los? Weshalb habe ich so gehandelt? Ich kann es mir selbst nicht erklären.«
Heinz verhält sich nicht wie Seneca. Der lässt seine Frau zunächst einschlafen (»… wenn sie verstummt ist …«), dann denkt er nach. Heinz hingegen will mit seiner Frau zusammen nachdenken. Was mag Seneca dadurch, dass er nicht mit seiner Frau im Gespräch war, an Selbsterkenntnis entgangen sein! Was hätte sie ihm über ihn alles sagen können!
Kommunikation ist ein Grundprinzip der abendländischen Philosophie, das hätte Seneca wissen müssen. Die Griechen haben uns gelehrt, dass man zur Wahrheit nie allein durchstößt, sondern nur im suchenden, ringenden Gespräch mit den anderen. Der Osten (Indien, China, Japan) sieht die Sache anders. Hier gelangt man zur Wahrheit durch Meditation, durch Versenkung in sich selbst. Die Wahrheit ist bereits in einem, sie braucht nicht kommunikativ ermittelt zu werden.
Ich will die beiden Wege zur Wahrheit nicht gegeneinander ausspielen, jeder hat sein Recht. Aber wir im Abendland sind stärker vom Modell der Griechen geprägt. Sokrates sammelte junge Menschen um sich und diskutierte mit ihnen. Platon schrieb Dialoge: Durch Frage und Antwort und gemeinsames Überlegen wird der Gedankengang vorwärtsgetrieben. Auch die Psychoanalyse Sigmund Freuds ist ein kommunikatives Geschehen: zwischen Patient und Analytiker.
Scheuen wir uns also nicht, bei der Suche nach der Wahrheit über uns selbst andere Menschen zurate zu ziehen. Sie wissen stets mehr über uns als wir, sie haben ja keinen blinden Fleck (bei ihrer Sicht auf uns nicht; bei ihrer Sicht auf sich selbst schon).
Heinz fragt also seine Ehefrau Jutta. Die ist bass erstaunt; sie denkt, sie höre nicht richtig. Wenn Heinz sich nach einem Abend mit Gästen an sie wandte, um mit ihr zu reden, dann meist, um sie zu kritisieren. Das und das habe sie falsch gemacht. Aber jetzt möchte er selbst auf den Prüfstand. Das ist neu. Das ist verheißungsvoll. Natürlich weiß sie, Jutta, schon lange, was Heinz unbewusst gegen Karl in sich herumträgt.
Ein Rundgang durch Neuchâtel
Nach dem Theaterbesuch in Griechenland lade ich Sie zu einer Reise in die Schweiz ein. Vielleicht waren Sie schon hier, dann sicher in den Alpen, am Eiger oder am Matterhorn. Die Westschweiz wird Ihnen unbekannt sein. Doch auch hier ist es schön, der Jura ist ein Wanderparadies …
Allerdings geht es uns nicht um die Schönheit der Natur. Wir streifen durch die Kantons-Hauptstadt Neuchâtel (Neuenburg). Darf ich Sie führen? Ich kenne mich in der Stadt aus, ich wohne seit 25 Jahren hier. Ich bringe Sie durch enge Gassen und Treppenwege zum höchsten Punkt. Hier können Sie die Kirche »La Collégiale« bewundern. Und auf dem Platz davor die Statue des Neuenburger Reformators Farel (1489 – 1565).
Auf diesen Farel kommt es mir an. Er war befreundet mit Calvin (1509–1564), und wie dieser war er düster, fanatisch, ernst. Ich möchte nichts mit ihm zu tun gehabt haben (obwohl ich die Neuenburger Reformierte Kirche, deren Mitglied ich bin, sympathisch finde).
Farel also. Ein würdiger Mann. Aber gegen Ende seines Lebens beging er eine Torheit. Schon seine Zeitgenossen, die Leute, die er zum reformierten Glauben bekehrt hatte, schüttelten verständnislos den Kopf. Mehr noch: Sie waren empört.
Farel heiratete mit 69 Jahren ein sehr junges Mädchen.
Alle haben einen Hammer …
Besonders gefährlich wird es, wenn der Geschlechtstrieb ins Spiel kommt. Dann gibt es kein Halten mehr. Ich brauche Ihnen keine weiteren Beispiele vor Augen zu führen, das mit Farel reicht. Grenzen, die der Vernunft gesetzt sind … Vor allem der Geschlechtstrieb setzt sie. Und so richtig es ist, biologisch gesehen, dass er uns zur Vermehrung treibt und zur Erhaltung der Art, so bedenklich ist es, dass er uns oft unsere sozialen Beziehungen zerstört. Der Geschlechtstrieb geht, und das ist beängstigend, rücksichtslos auf sein Ziel zu.
Kann man ihm nicht doch beikommen?
Bei grundsätzlicher Anerkennung, dass der Geschlechtstrieb stärker ist als die Vernunft, lässt er sich, so meint ein antiker Philosoph, Epikur, von vernünftigen Überlegungen begleiten. Und dadurch (ein wenig) steuern, sodass Torheiten (möglicherweise) verhindert werden.
Schauen wir uns das bei Epikur genauer an!
Philosophie der Lust
Epikur (341 v. Chr. – 271 v. Chr.) hat einen schlechten Ruf. Er gilt als unmoralisch. Im Zentrum seines Denkens steht die hedone, die Lust; man könnte auch übersetzen: Freude, Vergnügen, aber Lust trifft die Sache schärfer, da es Epikur durchaus auch um die sexuelle Lust geht. Die philosophische Richtung, für die der Name Epikur steht, heißt Hedonismus und hat ihre Anhänger bis in die Neuzeit (zum Beispiel vertraten die französischen Materialisten hedonistisches Gedankengut).
Ziel ist es bei Epikur, Lust zu suchen und Unlust zu vermeiden. Der Mensch soll ein glückliches Leben führen. Dazu braucht es allerdings auch die Vernunft, und so reiht sich Epikur in den Mainstream der antiken Philosophie (mit der Betonung der Vernunft) ein. Er schreibt: »An allem Anfang aber steht die Vernunft, unser größtes Gut. Aus ihr ergeben sich alle übrigen Tugenden von selbst, weil sie uns lehrt, dass in Freude zu leben unmöglich ist, ohne dass man ein vernünftiges, sittlich hochstehendes und gerechtes Leben führt.«
Epikur vollbringt einen Balanceakt. Einerseits lehrt er das Ausleben der Lust, andererseits gibt er das Prinzip der Vernunft nicht preis. Man soll vernünftig leben; lustorientiert, aber vernünftig. Wenn man die Vernunft außen vorlässt, funktioniert das lustorientierte Leben überhaupt nicht, es wird selbstzerstörerisch.
Und nun die Anwendung auf das Geschlechtsleben. Seien Sie gespannt. Sie werden schmunzeln, aber auch ins Nachdenken geraten: »Ich habe vernommen, dass dich der Kitzel in deinem Fleisch übermäßig zum Geschlechtsverkehr treibt. Folge ihm, wie du magst, aber sorge dafür, dass du dabei die Gesetze nicht übertrittst, nicht den Anstand verletzt, keinen dir nahestehenden Menschen kränkst, deine Gesundheit nicht zerrüttest und dein Vermögen nicht vergeudest. Es ist jedoch schwer, sich nicht wenigstens in eine der genannten Schwierigkeiten zu verstricken.«
Wie finden Sie das? – Psychologisch richtig ist sicherlich, dass nicht versucht wird, den Geschlechtstrieb kleinzureden. Dass auch nicht dazu aufgerufen wird, ihn zu unterdrücken. Es wird im Gegenteil gesagt: »Folge ihm.« Da fühlen wir uns als Triebwesen ernst genommen. Und der, der uns ernst nimmt, der Philosoph Epikur, hat jetzt eine Chance, vorsichtig steuernd in unser Triebleben einzugreifen. Um uns vor Torheiten zu bewahren. (Einem Moralapostel wie Farel würden wir uns als moderne Menschen verweigern.)
Wenn wir in eine delikate Lebenssituation kommen, sollten wir die Regeln Epikurs zum Umgang mit dem Geschlechtstrieb noch einmal nachlesen …
London wird zum Hexenkessel
Ich hätte im August 2011 nicht in der britischen Hauptstadt sein wollen. Eine Serie gewalttätiger Ausschreitungen fand statt, verursacht durch die Erschießung des 29-jährigen Mark Duggan durch die Polizei (er war verdächtigt worden, für einen Drogenring zu arbeiten). Es kam zu Brandstiftungen und Vandalismus, kriegsähnliche Zustände herrschten. Die meisten der jugendlichen Randalierer gehörten zum Rand der Gesellschaft, zu den Deklassierten, den Chancenlosen. Aber auch gut situierte Büroangestellte ließen sich mitreißen. Bei den Plünderungen ergatterten sie ihren Anteil an der Beute, einen Fernseher vielleicht oder auch nur ein Handy. Durch Überwachungskameras identifiziert, rasch gefasst, rasch vor Gericht gestellt, hart bestraft, waren sie im Nachhinein über ihr eigenes Verhalten fassungslos. Welche Torheit hatten sie begangen! Und wie mussten sie nun dafür büßen!
Wir sind bei unserem nächsten Unterpunkt angelangt: Grenzen werden der Vernunft auch dann gesetzt, wenn wir uns in Menschenmassen befinden. Dort herrscht eine spezielle Psychologie, und die ist in bis heute gültiger Weise von Gustave Le Bon (1841–1931) beschrieben worden. – So wenig Seneca etwas vom Unbewussten im Sinne Freuds wissen konnte, so wenig auch von der Massenpsychologie. Natürlich war die Unvernunft von Massen den antiken Philosophen bekannt, aber die psychologische Begrifflichkeit war noch nicht ausgearbeitet. – Ich schlage Ihnen vor, Massenverhalten zunächst am Beispiel der Athener zu studieren, wobei wir uns auf den griechischen Geschichtsschreiber Thukydides (454 v. Chr. – 399 v. Chr) stützen. Dann gehen wir zu Le Bon und der modernen Massenpsychologie über.
Frühe Schildbürger: die Athener im klassischen Zeitalter
In der Schule haben wir gelernt, dass in Athen die Demokratie erfunden wurde. Das stimmt. Aber hat man uns auch beigebracht, dass die antiken Philosophen, zum Beispiel Platon und Aristoteles, der Demokratie sehr skeptisch gegenüberstanden? Sie wussten um die Verführbarkeit der Massen. Ein glänzender Redner tritt in der Volksversammlung auf, und mit schmeichlerischen Worten wickelt er die Leute um den Finger. Die stimmen dann in seinem Sinne ab.
Es braucht sehr viel Reife, um mit demokratischer Freiheit umgehen zu können und sie nicht zu törichten Entscheidungen zu benutzen. Jahrhundertelange Erfahrung mit der Demokratie haben die Schweizer, und sie sind möglicherweise die reifsten Demokraten. In einer ihrer vielen Volksabstimmungen hatten sie darüber zu entscheiden, ob sie sich in Zukunft statt vier Wochen Jahresurlaub sechs Wochen gönnen sollten. Zwei Wochen Urlaub mehr! Man brauchte nur auf den Wahlzettel ein Ja zu schreiben! Aber die Schweizer schrieben in ihrer Mehrheit ein Nein (Abstimmung vom 11.3.2012).
Ein Ja zur Initiative »Mehr Urlaub« wäre eine Torheit gewesen, volkswirtschaftlich gesehen, und die Schweizer waren so klug, das zu kapieren. – Ich will die Schweizer allerdings nicht zu sehr loben, manche ihrer Abstimmungsergebnisse zeugen möglicherweise auch von Torheit (es kommt immer auf den Standpunkt an); aber insgesamt wird man wohl sagen dürfen, dass die Schweizer geübte Demokraten sind.
Die Athener waren nicht so klug wie die Schweizer. Damals steckte die Demokratie ja noch in den Kinderschuhen.
Der Geschichtsschreiber Thukydides, selbst ein Athener, kennt seine Pappenheimer. Er macht sich nichts vor. In wer weiß wie viel harten Nächten hat er alle Illusionen überwunden, und jetzt steht ihm die Wahrheit über die menschliche Natur klar vor Augen. Er klagt nicht an, er beschreibt nur. Auch über Alkibiades regt er sich nicht auf, solche Typen gibt es eben.
Alkibiades?
Der Athener Alkibiades (451 v. Chr. – 404 v. Chr.) stachelte, so schreibt Thukydides, seine Landsleute dazu an, die athenische Kriegsflotte nach Sizilien zu schicken und Syrakus anzugreifen. Die Sache war sehr gefährlich, risikoreich, und es gab genügend Stimmen, die abrieten. Aber Alkibiades setzte sich durch. Er war einer der ersten Machtmenschen, ein brillanter Volksverführer, egozentrisch, rücksichtslos. Er wandelte schwindelfrei an Abgründen, und mit den Göttern stand er auf verwandtschaftlichem Fuße. In seiner Jugend soll er der Lustknabe des Sokrates gewesen sein, und schon damals betörte er alle durch seinen Charme und seine Schönheit. Später durchzechte er mit seinen Freunden so manche Nacht, und einmal soll er sich dabei über die Mysterien von Eleusis, die in Athen Staatsreligion waren, lustig gemacht und sie nachgeäfft haben. (In den Mysterien von Eleusis wurde Demeter, die Göttin des pflanzlichen Wachstums, verehrt.) Auf Sizilien hatte Alkibiades es abgesehen, weil er sich dort eine eigene Herrschaft aufbauen wollte.
Von diesem Mann ließen sich die Athener verführen.
Am Tag der Abfahrt der Flotte, als die Athener zum Hafen Piräus eilten, befielen sie allerdings schlimme Vorahnungen. Der Anblick der prächtig gerüsteten Kriegsschiffe hob jedoch wieder die Stimmung – Thukydides beschreibt minuziös das Hin und Her der Gefühle.
Es kam, wie es kommen musste. Die Athener wurden vernichtend geschlagen, Tausende von ihnen wanderten als Arbeitssklaven in die Steinbrüche von Syrakus. Nie zuvor war eine griechische Streitmacht in eine so schlimme Katastrophe geraten. Torheiten, die Weltgeschichte ist voll von Torheiten. Mit ihren verhängnisvollen Folgen. Thukydides, der erste politische Geschichtsschreiber, kann uns den Blick dafür schärfen.
Hand aufs Herz: Wenn wir damals in Athen mit dabei gewesen wären, unterhalb des Akropolis-Hügels, in der Masse mit all den anderen, hätten wir dann nicht auch unter dem Einfluss des Alkibiades für den Angriff auf Syrakus gestimmt?
Ein Buch, das auch Hitler gelesen hat
Adolf Hitler brachte von Natur aus suggestive Kraft mit; schon als 16-Jähriger war er zu rhetorischen Eruptionen fähig, und sein Jugendfreund August Kubizek wurde dann regelmäßig in die Rolle des betroffenen und fassungslosen Zuhörers gedrängt – der vor Staunen am Ende zu applaudieren vergaß. Erst nach und nach begriff Kubizek, dass solche Vorführungen kein Theater waren, dass in ihnen vielmehr tödlicher Ernst waltete. Und er, Kubizek, hatte am Ende nur immer eines zu tun: bedingungslos zuzustimmen.
In den »Aufstiegsjahren« schulte Hitler systematisch sein rhetorisches Talent, seine Wirkung auf Menschen, und dazu las er auch Gustave Le Bon, Psychologie der Massen (französische Ersterscheinung »Psychologie des Foules«, 1895).
Le Bon und Freud
Vielleicht fällt Ihnen beim Stichwort Massenpsychologie auch Sigmund Freud ein (»Massenpsychologie und Ich-Analyse«, 1921). Freud bezieht sich ausdrücklich auf Le Bon und stimmt ihm zu. In unserem Rahmen reicht es deshalb, nur in das Buch von Le Bon hineinzuschauen (Freud ist dann ein Stück weit mitbehandelt):
Für den französischen Autor ist die Masse eine Art von Organismus mit völlig anderen Eigenschaften als das Individuum. Die Vernunft hat nur noch geringen Einfluss, und was der einzelne Mensch aus seiner Erziehung mitbringt, zählt nicht mehr. Gesteigert ist hingegen die Emotionalität, das Triebhafte, die Tendenz zu primitiven Reaktionen. Daraus folgen Beeinflussbarkeit und Leichtgläubigkeit. Die Masse denkt, so sagt Le Bon, nicht logisch, sondern in Bildern. Die Grenze zwischen Realität und Illusion verschwimmt, Massen kann fast alles eingeredet werden (den Deutschen auch 1944 noch oder gar 1945 der Glaube an den »Endsieg«). Der Begriff des »Unmöglichen« existiert praktisch nicht mehr. Ideen, Gefühle, Erregungen, Glaubensinhalte übertragen sich durch »Ansteckung« – genau wie eine Erkältungskrankheit; Mikroben schwirren in der Luft, und jeder atmet sie ein. So breitet sich eine geistige Strömung (courant d’opinion) mit geradezu unheimlicher Geschwindigkeit aus.
Ja, wir müssen Angst vor Massen haben. Und wir müssen auch um uns selbst Angst haben, wenn wir in Massen geraten. Unsere Persönlichkeit ist dann nicht mehr dieselbe. Unsere Reaktionen sind nicht mehr vorhersehbar und kalkulierbar. Keiner sage, ihm könne das nicht passieren. Das denken vorher alle, aber dann kommt es zum
Massenauflauf, zu Massenprotesten, zur Massen-Randale, und bei jedem dieser vernünftigen Menschen ist die Vernunft schlagartig entmachtet.
Nehmen wir die Gefahr, die von Massen ausgeht, sehr ernst. Damit will ich nicht sagen, dass wir nicht mehr auf die Straße zum Demonstrieren gehen sollen. Aber wir müssen wissen, dass wir jedes Mal, wenn wir uns in einer Masse befinden, andere Menschen sind als sonst. Viel gefährdeter und auch viel gefährlicher.
Vor dem Eintritt in die Masse sehen wir einen politischen Sachverhalt durchaus noch differenziert. Wir gestehen der Gegenposition ein relatives Recht zu. Im vernünftigen Gespräch versuchen wir, für unsere Sicht der Dinge zu werben – wobei es durchaus hart zugehen darf.
Massen hingegen sind (und wenn wir mit dabei sind, sind wir es auch) absolut einseitig. Dogmatisch einseitig. Man schaukelt sich gegenseitig zu dieser Einseitigkeit hoch. Eine Masse interpretiert immer »external«: Wir sind unschuldig, die anderen sind schuldig. Wir sind die Opfer. Auch die randalierenden Demonstranten in London hätten auf eine entsprechende Frage geantwortet: »Wir sind die Opfer. Die Opfer der Verhältnisse.«
Noch einmal: Mit alldem will ich nicht gesagt haben, dass wir nicht mehr auf die Straße zum Demonstrieren gehen sollen. Es gibt Situationen, da muss der Wille der Einzelnen gebündelt werden, nur so kann er sich Gehör verschaffen und gegen Unrecht angehen (Massendemos in Griechenland gegen die Junta, Demos der Nelkenrevolution in Portugal usw.)
Moderne Gruppenforschung
Die Massenpsychologie ist über die Erkenntnisse, die Le Bon und Freud geliefert haben, kaum hinausgekommen. Es scheint damals alles gesagt worden zu sein. In gültiger Weise. Aber noch ein anderer Gesichtspunkt ist wichtig: Moderne Psychologie setzt auf das Experiment, und mit Massen, mit Volksmassen, lassen sich nun einmal keine Experimente durchführen. Experimente kann man allerdings mit Kleingruppen machen, und deshalb konzentrierte sich die Sozialpsychologie auf diese. Auch dabei zeigte sich, dass dann, wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind, der Vernunft enge Grenzen gesetzt sind und sehr schnell Torheiten begangen werden.
Gruppeneinfluss auf Wahrnehmungsurteile
Man sollte es nicht glauben: Das, was Menschen mit ihren Sinnesorganen aufnehmen, ist oftmals für sie nicht gültig. Dann nämlich nicht, wenn alle anderen etwas anderes sehen oder hören. Dann werden die eigenen Sinneseindrücke denen der anderen Menschen angeglichen.
Die klassische sozialpsychologische Untersuchung hierzu stammt von S.E. Asch (1907–1996). Er bot seinen Versuchspersonen in einem Wahrnehmungsexperiment drei Linien dar, die sich in ihrer Länge deutlich voneinander unterschieden; herauszusuchen war diejenige, die in ihrer Länge einer gleichzeitig dargebotenen Vergleichslinie entsprach – eine Aufgabe, die normalerweise kaum Schwierigkeiten bereitet.
Das experimentelle Design von Asch sah so aus, dass er Gruppen bildete, in denen bis auf eine Person alle anderen Personen Komplizen des Versuchsleiters waren, und dass er die oben genannte Wahrnehmungsaufgabe innerhalb der Gruppe lösen ließ. Die Komplizen des Versuchsleiters gaben dabei bewusst falsche Urteile ab, und sie erreichten damit, dass sich bei 32 Prozent der abgegebenen Urteile die Versuchspersonen ihrem Urteil anschlossen – gegen den Augenschein der eigenen Wahrnehmung!
Nachfolgeuntersuchungen ergaben, dass dann, wenn die Versuchsperson noch einmal allein getestet wurde, sie sofort richtig urteilte. Einzig und allein der Konformitätsdruck führte dazu, der eigenen Wahrnehmung weniger zu vertrauen als der Meinung der anderen.
Le Bon berichtet sogar von Massenhalluzinationen. Menschen sahen etwas, was es gar nicht gab. Erst sahen nur einige diese imaginären Dinge. Sie steckten die anderen an, und schließlich »sahen« es alle. Sie hätten die Existenz dieser Dinge sogar beschwören können.
Le Bons Beispiele, die aus der französischen Geschichte gezogen sind (aus der Epoche der Französischen Revolution und Napoleons), lassen sich schwer überprüfen. Aber bei Asch betreten wir den festen Boden der Experimentalpsychologie. Auch wenn uns hier nicht so Spektakuläres geboten wird wie bei Le Bon: ins Nachdenken kommen wir immerhin. Wir sind keine autarken Wesen! Wir meinen, es zu sein, aber wir sind es nicht. Schon auf so elementare psychische Funktionen wie die Wahrnehmung können andere Menschen Einfluss nehmen. Manch ein törichtes Urteil, das wir abgeben, erklärt sich so.
Ab ins Gefängnis!
In dem berühmten Stanford-Gefängnisexperiment von P.G. Zimbardo (geb. 1933) wird demonstriert, dass in Extremsituationen das Verhalten viel weniger von Persönlichkeitsdispositionen bestimmt wird und viel stärker vom sozialen Kontext und sozialen Druck, als man gemeinhin annimmt.
Für das Stanford-Gefängnisexperiment wurden 24 männliche College-Studenten ausgewählt, die psychisch völlig normal und emotional stabil waren. Sie wurden nach dem Zufallsprinzip einer Gruppe von Gefangenen und einer Gruppe von Wärtern zugeordnet. Instruiert wurden die Studenten dahingehend, dass es das Ziel des Experiments sei, eine Gefängnisumwelt zu simulieren, und sie die ganz normale Rolle eines Gefangenen beziehungsweise Wärters zu übernehmen hätten.
Nach dieser Instruktion waren die Versuchspersonen zunächst entlassen. Das Experiment begann dann kurze Zeit später sehr realistisch, nämlich mit einer Verhaftung der Studenten, die die Gefangenen-Rolle innehatten, durch die Polizei, was für die Studenten selbst eine Überraschung war. Die Studenten wurden des Diebstahls und des bewaffneten Raubüberfalls beschuldigt, ins Polizeipräsidium gebracht, später im Gefängnis entkleidet, entlaust usw. Die Wärter trugen Uniform, waren mit Trillerpfeife und Knüppel ausgerüstet – ein perfekt inszeniertes Rollenspiel begann.
Am sechsten Tag brach Zimbardo das Experiment, das eigentlich zwei Wochen dauern sollte, vorzeitig ab. Die Simulation war außer Kontrolle geraten. Ein Aufstand der Gefangenen war von den Wärtern brutal niedergeschlagen worden, Gefangene waren misshandelt, Zählappelle sogar nachts angesetzt worden usw. Mehrere der Gefangenen hatte man bereits wegen schwerer emotionaler Störungen entlassen müssen.
Die vorgenommenen Rollenzuweisungen, so folgert Zimbardo in seinen anschließenden Überlegungen, entwickelten eine Eigendynamik, die nicht vorhersagbar war und in ihren Ursachen auch nicht korrekt diagnostizierbar ist. Fest steht nur eines: Durch das Stanford-Gefängnisexperiment ist so nachdrücklich wie in keiner anderen sozialpsychologischen Untersuchung die verhaltensformende Macht von Rollen belegt worden. Und Rollen ihrerseits sind Phänomene innerhalb von (größeren oder kleineren) Gemeinschaften. Die Gesamtgesellschaft bringt Rollen hervor, aber auch jede noch so kleine Gruppe. In diese Rollen gehen wir hinein und füllen sie aus, wir können gar nicht anders. Wenn Zimbardo uns zum Gefängniswärter bestimmt hätte, hätten wir genau so gehandelt wie unsere »Kollegen«. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber man verlasse sich nicht darauf, dass man selbst eine ist! Realistischerweise sollte man davon ausgehen, dass man unter den entsprechenden äußeren Umständen dieselben Torheiten (hier: Gemeinheiten) begeht wie alle anderen.
Groupthink (Gruppendenken)
Zuweilen verfallen Gruppen, wenn sie Probleme lösen, dem sogenannten »groupthink« (Gruppendenken). Damit ist die Tendenz gemeint, über dem Streben nach Einmütigkeit die Realität aus dem Auge zu verlieren und Handlungsalternativen, die der Gruppenmehrheit zuwiderlaufen, nicht mehr zu überprüfen, sondern sofort zu verwerfen. Janis (1918–1990), der den Begriff groupthink eingeführt hat, demonstriert diese verhängnisvolle Tendenz u.a. an der Entscheidung der Kennedy-Regierung aus dem Jahre 1961, Fidel Castros Kuba von 1400 Exilkubanern angreifen zu lassen (ein Unternehmen, das mit einem vollständigen Debakel endete). Die Mitglieder der Regierung waren für sich genommen hochqualifiziert (so befanden sich einige ehemalige Harvard-Professoren darunter), aber als Gruppe gerieten sie in einen blinden Denkschematismus, der im Nachhinein kaum für möglich zu halten ist.
Die Symptome des Gruppendenkens lassen sich nach Janis wie folgt charakterisieren:
1 Die Gruppe entwickelt die Illusion der Unverwundbarkeit. (Die Kennedy-Regierung zweifelte nicht am Erfolg der Operation, obwohl den 1400 Invasoren über 200.000 Soldaten und Milizangehörige gegenüberstanden.)
2 Warnungen und negative Rückmeldungen werden ignoriert.
3 Die Gruppe ist fest von der ethischen Rechtmäßigkeit ihrer Entscheidungen überzeugt.
4 Die Wahrnehmung von anderen Personen und Gruppen ist nicht realitätsgerecht. (Fidel Castro wurde von der Kennedy-Regierung als dummer und schwacher Führer angesehen, dessen Armee vor dem Zusammenbruch stand.)
5 Auf Gruppenmitglieder mit abweichender Meinung wird starker Konformitätsdruck ausgeübt, der zu einer – zumindest äußerlichen – Übereinstimmung aller führt. Selbsternannte Meinungswächter kontrollieren diesen Vorgang.
Um der Gefahr des groupthink zu entgehen, schlägt Janis eine Reihe von Maßnahmen vor. So sollte der Leiter der Gruppe ausdrücklich auch zur Kritik an der Mehrheitsmeinung ermuntern. Damit diese Kritik möglichst effektiv vorgebracht wird, könnte ein Gruppenmitglied die Rolle des Advocatus Diaboli übernehmen und systematisch alle Nachteile der vorgeschlagenen Alternative aufdecken. Ferner könnten gruppenfremde Experten eingeladen werden, um ihrerseits die Gruppenmeinung kritisch zu kommentieren.
Die Untersuchungsergebnisse von Janis zum groupthink bleiben von hoher Aktualität und wurden durch menschlich verschuldete katastrophale Ereignisse leider immer wieder bestätigt. So zeigte beispielsweise die Untersuchung des Challenger-Unglücks von 1986, dass groupthink im Spiel war, und auch der Irak-Krieg von G.W. Bush dürfte auf Entscheidungsprozesse zurückzuführen sein, die Groupthink-Charakter hatten. Die Suche nach weiteren, vielleicht noch effektiveren Gegenstrategien zum groupthink hält an. Diese Gegenstrategien haben mit mächtigen psychischen Dispositionen zu kämpfen: Wir sind als Menschen nun einmal in Gruppen wie verwandelt, entscheidungsfreudiger und vor allem risikobereiter. Es findet ein Risikoschub statt (risky shift): Wir wagen mit anderen zusammen mehr als allein, und dabei wird die Hoffnung auf einen guten Ausgang gestärkt, die Furcht vor einem Misserfolg hingegen geschwächt.
Die Forschungsergebnisse zum groupthink sind beunruhigend. Normalerweise meinen wir, dass dann, wenn die Lösungen von Problemen Expertengremien anvertraut sind, keine Torheiten passieren, sondern wir im Gegenteil auf vernünftige Entscheidungen hoffen dürfen. Aber genau das ist oft nicht der Fall. Die Entscheidung einer Gruppe von Experten ist fast in jedem Fall extremer, als es die mittlere Individualentscheidung wäre. Mit Kollegen links und rechts von sich, die »mitmachen«, wagt man mehr.
Aber man verpasst unter Umständen auch etwas.
Die Gruppenentscheidung kann nämlich auch dahin gehen, dass man angesichts von realen Möglichkeiten untätig bleibt. Das auf sich gestellte Individuum hätte zugegriffen, aber die Gruppe versinkt in Passivität. Wieder stützt sich der Einzelne auf das Verhalten der anderen: Wenn die unentschlossen sind, darf ich es auch sein.
Orientierung an Personen – Orientierung an Sachverhalten
Der geradezu unheimliche Einfluss, den Gruppen auf das Individuum haben, hängt damit zusammen, dass sich unser Gehirn im Zweifelsfalle eher an Personen als an Sachverhalten orientiert. Wenn wir in einer Horde sind und alle plötzlich weglaufen, laufen wir mit. Das ist eine überlebenswichtige Instinkthandlung. Wenn wir selbst überprüfen wollten, ob wirklich Gefahr droht, wäre es hinterher zum Weglaufen möglicherweise zu spät. Dass sich die Masse auch irren und den Einzelnen ins Verderben ziehen kann, ist klar. Eine Antilopen-Herde überquert vielleicht genau an der Stelle den Fluss, wo besonders viele Krokodile sind. Aber keine einzige Antilope schert aus! Man bekommt solche Bilder manchmal in Tiersendungen zu sehen, sie sind beeindruckend. Eher rennt die einzelne Antilope ins Verderben, als von sich aus die Sicherheit der Flussüberquerung zu überprüfen. Wenn sich aber eine Antilope allein einem Fluss nähert, ist sie sehr vorsichtig und hält nach Gefahren genau Ausschau.
Es ist demütigend für uns, liebe Leserin, lieber Leser, aber wir gleichen den Antilopen, die in der Masse mitrennen, auch in die Gefahren hinein. So sind wir konstruiert. Die Margen, die wir hier zur Verhaltenssteuerung haben, sind minimal. (Ich würde an dieser Stelle gerne optimistischer sein, aber es wäre unredlich.)
Gefühle contra Vernunft
Wir sind wieder in Griechenland. Unter sengender Sonne stehen wir am Rande einer Pferderennbahn und schauen einem Wagenlenker zu, der mit seinem Zweigespann Übungsfahrten veranstaltet. Aber was hat er für unterschiedliche Pferde! »Das eine von den beiden, das sich in besserem Zustand befindet, ist von geradem Wuchs und wohlgegliedert, hält den Nacken hoch, hat eine leicht gebogene Linie, weiße Haare und schwarze Augen. Es zeigt Ehrliebe, verbunden mit Besonnenheit und Schamhaftigkeit, ist ein Gefährte der wahren Meinung und wird ohne Schläge, nur durch Ermahnung und Wort gelenkt. Das andere dagegen ist krumm, klobig, schlecht gebaut, hart im Nacken, mit kurzem Hals und stumpfer Nase, von schwarzer Farbe, mit glasigen und blutunterlaufenen Augen, ein Gefährte von Übermut und Prahlerei, zottig um die Ohren, stumpf und kaum der stachelbesetzten Peitsche nachgebend.«
Wir beneiden diesen Wagenlenker nicht. Das eine seiner Pferde will munter voranlaufen, aber das andere bockt und geht immer wieder hoch. So kann man kein Rennen gewinnen. So kann man nicht einmal eine Spazierfahrt machen.
Was Platon (428 v. Chr. – 348 v. Chr.) in seinem Dialog Phaidros mit diesem Bild ausdrücken will? Dass die Gefühle (oft) gegen die Vernunft stehen und dann von dieser gebändigt werden müssen. Die Seele ist bei Platon dreigeteilt. Im Kopf des Menschen wohnt die Vernunft, in der Brust der Mut und im Unterleib die Begierde. Die Vernunft (der Wagenlenker) hat zwei Pferde zu führen, den Mut (dieses »Pferd« ist willig) und die Begierde (dieses »Pferd« ist widerborstig und braucht die »stachelbesetzte Peitsche«).
Was für eine schlimme Psychologie! Was für eine verkopfte (nur vom Kopf ausgehende) Sicht vom Menschen! Aber auch die moderne Psychologie brauchte lange Zeit, um zur Welt der Gefühle (Emotionen) einen Zugang zu gewinnen.
Emotionsforschung
In der Emotionsforschung ist in den letzten Jahren viel in Bewegung geraten. Lange Zeit war diese Forschung vernachlässigt worden, nicht zuletzt der Schwierigkeiten wegen, zu etwas so Subjektivem wie »Gefühlen« einen objektiven Zugang zu finden. »Gefühle« gelten als das schwierigste psychologische Forschungsgebiet überhaupt.
Die neueste Emotionsforschung geht von der Tatsache aus, dass in Gefühlen Handlungsimpulse stecken. Gefühle sind wie innere Stimmen, die uns zu Abwendung oder Zuwendung aufrufen, zu Rückzug, Flucht oder auch Angriff. Gefühle wie Genugtuung, Zufriedenheit usw. geben auch die Signale zum Beenden von Tätigkeiten. Wenn man so nach Gefühlen fragt, hebt man auf ihre Funktion für das Überleben des Individuums (und der Gattung) ab. Auf diese Weise bekommen auch die negativen Gefühle einen guten Sinn; Ekel zum Beispiel lässt mich vor einer schädlichen Substanz zurückschrecken und bewahrt mir die Gesundheit oder gar das Leben.
Dieser evolutionspsychologische Ansatz in der Emotionsforschung verbindet den Menschen mit dem Tier. Ein Hund beispielsweise reagiert, wenn sich ihm ein Fremder nähert, nach dem binären Code: Freund oder Feind? Je nachdem, wie die ankommende Person klassifiziert wird, fällt die »emotionale« Reaktion aus – die dann ihrerseits das Verhalten steuert (Schwanzwedeln oder Angriff). Gerade in der Verengung des Blickwinkels (bei Wut, Zorn, plötzlicher Angst) verrichten die Gefühle ihren Dienst. Um schnelles Handeln zu ermöglichen, muss der Blickwinkel eingeengt werden. Differenzierungen, Abstufungen machen dann keinen Sinn, sie verzögern nur die Reaktion. Und genau dieses Erbe tragen wir mit uns herum; wir reagieren bei gewissen Gefühlen »total«, und zu ihrer Anpassung an die Abschattierungen der jeweiligen Situation sind wir kaum fähig. Wir handeln dann ebenfalls binär: schwarz oder weiß, ja oder nein, Freund oder Feind? Höhere Seelentätigkeit, kulturell erworben, setzt später ein; aber unsere erste Reaktion ist so. Der Sozialpsychologe Martin Seligman spricht von einem »katastrophischen Gehirn«, das immer auf das Schlimmste gefasst ist, gefasst sein muss.
Ein treuer Dackel
In meinem entfernten Bekanntenkreis passierte folgende Geschichte: Ein Mann machte seinen üblichen täglichen Spaziergang mit seinem Dackel, durch Felder und Wiesen, stürzte, brach sich ein Bein und konnte sich nicht mehr erheben. Der Dackel bewachte ihn treu und ließ niemanden an ihn heran. Zwei Polizisten konnten sich dem Verunglückten nicht nähern! Ein Dackel ist ein Jagdhund und hat ein sehr kräftiges Gebiss … Schließlich wurde der Bruder des Verunglückten geholt, auf ihn hörte der Dackel.
Gefühle können uns auch zu törichten Handlungen treiben. Aus Ekel, aus Wut, aus Zorn, aus Angst tun wir etwas, was unangemessen ist. Oder wir wähnen uns sicher, sind erfüllt von einem Gefühl der Zufriedenheit, der Genugtuung, und werden dann unachtsam und leichtsinnig. Unser Horizont ist jetzt so begrenzt – entschuldigen Sie – wie der des Dackels.
Beispiel: Wir verteidigen bei einem schulischen Problem unseren Sohn/unsere Tochter gegen die gesamte Lehrerschaft. Unsere Gefühle gehen mit uns durch. Die Liebe zu unserem Kind macht uns blind und setzt alle vernünftigen Überlegungen außer Kraft. Das ist zunächst einmal richtig. Wenn unser Kind in Gefahr gerät, wenn sich beispielsweise ein Kinderschänder an ihm vergreift und wir erscheinen gerade noch rechtzeitig, gibt es nur eines: das Kind verteidigen! Was unsere Gefühle jetzt tun: einen Handlungsimpuls auslösen, unseren Blickwinkel verengen (wir würden auch auf einen guten Freund losgehen), unsere Antwort »total« sein lassen (wir setzen, wenn es sein muss, unsere Fäuste ein) – all das ist gut und richtig. Ist der Situation angemessen. Der emotionale Bereich unserer Seele tut das, was er tun soll, wofür er gemacht ist. Der emotionale Bereich unserer Seele tut aber dasselbe auch dann, wenn eine Situation differenzierter ist, unklar ist (Schulproblem), und darin liegt das Problem. Plötzlich sind wir der beißende Dackel, so sieht uns die Lehrerschaft. Uneinsichtig sind wir, nicht mehr bereit zum Gespräch, wir waren schon beim Rechtsanwalt … Jetzt sagen die Lehrer unter sich über uns: »Er/sie hat einen Hammer …«
Der Umgang mit Gefühlen
Weil sie derart tief in uns verankert sind und wichtigste Funktionen ausüben, ist der Umgang mit Gefühlen so schwer. Ihre Bedeutung ist weitaus größer, als man noch bis vor Kurzem meinte. Jeder Speicherungs- und Erinnerungsvorgang im Gehirn hat eine emotionale Seite. Das Gehirn speichert nicht nur Sachverhalte, sondern bewertet sie immer auch emotional, es lädt sie mit Gefühlen auf. Neutralität gibt es nicht. Insofern kann auch Denken ohne Gefühle nicht existieren, sie laufen in irgendeiner Form immer mit – und wenn es nur so ist, dass jemand an seiner Tätigkeit Freude hat. Der Neurowissenschaftler Hans Markowitsch spricht in diesem Zusammenhang von einem »emotionalen Erfahrungsgedächtnis«; es steuert unsere gesamte Hirntätigkeit. Alle Entscheidungen fallen auf der Basis von Emotionen.
Von größter Wichtigkeit sind diese Erkenntnisse für die Psychotherapie. Schon Freud wusste, dass er – wollte er an verdrängte Seeleninhalte gelangen – Gefühle auslösen musste; und nur über das Durcharbeiten und Ausleben verdrängter Gefühle war Heilung und Veränderung möglich.
Im zunehmenden Alter (ab 50 Jahre) scheint allerdings bewusst-rationales Denken gegenüber den Emotionen an Gewicht zu gewinnen. Schon länger beobachtete man, dass ältere Menschen besser als jüngere negative Gefühle in den Hintergrund schieben können, um dafür positiven mehr Raum zu geben. Heute, dank der neurobiologischen Forschung, kann man den Grund für dieses Phänomen angeben: Ein Hirnareal namens »medialer präfrontaler Kortex«, der für bewusst-rationales Denken zuständig ist, gewinnt zunehmenden Einfluss auf die emotionalen Reaktionen. Vielleicht hat die in allen Kulturen anerkannte »Weisheit des Alters« hier ihren Ursprung. Wenn weniger Gefühle im Spiel sind, werden bei Entscheidungen die sachlichen Einzelheiten besser erfasst. Normalerweise treffen Menschen gefühlsmäßige Entscheidungen und ändern sie auch dann nicht, wenn die Faktenlage es erfordert. Gefühle, so lässt sich resümieren, beeinflussen unsere Gedanken weit stärker als umgekehrt. Im Alltag werden wir ständig damit konfrontiert: wenn wir Gefühle loswerden wollen, das aber nicht gelingt; oder wenn wir andere Menschen gegen ihre Gefühlslage von etwas überzeugen wollen und das ebenfalls nicht gelingt.
Ein historisches Beispiel: Der römische Autor Tacitus (mit dem wir schon zu tun hatten), Vertreter der senatorischen Geschichtsschreibung, sagt zu Anfang seiner »Annalen«, er beabsichtige eine Darstellung sine ira et studio (ohne Zorn und Eifer). Aber er hält dieses Programm nicht ein, seine Gefühle gehen mit ihm durch. Tacitus ist voller Hass auf das Kaisertum und beschwört die verlorene Freiheit der Republik. Tiberius, Claudius, Caligula, Nero (!) sind für ihn Mörder und Verrückte. Auch wenn Tacitus ihre Regierungstätigkeit objektiv, aus innerer Distanz heraus darstellen will, wenn das seine feste Absicht ist – er kann es nicht.
Wir sind am Ende unseres ersten Kapitels angelangt. »Grenzen, die der Vernunft gesetzt sind«: Auch Gefühle setzen der Vernunft Grenzen, und gerade sie. Schnell ist dann eine Torheit begangen. Gegen Gefühle rennt die Vernunft vergeblich an. Oder anders gesagt: Mit des »Gedankens Blässe« (Hamlet; 3. Aufzug, 1. Auftritt) können Gefühle nicht gekontert werden. Aber durch andere, neue Gefühle. In einer Krisenlage unseres Lebens müssten wir eine neue Gefühlslage schaffen. Wir müssten ein Gefühl gegen ein anderes ansetzen. Dann sollen die miteinander streiten, dann sollen die es unter sich ausmachen.
Alle Freunde sagen es ihm, und er weiß es auch selbst: Gerd begeht eine Torheit nach der anderen. Seine Gefühlslage treibt ihn dazu. Er ist auf Helene, seine Ehefrau, fixiert, aber die hat ihn verlassen. Jetzt läuft er ihr hinterher und macht sich dabei (schon wieder gebrauche ich den Ausdruck) zum Kasper. Er schickt ihr jede Woche Blumen, aber die wandern sofort in den Müll.
Wir kennen alle die Lösung: Gerd müsste sich neu verlieben. Dann würde ihm Helene egal. Eine Selbstbeschwörung »Ich sage mich von Helene los!« ist zur Wirkungslosigkeit verurteilt. Wenn Gerd jedoch eine Kennenlern-Anzeige aufgibt oder selbst auf eine antwortet, hat er den ersten Schritt zur Schaffung einer neuen Gefühlslage getan. Es wird ihm sofort besser gehen.
Aber auch ein völlig anderes Gefühl als »Verliebtsein« würde Gerd helfen. In Gefühlen stecken – erinnern wir uns – Handlungsimpulse. Der Organismus kann aber nicht zu zwei Handlungen gleichzeitig getrieben werden. Verengung des Blickwinkels, schnelles Handeln, »totale« Reaktion: Das alles ist nur möglich im Hinblick auf ein Ziel. Und nur ein Gefühl kann dahinterstehen. Gefühle sind in unserem psychischen Apparat hierarchisch angeordnet, nur eines kann an der Spitze sein. Wenn Gerd durch einen furchtbaren Schicksalsschlag seine geliebte kleine Tochter verlieren würde, würde die Trauer über sie dominierend werden. Gerd würde wie versteinert sein – für viele Wochen oder gar Monate. Der Schmerz über Helenes Fortgehen wäre ein Stück weit vergessen.
Aber auch ein starkes positives Gefühl könnte Helene in Gerds Gefühlshierarchie nach unten drücken. Nehmen wir an, er ist ein Autonarr und kauft sich jetzt endlich seinen Porsche. Er geht stolz um den Wagen herum, er wechselt auf der Autobahn sofort auf die Überholspur.
Helene wird nicht mehr die Rolle spielen wie vorher.
Es gibt für den Umgang mit uns selbst Kunstgriffe, die muss man herausbekommen. Beim Management der Gefühle lautet der Kunstgriff: Eine neue Hierarchie schaffen. Das bisherige Spitzengefühl durch eine neues überbieten (beziehungsweise für dieses neue Gefühl die Voraussetzungen schaffen). – Sagen Sie jetzt nicht: »Ein Auto wiegt keinen Lebenspartner auf.« Natürlich nicht. Aber in unserer Gefühlswelt geht es irrational zu. Ein verlorener Bleistift kann mich für mehrere Stunden in Verstimmung bringen. Das Lächeln eines fremden Menschen kann mich monatelang begleiten. Eine hingeworfene, nicht weiter bedeutungsvolle Bemerkung kann mich tief kränken.
Diese Irrationalität in der Gefühlswelt kann man sich zunutze machen, indem man seinerseits irrationale Inputs tätigt. Die Wirkung ist oft verblüffend. Jeder sollte hier mit sich experimentieren.