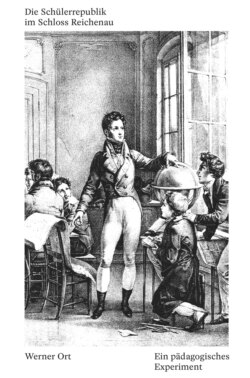Читать книгу Die Schülerrepublik im Schloss Reichenau - Werner Ort - Страница 9
INVENTUR
ОглавлениеTscharner, als Mann vor Ort, zuständig für Urbar und Archiv, Herr über alle Urkunden mit Verträgen mit dem Oberen (oder Grauen) Bund und den Gemeinden Tamins, Ems, Bonaduz und Felsberg, den Angestellten, Lehrern und anderen, 51 nahm sich vor, die Dokumente, die mit der Herrschaft, ihrem Eigentum, ihren Rechten und Pflichten zu tun hatten, zu sammeln, zu systematisieren und gründlich zu erforschen und alle künftigen Belange aufzuzeichnen und festzuhalten.52 Er gab sich gewissermassen selbst die Instruktion, was in den auf Dutzende Bände angelegten Archivbestand aufzunehmen sei.
So sollte der erste Teil eines Urbars – auf feinem Regalpapier in Folio, in Leder gebunden – genau vermessene Landkarten, Pläne und Grundrisse, Kopien sämtlicher Kaufbriefe, Konventionen, Sentenzen (Rechtsurteile), Reverse (Verpflichtungen), Rödel (Aktenverzeichnisse), Briefe und Missiven umfassen. Ein zweiter Teil sollte eine Sammlung aller Bestandteile und Rechte enthalten, so die vom Bund verbrieften
3 — Tscharners Federskizze der Schlossfassade Reichenau, um 1793.
1. Souveränitätsrechte;
2. Landeshoheitlichen Rechte; das Münzrecht;
3. die hohe Gerichtsbarkeit;
4. die niedere Gerichtsbarkeit;
5. alte und neue Domänen;
6. den Privatbesitz, «wo dann bei jedem Stück, abteilungsweise, alle Teile abzuhandeln, und bei den Gütern alle iura und Servituten zu erzählen [= aufzuführen] sind».53
Vorbild für dieses Urbar des Privatbesitzes war ein anderes, das Tscharner für sein Landgut in Jenins erstellt hatte. Wiederum ist zu bedauern, dass wir weder die Urkunden noch Kopien kennen. Andererseits ist noch lange nicht gesagt, dass Tscharner in der projektierten Breite und Tiefe vorging, da sich die politischen Ereignisse bald überstürzten und dem ruhigen Aufbau und der Pflege der Herrschaft in die Quere kamen. Immerhin besitzen wir am Anfang seiner privaten «Reichenauer Notanda» seine mit Reissblei skizzierten und mit Tusche nachgezeichneten Grund- und Aufrisse der Gebäude mit Angabe der bisherigen und geplanten Nutzung. Wir werden uns daran zu halten haben, sind uns aber bewusst, dass es sich um eine Momentaufnahme handelt, zu der sich im Laufe der Zeit Veränderungen ergaben, von denen wir nur zum Teil Kenntnis haben.
Den Auftakt der «Reichenauer Notanda» bilden Grundrisse des Schlosses, der verschiedenen Stockwerke vom Keller bis zur Mansarde und des Galerieflügels, alles sehr roh und ungefähr gezeichnet, so dass die Skizzen höchstens dem Herrschaftsrat und Tscharner als Bestandsaufnahme und Grundlage für die Einteilung dienten, nicht aber einem Baumeister oder Handwerker für die erforderlichen Umbauten. Es folgt eine ebenso rohe, für uns jedoch aufschlussreiche Zeichnung der Schlossfassade von der Strassenseite (im Westen) aus, die uns die Anordnung der Gebäudeteile vor dem Umbau zu dem heute noch bestehenden «klassizistischen Denkmal» von 1820 zeigt.54 Manche Details dieser groben Skizze waren bisher unbekannt, da die künstlerischen Darstellungen Schloss und Umgebung aus einiger Entfernung zeigen, meist vom gegenüberliegenden Rheinufer aus.
Der Kunst- und Architekturhistoriker Erwin Poeschel beschreibt das Schloss, wie es sich vor Mitte des 18.Jahrhunderts präsentierte: «Das Herrenhaus ist hier ein breiter Bau mit Krüppelwalmdach, im Umriss ähnlich dem alten Westtrakt von St. Margarethen in Chur, wie wir ihn aus Abbildungen kennen. […] Der ganze, zwanglos aneinandergewachsene Komplex wird zusammengehalten von einem dem Herrenhaus zugehörigen, beherrschenden Turm mit Zwiebelhaube.» Und kurz nach 1755: «Der Turm bleibt noch; das Schloss aber bekommt eine regelmässig gegliederte Fassade und ein gebrochenes, französisches Dach.»55
Äusserlich fehlte dem Schloss, bis auf den Turm, 1792 noch weitgehend herrschaftlicher Glanz und Gepräge. Es war, asymmetrisch und unharmonisch proportioniert, ein längliches Gebäude von 39 auf 13 ½ Metern, bis unter das Dach 9 Meter hoch, wenn wir uns auf Tscharners Angaben stützen.56 Es lag in der Verlängerung der grossen gedeckten Brücke über den vereinigten Rhein an dem Strässchen, welches das Schloss vom annähernd quadratischen Schlossgarten trennte. An der Nordseite des Schlosses kreuzte dieses Strässchen ein zweites, das von der Brücke über den Hinterrhein, auch Bonaduzerbrücke genannt, weiter gegen Osten führte und am Ufer des Rheins endete. Südlich der Kreuzung, gegenüber dem Schloss, befand sich das Zollhaus mit Sust (Warenlager), Küche und Wirtsstube im Erdgeschoss, Letztere im Anbau, darüber der Speisesaal und mehrere Gästezimmer. Zwischen Zollhaus und Schloss versperrte ein Tor die Strasse, so dass niemand die gedeckte Brücke passieren konnte, ohne anzuhalten und vom Schloss und der Zollstube her gesehen zu werden.
Falls man Tscharners Zeichnung trauen kann, hatte das Schloss auf der Frontseite im Westen zehn Fensterachsen auf drei Stockwerken. Beim Erdgeschoss ist der obere Teil von fünf Bogenfenstern sichtbar, die auf Gewölbe des teils unter die Erde versetzten «plein-pied» deuten. Dort befanden sich Bäcker, Metzger, ein Gemischtwarenladen und die Schreibstube. Der Rundturm – für den Tscharner eine Höhe von 59 Bündner Schuh oder annähernd 18 Meter bis zur Kuppel angab, 57 der also das Schloss deutlich überragte, und einen Durchmesser von 4, 5 Meter besass – barg das Treppenhaus und befand sich zwischen der dritten und vierten Fensterachse, zur Hälfte ausserhalb der Schlossmauer, neben dem grossen Tor. Den oberen Teil des sechseckigen Turms mit seinen zweistöckigen Fenstern bildete ein Blechdach, überwölbt von einer zwiebelförmigen Haube, die eine eiserne Spitze vermutlich als Blitzableiter trug.
Der einzige andere Schmuck in der Hauptfassade war ein kleiner Balkon mit geschwungenem schmiedeeisernem Geländer über dem gewölbten zweiflügligen Hauptportal, das über eine Diele quer durchs Haus in den Hof führte. Nach Tscharners Skizze gehörte dieser Balkon ursprünglich zum Vorzimmer der grossen Visitenstube im ersten Obergeschoss. Dass der Balkon zeremoniellen Zwecken diente, um Huldigungen der Untertanen entgegenzunehmen, ist nicht anzunehmen. Eher war es ein Ausguck für den Schlossherrn oder die Damen, wenn Gäste erwartet wurden oder man sehen wollte, wer über die Brücke kam oder vor dem Zollhaus hielt. Allerdings musste man frühzeitig nach aussen treten, wenn man etwas erkennen wollte, oder dann abwarten, bis der Staub sich gelegt hatte, der vorab in der trockenen Jahreszeit unter den Rädern und Hufen aufwirbelte. So berichtet jedenfalls der jetzige Schlossherr Gian-Batista von Tscharner.
Weiter befanden sich im ersten Obergeschoss ein beheizbarer Raum mit Freskomalereien und Stuckaturdecke, wo nach dem Auszug von Buol-Schauenstein vorläufig der Bäcker wohnte, eine tapezierte Kammer und ein geheizter Speisesaal. Gegen den Hof hin, mit einer hölzernen Galerie versehen, befanden sich zwei Küchen, eine Dispense und im südlichsten Teil, mit Zugang von aussen, zwei weitere Stuben, worunter Tscharner stets geheizte Räume verstand, deren eine Buol-Schauenstein als Gesandtenstübchen genutzt hatte, die andere dem Gärtner zur Verfügung stand.
Einen Stock höher befanden sich die Fürstenstube und ein Vorzimmer, Zimmer des Fräuleins genannt, einige Schlafkammern, weitere Stuben und ein Kabinett – offenbar der Arbeitsplatz des Barons, ebenfalls mit Zugang von aussen –, also die Privatgemächer Buol-Schauensteins und seiner Familie, deren einstigen Zweck und vormalige Benutzung Tscharner nur teilweise erraten konnte. Die privaten Möbel wurden ja geräumt, bevor die Firma Bavier die Herrschaft antrat.
Ebenso leer war auch die sich über das ganze Schloss erstreckende Mansarde, bei welcher Tscharner mit einzelnen Strichen antönte, es könnten sich hier einige Zwischenwände und Verschläge befunden haben. Dort war im Turm auch die Uhr untergebracht, offenbar mit einem Schlagwerk, denn im Reglement der Sitzungen des Herrschaftsrats heisst es, dass die monatlichen Versammlungen um neun Uhr begännen und Mitglieder mit einer Geldbusse belegt würden, falls sie erst nach Schlag zehn Uhr der Schlossuhr die Ratsstube beträten.58 Die Uhr ist aber weder auf den bekannten Abbildungen noch auf Tscharners Skizze sichtbar, so dass man annehmen muss, dass sie im Inneren des Turms, über dem Treppenhaus lag. Seit dem Umbau um 1820 durch Ulrich von Planta, als der Treppenturm ins Innere des Schlosses versetzt wurde, ist die Uhr an der Frontseite angebracht, und vom Durchgang zum Balkon, der sich im Westen und Norden um den Turm zieht, kann eine wohltönende und weitreichende Glocke mittels Seilzug zum Klingen gebracht werden.
Für das Seminar sollten in der Mansarde zwei Schlafsäle hergerichtet werden, einen grossen für bis zu 50 reformierte Schüler, den kleineren für höchstens 14 Katholiken; beide Säle sollten von je einem Lehrer überwacht werden, für die ebenfalls dort oben Schlafkammern zugewiesen wurden. Da die Mansarde vermutlich nicht geheizt wurde, schon der Feuergefahr wegen, und das Dach mit in Eisen gefassten Schindeln bedeckt war, kann man sich leicht vorstellen, wie kalt im Winter und wie zugig es bei windigem Wetter dort oben gewesen sein muss. Tscharner wollte die Mansarde bis zum First anheben, um sie luftiger zu machen, was die Gefahr von Erkältungen noch erhöht hätte, selbst wenn die Kinder damals deutlich abgehärteter waren als heute. Für solche Fälle stand ein Stockwerk tiefer ein geheiztes Krankenzimmer zur Verfügung. Nach Tscharners Plan waren die Einzelbetten in gehörigem Abstand voneinander aufzustellen, peinlich genau ausgerichtet und von den nächtlicherweile im Mittelgang mit einer Laterne patrouillierenden Lehrern auf einen Blick zu überschauen.
Wenn man heute das Schloss betritt, zeigt sich der Estrich kahl und fast fensterlos, ohne Unterteilung in kleinere und grössere Räume, also so, wie er schon zur Zeit von Buol-Schauenstein war. Nichts erinnert an diese Schlafsäle, auch nicht an die von Tscharner skizzierten zwei Dutzend Dachfenster im Walmdach, so dass man bezweifeln muss, dass dieser Plan realisiert wurde. Das war, wenigstens die ersten drei Jahre, auch gar nicht nötig, da nie mehr als 18 oder 19 Zöglinge im Schloss lebten, die man auch woanders unterbringen konnte, verteilt auf zwei oder drei Räume. Erst 1797, als Heinrich Zschokke die Leitung des Seminars übernahm, gab es mehr als dreissig Schüler, und sofort entstand ein eklatantes Platzproblem, das man nun nicht mehr durch Einbezug der Mansarde lösen konnte oder wollte.
Ein imposanter Teil des Schlosses war der daran anschliessende Ostflügel, von Tscharner Galerie genannt, der im hinteren Bereich lag, am Strässchen nach Bonaduz. Ursprünglich bestand er aus einzelnen Gebäuden, nach 1755 – die Jahreszahl leitet sich daraus ab, dass um diese Zeit Johann Heinrich Grubenmann die markante Holzbrücke über den vereinigten Rhein schlug – wurde er zu einem in sich geschlossenen Ensemble zusammengefasst, dessen Abschluss und Kontrapunkt zum Schlossturm eine ebenfalls mit Zwiebelhelm und Aufsatz versehene Kapelle bildete, wo die katholische Messe gehalten wurde.
Erwin Poeschel beschreibt diesen Flügel und seinen Zustand vor 1755 nach einem Gemälde im Schlösschen Flims:59 «Im rechten Winkel [zum Schloss] schliesst sich daran eine lose Reihe von Wirtschaftsgebäuden, regellos nach Höhe und Tiefe, an der Hofseite durch eine Holzgalerie verbunden und endend in der Kapelle, die auch damals schon den östlichen Pfeiler der ganzen Bauanlage bildete. Der ganze, zwanglos aneinandergewachsene Komplex wird zusammengehalten von einem dem Herrenhaus zugehörigen, beherrschenden Turm mit Zwiebelhaube.»
Daran anknüpfend meint Poeschel, auf ein weiteres Aquarell verweisend, das nach 1799 entstand und sich im Schloss Reichenau befindet: «Die Galerie verschwindet als Korridor in das Innere des Gebäudes, und die Kapelle wird als Eckpfosten fest in den Bautrakt einbezogen. Die Wirtschaftsräume bleiben nun auf das Erdgeschoss dieses neuen Gartenflügels beschränkt, oben aber liegt eine Flucht von Wohnzimmern und Salons, deren Mitte ein kleines, mit sehr graziösem Stuck heiter-geziertes Sälchen bildet. Diese Räume sind, was auffallen mag, nach Norden orientiert, da man den Blick auf die Strasse haben wollte, die damals, den Rhein weiter unten überschreitend, hier vorbeizog.»60
Das Erdgeschoss dieses Flügels, dessen Masse Tscharner mit einer Länge von 24, 9, einer Breite von 6, 3 und einer Höhe von 6, 8 Metern angab, entsprach seiner Zeichnung zufolge noch immer der früheren landwirtschaftlich-ökonomischen Nutzung mit Holzschopf, Wäscheraum, Hühnerstall und Obstlager, aber auch einem Münzmagazin und Laboratorium. Einen dieser Räume wollte Tscharner dem Metzger zur Verfügung stellen. Im oberen Stock befand sich der von Poeschel erwähnte Wohntrakt mit herrschaftlichen Räumen, al fresco bemalt, oder mit seidenen Tapisserien und üppigen Stukkaturen versehen. Der prachtvolle Saal in der Mitte des Flügels wird im dritten Teil des «Bürgerhauses im Kanton Graubünden» in mehreren Abbildungen dargestellt61 und zeugt vom Geschmack und Luxusbedarf der Buol-Schauenstein.
Es würde einen nicht wundern, wenn derartige Prunkentfaltung, wie sie auch in anderen, nach aussen unscheinbaren Häusern vornehmer Bündner Familien zu finden ist, dazu beigetragen hätte, die Vermögenslage ihrer Besitzer in Krisenzeiten zu erschüttern und die Buol-Schauenstein zur Preisgabe ihres Schlosses zu bewegen, als sie einsahen, dass ein solcher Luxus zu kostspielig wurde und nicht mehr zeitgemäss war. Wir werden noch sehen, was die Handelsfirma Bavier mit den feudalen Räumlichkeiten im Sinn hatte. Der vordere Teil im zweiten Obergeschoss des Schlosses wurde schon einmal für die Eigentümer reserviert; in der roten Audienzstube im ersten Stock tagte der Herrschaftsrat.
Der Ostflügel verfügte auf jedem Stockwerk über einen Durchgang mit Treppe zu der dem Schloss vorgelagerten Galerie, so vom Estrich des Flügels in das zweite Obergeschoss und zur Mansarde. In diesem Estrich befanden sich ein Bibliothekszimmer und einige Kammern; den mittleren Teil nahmen Kamine und ein Lastenaufzug in Anspruch und im entlegenen Teil, gegen die Kapelle hin, waren der Getreidespeicher und ein weiteres Treppenhaus untergebracht.
Die mit einer Glocke ausgerüstete Kapelle war durch den Ostflügel über einen langen Korridor mit dem Schloss verbunden, so dass man den Gottesdienst auch bei Regen oder Schnee trockenen Fusses besuchen konnte. Für die Liturgie wurde ein Priester und Messdiener gehalten. Nachdem der neue Fürstbischof von Chur – notabene ein Sohn von Buol-Schauenstein – der Herrschaft im Winter 1793 das Placet zur Messe entzogen hatte, stand die Kapelle leer, bis 1795 Pfarrer Nikolaus Leonhardi als Lehrer nach Reichenau kam und die Kapelle für den reformierten Gottesdienst nutzte. Im Winter 1793 ist in Tscharners «Reichenauer Notanda» noch von einem künftigen «doppelten Gebrauch der Capelle und benediction» die Rede.62 Der geweihte Kelch wurde zum Ärger des Fürstbischofs nicht herausgegeben.63
Zum Besitz der Herrschaft Reichenau-Tamins gehörten Wiesen, Äcker, ein Obstbaumgarten und ein kleines Rebgelände, die Tscharner sich Mühe gab, genau zu erfassen und ihren Geldwert zu bestimmen. Ferner lagen im Farsch – einem Landstreifen entlang des rechten Ufers des Vorderrheins, der zur Gemeinde Bonaduz gehörte – eine Mühle, eine Sägerei und Wuhranlagen. Tscharner erwog, einzelne Teile des Besitzes zu arrondieren oder gegen andere einzutauschen.64 Einige Jahre später, als er von einer Erneuerung Reichenaus träumte und sich die Herrschaft als ein kulturelles und wirtschaftliches Zentrum in einer lieblichen Landschaft wünschte, malte er sich eine Promenade vom Farsch bis zur Ruine Wackenau aus, mit einem antiken Tempelchen und einer Statue, um den Spaziergang romantisch und noch reizvoller zu gestalten.65 1792 lagen ihm solche Ideen noch fern; zu dieser Zeit hatte er dafür zu sorgen, die Herrschaft möglichst bald gewinnbringend werden zu lassen.
4 — Das Schloss Reichenau heute, mit seinem schönen Park. Linkerhand das Hotel Adler, das ehemalige Zollhaus. Um 1820 erfuhr das Schloss durch Ulrich von Planta eine Umgestaltung in klassizistischem Stil. Seitdem blieb es vom Aussehen her unverändert.
Unmöglich schien Tscharner dies nicht. Zur Herrschaft gehörten eine Schmiede, Sägerei, Küferei, Tischlerei, Schusterei, Färberei und Gerberei, eine Mühle, Metzgerei, Bäckerei, Apotheke und der Spezereiladen. Später kam ein Tuch- und Kleiderladen dazu. Einiges davon war im Schloss oder im grossen Haus an der gedeckten Brücke untergebracht; der Schmied und der Färber, der Küfer und der Kupferschmied hatten eigene Häuser
Die Handwerker und Krämer könnten ihren Umsatz beträchtlich steigern, meinte Tscharner, wenn man Reichenau und die Zufahrt von Chur her attraktiver gestalte, den Durchgangsverkehr anrege und im Schulinternat mit bis zu 60 Schülern den Bedarf an Lebensmitteln ausschliesslich aus der eigenen Produktion beziehe. Ausserdem gab es einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Ställen und Vieh, der einem Meier unterstand. Weniger bedeutend, wenn auch nicht vernachlässigbar, war ein langgestrecktes Gewächshaus, das vermutlich der Alimentation des Schlossgartens mit Blumen und der Überwinterung exotischer Pflanzen gedient hatte, vielleicht auch der Bereicherung des herrschaftlichen Speisezettels mit Gemüsen und Früchten, die nicht im Freien gezogen werden konnten. Was mit dem Gewächshaus weiter geschah, geht aus den Unterlagen nicht hervor. Die Gärtnerei und das Handelskontor der Firma Bavier dienten den Schülern dazu, für den Beruf als Landwirt oder Kaufmann praktische Kenntnisse zu erwerben. Die Organisation der Landwirtschaft war indessen nicht Tscharners Aufgabe, sondern der Herrschaftsverwaltung unterstellt, auch wenn er von seinem Landsitz in Jenins her genügend Erfahrung zur Verfügung gehabt hätte.