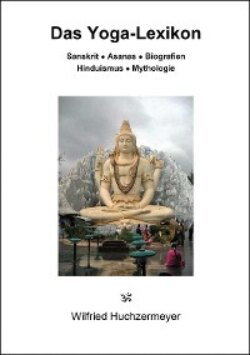Читать книгу Das Yoga-Lexikon - Wilfried Huchzermeyer - Страница 11
ОглавлениеD
Dadhi n eine dicke Sauermilch (mit Molke). Sie wird als Heilmittel und auch für Rituale verwendet.
Dadhīci, Dadhīca m ein vedischer Rishi, der einst seine Knochen darbot, damit daraus ein Vajra für Indra gefertigt werden könnte, um den Dämonen Vritra zu erlegen.
Daitya m Nachkommen der Diti, der Mutter der Dämonen, d.h. eine bestimmte Klasse von Asuras oder gottfeindlichen Kräften.
Daiva adj oder n göttlich, himmlisch; göttliche Kraft; Schicksal; Zufall.
Dākinī [ḍākinī] f Koboldin; Bezeichnung für halbgöttliche Wesen, die der Göttin Kālī zu Diensten sind.
Daksha [dakṣa] m oder adj geschickt, fähig. Einer der Prajāpatis oder Urväter der Schöpfung, der gemäß puranischen Quellen in allen Zyklen der Schöpfung präsent ist.
In einem bekannten Mythos wird erzählt, dass Daksha dereinst ein großes Opfer vorbereitete, jedoch nicht seinen Schwiegersohn Shiva einlud. Darüber war dessen Frau Satī so verstört, dass sie zum Opfer erschien und ins Feuer sprang. Das wiederum erzürnte Shiva, der sich als rächende Kraft Vīrabhadra erschuf, welcher das ganze Opfer stoppte und Daksha tötete, der jedoch anschließend von Shiva wieder zum Leben erweckt wurde.
Dakshina [dakṣiṇa] adj rechts; geschickt; südlich.
Rechts und die rechte Seite gelten als glückverheißend und höherwertig als die linke, welche Hindus für Waschungen verwenden.
So werden Opfergaben nur mit der rechten Hand gereicht und heilige Stätten im Urzeigersinn umwandert (Pradakshina).
Dakshinā [dakṣiṇā] f Geschenk an einen spirituellen Meister zum Dank für seine Lehre und seinen Segen.
Auch Name einer Göttin, die beim Opfer über den rechten Empfang und die Weiterleitung der Gaben wacht.
Dakshinācāra [dakṣiṇācāra] m, der Rechte Pfad, synonyme Bezeichnung für Dakshina-Mārga, aus dakṣiṇa und ācāra.
Dakshināyana [dakṣiṇāyana] n der „südliche Pfad“, der Weg zu Yama ins Reich der Toten.
Siehe auch Pitriyāna.
Dakshina-Mārga [dakṣiṇa] m der Rechte Pfad im Tantra, folgt einer auf Erkenntnis gerichteten Disziplin und beinhaltet aufrichtige Hingabe an die Göttliche Mutter in ihren mannigfachen Formen.
Siehe auch Vāma-Mārga, Tantra.
Dakshināmūrti [dakṣiṇāmūrti] m Name Shivas, „die nach Süden gewandte Gestalt“. Shiva in seinem Aspekt als Meisterasket und Lehrer des Yoga, der Erkennnis, Philosophie und Musik, besonders populär in Südindien, wo er stets an den südlichen Tempelmauern abgebildet wird.
Dalit [Hindī] m Unterdrückter, Ausgebeuteter. Ein von dem Reformer B.R. Ambedkar geprägter Begriff für die Unberührbaren.
Dama m Selbstkontrolle, Loslösung, Entsagung.
Damayantī f im Mahābhārata die Gattin von König Nala und Tochter von König Bhīma. Die Erzählung von ihrer innigen Liebe zu Nala, die sich inmitten schwerster Prüfungen bewährt, ist eine der bekanntesten Episoden im Epos.
Dāna n Geschenk, Gabe, wohltätige Spende.
Dānavas m Nachkommen des Dämonen Dānu, asurische Wesen.
Dandāsana n Stock-Haltung.
daṇḍa – Stock, Stab; āsana - Haltung.
Darpa m Stolz, Arroganz.
Darshan (Hindī), Darshana (Sanskrit) [darśana] n Sehen, Anblick. Einen erleuchteten Yogī oder Heiligen sehen, und von ihm gesehen werden, und der damit verbundene Segen.
Das Wort bezeichnet auch die sechs klassischen Philosophiesysteme Indiens (siehe unter Shaddarshana).
Darshana-Upanishad [darśana-upaniṣad] f eine Yoga-Upanishad in 224 Versen und zehn Abschnitten mit Lehren, die im wesentlichen identisch mit jenen des Yogasūtra sind, obgleich die Philosophie nicht-dualistisch ist. Auch die Nādīs oder feinstofflichen Nervenbahnen werden ausführlich erörtert.
Dāsa m Diener, Sklave. Auch Diener Gottes.
Siehe auch Bhāva.
Dasharatha [daśaratha] m derjenige, der zehn (dasha) Kutschen hat; der Name von Rāmas Vater im Rāmāyana, König von Ayodhyā.
Dāsya n Dienstfertigkeit, die Haltung des Dieners.
Siehe auch Bhāva, Abs. 2.
Dasyu m im Rigveda Bezeichnung für gottfeindliche Kräfte.
Datta adj gegeben, geschenkt.
Dattatreya m Name eines Weisen alter Zeit, Sohn des Atri.
Name einer Inkarnation von Vishnu, Shiva und Brahmā, wobei die drei Götter in einer Art Synthese gleichzeitig verehrt werden.
Dayā f Mitgefühl, Güte.
Dayananda Sarasvati, Svami [dāyānanda sarasvatī, svāmī] Hindu-Reformer und Sanskrit-Gelehrter (1824-1883), der den Arya Samaj begründete. Seine vedischen Studien legten die erste Grundlage für eine symbolische Interpretation der Hymnen, wie sie Sri Aurobindo später detailliert erarbeitete.
Deha m Körper. der physische Körper. Der Begriff steht auch für die fünf Koshas, die Hüllen, die den Ātman, das Selbst, umgeben.
In einigen heiligen Schriften Indiens wie z.B. der Maitrāyanī-Upanishad wird der menschliche Körper sehr negativ gesehen. Im Rahmen einer pessimistischen und weltverachtenden Stimmung soll dem Sucher die Vergänglichkeit des Lebens und dessen Leidhaftigkeit plastisch vor Augen geführt werden, um eine innere Lösung vom Irdischen und Konzentration auf die jenseitige Befreiung zu bewirken.
In zahlreichen anderen Texten wird der Körper jedoch als Tempel Gottes beschrieben, so z.B. in der Maitreya-Upanishad 2.2. Auch wenn er sterblich ist, so ist er doch Träger des unsterblichen Selbstes und dadurch geheiligt.
In vielen Schriften wird hervorgehoben, dass die körperliche Gesundheit zu fördern sei, damit ein erfülltes Leben auf Erden und eine fruchtbare spirituelle Verwirklichung möglich sind. Im 2. Vers der Īsha-Upanishad heißt es, „indem man hier in dieser Welt Werke tut, sollte man streben, hundert Jahre zu leben.“
Besonders im Tantra und im Hatha-Yoga wurden körperbezogene Praktiken entwickelt, teils sogar die Spiritualisierung oder Vergöttlichung der Physis ins Auge gefasst.
Siehe auch Jugupsā.
Dehin adj oder m verkörpert, inkarniert. Der Innewohner im Körper, Mensch, Seele.
Desai, Amrit ein bedeutender indischer Yogī, der seit den 1960er Jahren Hatha- und Kundalinī-Yoga in den USA unterrichtet.
Desai wurde 1932 in Gujarat geboren und studierte zunächst in Indien, später in den USA, wo er als Künstler tätig war. Gleichzeitig begann er auch als einer der ersten Inder in den USA Hatha Yoga zu unterrichten und machte dies nach einiger Zeit zu seiner Haupttätigkeit.
1970 hatte Desai eine außergewöhnliche Erfahrung, als er während seiner morgendlichen Āsana-Übungen in einen tiefen meditativen Zustand eintrat und erlebte, wie er eine Reihe von Āsanas in Verbindung mit einem starken Energiestrom spontan durchführte (vergl. TriYoga). Auf der Grundlage dieser Erfahrung entwickelte er den Kripālu-Yoga, benannt nach seinem Guru, Swami Kripalvananda (auch Swami Kripalu genannt).
Desaerschiedene Institutionen zur Förderung des Yoga und der ganzheitlichen Gesundheit und bildete einige hundert Yoga-LehrerInnen aus. 1994 musste er aufgrund Fehlverhaltens gegenüber einigen Schülerinnen die von ihm gegründete Gemeinschaft verlassen und lebte zunächst zurückgezogen.
Doch nach einigen Jahren wurde er wieder als Yoga-Lehrer tätig und leitet zur Zeit das Amrit Yoga Center in Salt Springs, Florida.
Desha [deśa] m Ort, Platz, Land. Der Ort, wo der Yogī seine Meditation und Übungen durchführt. Zum Teil werden detaillierte Empfehlungen für das äußere Umfeld gegeben. So sollte es rein sein und eine angenehme Atmosphäre aufweisen. Viele Yogīs ziehen sich zur Meditation gern in die Berge, eine Höhle oder einen abgelegenen Tempel zurück.
Desikachar, T.K.V. [deśikācār] bedeutender indischer Yoga-Lehrer (geb. 1938), Schüler und Sohn des bekannten Yoga-Meisters Krishnamacharya, entwickelte maßgeblich den Viniyoga.
Deva m Gott, persönliche Gottheit, Bewohner der Himmelsregionen.
Gemäß dem Rigveda gibt es insgesamt 33 Götter und Göttinnen, davon je 11 im Himmel, auf der Erde und im Wasser. Einige gemeinsame Merksmale sind, dass sie in leuchtenden Wagen fahren, keinen Schlaf benötigen und „Soma“ trinken.
Im Mahābhārata (1.1) heißt es, es gebe 33 333 Götter. Diese unendliche Vielzahl von Göttern ist charakteristisch für den Hinduismus. Tatsächlich handelt es sich für die meisten Hindus jedoch nur um verschiedene Antlitze des Einen Gottes, der in verschiedenen Formen verehrt wird. So heißt es schon im Rigveda (1.164.46), „Das Eine Seiende benennen die Weisen auf vielfältige Weise.“
In der Geschichte von Nala und Damayantī im Mahābhārata werden als Merkmale der Götter u.a. genannt, dass sie nicht schwitzen, blinzeln, keinen Schatten werfen und mit den Füßen nicht den Boden berühren. Sie sind ewig jung und leben unvorstellbar lang.
Zu den populärsten Göttern in Indien zählen Krishna und Rāma (als Inkarnationen Vishnus) sowie Shiva und Ganesha. Bekannte weibliche Gottheiten sind z.B. Durgā, Lakshmī oder Sarasvatī.
Über den Ursprung der Götter heißt es im Mahābhārata, dass die Söhne von Kashyapa und Aditi zu den Ādityas, den Sonnengöttern, wurden, die Söhne von ihm und Diti dagegen zu den Daityas, den Asuras.
Devadāsī f wörtl. „Gottesdienerin“; Tempeltänzerin, die einer Gottheit angetraut wird. Schon in jungem Alter wurden im traditionellen Indien – die Sitte wurde 1947 verboten – Mädchen von ihren Eltern in einen Tempel gebracht, aus religiösen Motiven oder aufgrund von Armut.
Die Mädchen mussten im Tempel verschiedene rituelle Arbeiten verrichten, tanzen, singen und auch als Prostituierte zur Verfügung stehen, erlangten jedoch trotz dieser letzteren, aufgezwungenen Tätigkeit in der Gesellschaft oft einen geachteten sozialen Status.
Devadatta m wörtl. Gott-gegeben (deva-datta). Einer der fünf sekundären Lebenshauche, wird mit der Funktion des Gähnens in Verbindung gebracht, das zusätzliche Sauerstoffaufnahme bewirkt.
Auch der Name von Arjunas Muschelhorn. Siehe auch Upaprāna.
Devakī f die Frau Vasudevas und Mutter Krishnas.
Devanāgarī f die „Schrift aus der Stadt der Götter“, die Sanskrit-Schrift, in der auch einige moderne indische Sprachen wie Hindī notiert werden.
Devarshi [devarṣi] m göttlicher Seher, Seher aus der Himmelsregion wie z.B. Nārada.
Devatā f Gottheit, das Bild einer Gottheit.
Devayāna n der Weg der Götter (deva-yāna), der Weg, der zu den Göttern führt; Weg der Weisheit und spirituellen Erkenntnis.
Siehe auch Pitriyāna.
Devayānī f Name der Mutter Yadus, des Begründers der Yādava-Dynastie.
Devī f Göttin, weibliche Gottheit im Hinduismus, bezeichnet oft Shivas Gefährtin.
Devi, Indra eine bedeutende Wegbereiterin des Yogas im Westen (1899-2002) und bekannte Schülerin von T. Krishnamacharya.
Indra Devi wurde 1899 in Riga im heutigen Lettland unter dem Namen Eugenie Peterson als Tochter eines Schweden und einer Russin geboren. Sie machte eine Ausbildung als Schauspielerin in Moskau, flüchtete jedoch nach der Machtübernahme der Kommunisten nach Berlin, 1927 reiste sie nach Indien, nachdem sie ein Werk Rabindranath Tagores und einige Bücher über Yoga gelesen hatte.
In Indien wirkte sie unter dem Künstlernamen Indra Devi in einigen Hindi-Filmen mit und wurde erste westliche Schülerin von T. Krishnamacharya, der sie zur Yoga-Lehrerin ausbildete. Daraufhin reiste sie in die USA und hatte dort viele prominente Schülerinnen, darunter auch Greta Garbo. 1966 wurde sie Anhängerin von Sathya Sai Baba und ging 1982 auf Einladung von Schülern ihres Meisters nach Argentinien, wo sie bis an ihr Lebensende als renommierte Yoga-Lehrerin tätig war.
Devīmahātmya n ein Gedicht mit 700 Versen, welches die Taten von Shivas Gefährtin, der Shakti, und ihre Siege über die Asuras preist. Der Text erscheint als ein Abschnitt im Mārkandeyapurāna.
Dhairya n Stetigkeit, Beständigkeit im Yoga.
Dhāma m Stätte, heiliger Ort, Zentrum der Anbetung einer Gottheit. Besonders bekannt sind Badrināth im Himālaya, Purī in Orissa, Dvārakā in Gujerāt und Rameshvaram an der Südspitze Indiens. (Siehe auch diese Orte.)
Dhanamjaya [dhanaṁjaya] m einer der fünf sekundären Lebenshauche, soll selbst nach dem Tod im Körper verbleiben. Wörtl. die Eroberung (jaya) von Reichtum (dhana). Auch ein Name Arjunas.
Siehe auch Upaprāna.
Dhanurāsana n Bogenhaltung; Rückbeuge aus der Bauchlage.
dhanuḥ – Bogen; āsana – Haltung. Nach einem Lautgesetz wird dhanuḥ zu dhanur.
Dhanurveda m der Veda der Kunst des Bogenschießens, ein Upaveda.
Dhanvantari m der Arzt der Götter, gilt als Urautor des Āyurveda, der ihm der Legende nach von Brahmā offenbart wurde.
Beim Quirlen des Milchozeans erschien er mit dem Gefäß, welches das kostbare Amrita enthielt.
Dhāranā [dhāraṇā] f Konzentration, Aufmerksamkeit, von der Wurzel dhṛ, halten. Bezeichnet die sechste Stufe im Rāja-Yoga, die Fixierung des Geistes auf einen bestimmten Gegenstand. Während der mentale Geist normalerweise hin und her springt, wird er durch Dhāranā dazu gebracht, länger und kontinuierlicher bei einem Objekt eigener Wahl zu verweilen, was auf Dhyāna, Meditation vorbereitet.
Dharma m Recht, Gesetz, Ordnung, Moralkodex, von der Wurzel dhṛ, halten, tragen. Der Dharma im spirituellen Sinn ist die rechte Lebensweise im Einklang mit den vedischen Schriften. Deren Nichtbefolgung ist Adharma.
Das Wort Dharma kann auch Wesen, Charakter, Eigenschaft bedeuten, ebenso wie Religion. So bezeichnen die Hindus ihren Glauben als Sanātana Dharma, die ewige Religion. Detaillierte Lebensregeln und Rechtsbestimmungen wurden von Manu im Dharmashāstra niedergelegt.
Dharma kann auch als Gott auftreten, welcher Recht und Gesetz verkörpert. So heißt es, dass Yudhishthira, der älteste der Pāndavas, von Dharma gezeugt wurde.
Dharmakshetra [kṣetra] n das Feld (kshetra) des Dharma. Im ersten Vers der Bhagavadgītā Bezeichnung für das Feld, auf dem die Pāndavas gegen ihre verfeindeten Vettern, die Kauravas, kämpften, um die höhere Ordnung, Dharma, wiederherzustellen.
Dharma-Megha-Samādhi m der „Dharma-Wolken-Samādhi“, erwähnt in Yogasūtra 4.29. Dies ist die höchste Form des Asamprajñāta-Samādhi, „verbunden mit dem Erlöschen der Kleshas (Leidursachen) und des Karma“ (4.30).
Bezüglich der Bedeutung des Begriffes Dharma-Megha gibt es mehrere Erklärungsversuche. Am überzeugendsten erscheint die Interpretation Shankaras, der in seinem Kommentar zum Yogasūtra schreibt, Dharma-Megha bedeute das Ausschütten (wie ein Wolkenguss) des höchsten Dharma, d.h. von Kaivalya, spiritueller Befreiung.
Dharmapatnī f wörtl. die „Dharma-Gattin“. Eine Bezeichnung für die Ehefrau, die ihrem Gatten gemäß den traditionellen Vorschriften angetraut ist und ihn auf dem Weg der Erfüllung der religiösen Pflichten oder der spirituellen Suche begleitet.
Dharmaputra m der Sohn Dharmas, ein Name Yudhishthiras.
Dharmarāja m der „König des Dharma“, ein Epithet des Todesgottes Yama ebenso wie auch ein Name Yudhishthiras, des ältesten der fünf Pāndava-Brüder.
Dharmashālā f Gerichtshof, Halle; öffentliche freie Unterkunft.
Dharmashāstra, Mānava-Dharmashāstra, [śāstra] n, Manu-Smriti [smṛti] f Lehrbuch des Dharma, d.h. des Rechts und rechten Verhaltens. Siehe Manu-Smriti.
Dharmasūtra n ein Sūtra oder Leitfaden über den Dharma.
Dhārmikāsana n die fromme, hingabevolle Haltung.
dhārmika – fromm; rechtmäßig; āsana – Haltung.
Dhātu m Essenz, essentieller Teil; Mineral; Verbalwurzel.
Dhaumya m Name eines Rishis im Mahābhārata.
Dhautī f Reinigung, Wäsche. Im Hatha-Yoga eine Technik der Magenreinigung mittels eines langen feuchten Tuches, das verschluckt und wieder herausgezogen wird.
Siehe auch Shat-Karma.
Dhenu f Kuh, Milchkuh.
Dhī f spirituelle Intelligenz, Vision, Intuition. Verhilft zur Erkenntnis der höchsten Wahrheit.
Dhīratā f Mut, Selbstbehrrschung, Geisteskraft.
Dhotī [Hindī] f ein langes, weißes Baumwolltuch, das indische Männer traditionell als Beinkleid tragen.
Dhrishtadyumna [dhṛṣṭadyumna] m Name eines Bruders der Draupadī, Sohn von König Drupada.
Dhrishtaketu [dhṛṣṭaketu] m Name eines Sohnes von Dhrishtadyumna.
Dhritarāshtra [dhṛtarāṣṭra] m im Mahābhārata Name des blinden Kaurava-Königs, Sohn Vyāsas und Ambikās. Er hatte mit seiner Frau Gandhārī einhundert Söhne, die unter Führung von Duryodhana gegen die Pāndavas in den Krieg zogen.
Siehe auch Mahābhārata.
Dhriti [dhṛti] f geistige Festigkeit, Stabilität, Beständigkeit, Selbstbeherrschung.
Dhruva adj stabil, fest, dauerhaft. Im Vishnu-Purāna ein Asket, der schon als Kind sein Heim verließ, zum Asketen wurde und durch seine rigorosen Praktiken Vishnu so sehr beeindruckte, dass dieser ihn in den Himmel erhob und zum Polarstern machte.
Dhvaja m Flagge, Emblem, Attribut einer Gottheit.
Dhvani f Klang, Ton. Ein Synonym für Nāda.
Dhyāna n Meditation, Kontemplation. Das Thema „Meditation“ wird u.a. in der Bhagavadgītā 6.10-15 angesprochen, wobei einige Aspekte detailliert erläutert werden. In Vers 10 heißt es: „Ein Yogī sollte sich stets bemühen, seinen Geist zu konzentrieren, indem er in Einsamkeit weilt, Gedanken und Körper unter Kontrolle hält und frei ist von Erwartung und Begehren.“
In den folgenden Versen wird dann das äußere Umfeld beschrieben: Eine saubere Umgebung von natürlicher Schönheit hilft, den Geist anzuregen. Am Ende der Passage wird der Meditierende angewiesen, seinen Geist konzentriert auf Krishna zu richten und so den Frieden zu erlangen, der in Ihm begründet ist und in Nirvāna, Befreiung, gipfelt.
Im Ashtānga-Yoga, dem achtgliedrigen Weg, wird Dhyāna als die siebte Stufe beschrieben, die dem Samādhi vorausgeht. Dazu erklärt Patañjali im Yogasūtra 3.1-2: „Das Fixieren des Geistes an eine Stelle ist Konzentration (Dhāranā). Das beständige Fließen einer einzigen Vorstellung dorthin ist Meditation (Dhyāna).“
Die Sanskrit-Literatur beschreibt vielfältige Formen der Meditation. Ein allgemeiner Grundgedanke ist, in der Stille Abstand zu nehmen von den Impressionen der Sinne und mit tieferen Schichten des eigenen Selbstes in Kontakt zu kommen. Die Meditation über eine unendliche Leere ist ebenso möglich wie über die verschiedenen Aspekte des Göttlichen, über Schönheit, Wahrheit oder die vielen Namen, mit denen Götter oder Göttinnen bezeichnet werden. Die ständige Wiederholung heiliger Wörter oder Namen wird zum Mantra-Yoga, der als innere Übung auch in den Alltag hineingetragen werden kann.
Im Idealfall soll der Meditierende etwas von dem, was er in der Stille erfährt, im äußeren Leben manifestieren und dort z.B. die erlangte innere Ruhe auch unter schwierigen Umständen zunehmend aufrechterhalten.
Im Yoga wurden viele Techniken entwickelt, um den Geist bei der Sammlung zu unterstützen. Eine weit verbreitete Übung besteht darin, entspannt den eigenen Atem zu beobachten und dadurch auf natürliche Weise eine Ruhe zu finden, die den Boden für eine anschließende Meditation bereiten kann.
Wissenschaft und Medizin haben Meditation mit ihren eigenen Mitteln und Instrumenten erforscht und zweifelsfrei festgestellt, dass sie, richtig durchgeführt, positive Auswirkungen auf den menschlichen Organismus hat.
Siehe auch Samādhi.
Dhyānabindu-Upanishad [upaniṣad] f eine der Yoga-Upanishaden, beschäftigt sich mit der Meditation insbesondere mittels der heiligen Silbe Om.
Dhyāna-Mudrā f Meditationsgeste. Eine Mudrā oder symbolische Geste, bei der der Rücken der rechten Hand auf der Handfläche der linken liegt, wobei die Daumenspitzen sich berühren und die Hände im Schoß ruhen. Diese Mudrā bringt einen Zustand der Erleuchtung zum Ausdruck.
Dhyāna-Yoga m Yoga der Meditation. Siehe Dhyāna.
Digambara m den Himmel (diś, dig) als Bekleidung habend, d.h. unbekleidet, nackt. Bezeichnung für Angehörige einer extrem asketischen Jaina-Tradition.
Dikpāla, Dikpati m Hüter einer bestimmten Himmelsregion.
Dilīpa m Name eines Königs im alten Indien, ein Vorfahre Rāmas.
Dīkshā [dīkṣā] f Einweihung, Initiation, spielt eine große Rolle bei vielen traditionellen Yoga-Wegen, insbesondere im Tantra. Einige Schriften erklären, dass Erleuchtung nur durch Einweihung seitens eines qualifizierten Meisters möglich werde. Dabei wird gleichsam ein Funke der inneren Verwirklichung des Gurus auf den Schüler übertragen. Dies kann auf direktem Wege erfolgen, etwa durch einen Blick oder durch Handauflegen, zumeist jedoch mittels eines Mantras, d.h. eine heilige Silbe, ein Wort oder eine Formel.
Dīpāvalī f siehe Divālī.
Dīrghatamas m Name eines vedischen Rishis, der einige Hymnen des Rig-Veda verfasste. Er war der Vater von Kakshivat.
Diti f die Schwester Aditis, Mutter der Asuras oder Dämonen, der „Daityas“. diti bedeutet wörtl. „begrenzt“.
Divālī, Dīpāvalī f [Hindī] ein Lichter-Fest, das fünf Tage lang ab dem Neumondstag von Kārtik, dem achten Monat des Hindu-Kalenders, gefeiert wird. Dabei werden zahllose Lampen auf Hausdächern etc. entzündet, die den Sieg des Lichts über die Dunkelheit, des Guten über das Böse symbolisieren.
Im Sanskrit bedeutet dīpāvali Lichterreihe, nächtliche Erleuchtung. Siehe auch Lakshmī-Pūjā.
Divya adj göttlich. Im Tantra eine der drei Hauptkategorien von Suchern.
Der Divya-Typus ist unwiderruflich im göttlichen Bewusstsein verankert und strahlt Liebe und Wahrhaftigkeit aus. Für ihn sind Rituale nicht mehr notwendig, aber er kann sie weiterhin durchführen, um anderen ein Beispiel zu geben.
Siehe auch Pashu, Vīra.
Divya-Cakshu [cakṣu] m „göttliches Auge“, die okkulte Fähigkeit der Hellsichtigkeit, die manchen Yogīs zugeschrieben wird.
Siehe auch Siddhi.
Divya-Shrota [śrota] n „göttliches Hören“, die okkulte Fähigkeit des Hellhörens, die manchen Yogīs zugeschrieben wird.
Siehe auch Siddhi.
Dolāsana n die Schaukel-, Pendelhaltung.
dola – hin und her bewegen, schwingen; āsana – Haltung.
Dosha [doṣa] m Fehler, Defekt. Bezeichnet Impulse und Neigungen wie Lust, Begierde, Trägheit etc., welche für die Yoga-Praxis hinderlich sind.
Im Āyurveda bezeichnet „Dosha“ die drei Humore oder Körpertemperamente Kapha, Pitta und Vāta, aus deren Zusammenwirken körperliche und geistige Vorgänge erklärt werden.
Drashtri, Drashtā [draṣṭṛ, draṣṭā] m Seher. Im Yogasūtra das Selbst, das den Strom geistiger Abläufe als Zeuge betrachtet.
Draupadī f im Mahābhārata die Tochter von König Drupada und Ehefrau der fünf Pāndavas. Arjuna gewann sie bei ihrem Svayamvara, als er einen Wettbewerb im Bogenschießen für sich entschied. Als die fünf Brüder nach Hause kamen und ihrer Mutter zuriefen, sie hätten ein großes Geschenk erworben, antwortete sie, ohne Draupadī zu sehen, sie sollten es alle brüderlich teilen. Daraufhin akzeptieren die Pāndavas ihr Wort und wurden Draupadīs gemeinsame Gatten.
Draupadī tritt im Verlaufe des Mahābharata als sehr selbstbewusste und selbstbestimmte Frau auf, die in kritischen Situationen mutig eingreift oder ihre Gatten zur Aktion mahnt. Im Gegensatz zu Rāmas Frau Sītā, die immer treu und unterwürfig ist, hat Draupadī eine rebellische Natur und bekräftigt wiederholt ihre Rechte als Frau in einer dominanten Männer-Welt. Ihre fünf Söhne starben in der großen Schlacht bei Kurukshetra.
Draviden, Drawiden Name der Urbevölkerung Indiens, Sprecher der dravidischen Sprachen.
Die Draviden sind in der Südhälfte Indiens beheimatet, einige kleine Sprachinseln finden sich auch noch weiter nördlich. Die vier wichtigsten dravidischen Sprachen Tamil, Telugu, Malayalam und Kannada werden in Tamil Nadu, Andhra, Karnataka und Kerala von insgesamt über 200 Millionen Menschen gesprochen.
Die akademische Indologie geht davon aus, dass diese Sprachen in keiner Weise mit den indogermanischen verwandt sind, doch haben einzelne Forscher immer wieder auf gemeinsame Wurzeln hingewiesen. So vertrat Sri Aurobindo in seinem Werk Das Geheimnis des Veda die These einer verborgenen Verwandtschaft des Sanskrit und Tamil und führte eine Reihe von Belegen dafür an. Auch der Linguist Aharon Dolgopolsky sah diese beiden Sprachen vereint in der „nostratischen“ Sprachgruppe.
Manche Forscher glauben, dass die Draviden einige Tausend Jahre v. Chr. nach Indien eingewandert sind, etwa aus dem östlichen Iran (K.V. Zvelebil). Ebenso wird auch vermutet, dass Proto-Draviden die Indus-Kultur (ca. 2800 – 1800 v. Chr.) begründet haben könnten, was andere Gelehrte jedoch zurückweisen. Solange die Schriftzeichen dieser Kultur nicht beweiskräftig entziffert sind, lässt sich diese Frage nicht endgültig klären.
Die von westlichen Indologen aufgestellte These einer „arischen Einwanderung“ ca. 1500 v. Chr. hatte letztlich auch politische Folgen in Form einer bewusstseinsmäßigen Konfrontation nördlicher Arier und südlicher Draviden, wobei die letzteren z.B. gegen die Dominanz des in Nordindien beheimateten Hindī protestierten und die Schönheit und Bedeutung ihrer eigenen Sprachen hervorhoben. Insbesondere die Tamilen sind stolz auf die lange Geschichte und wertvolle Literatur ihrer Tamil-Sprache, deren erste Inschriften aus der Zeit von Kaiser Ashoka (3. Jh. v. Chr.) stammen.
Drishti [dṛṣṭi] f Blick, Sichtweise, Ansicht. Die Art des Blickes während der Meditation, d.h. geschlossen, halb geschlossen oder offen.
Drishya [dṛṣya] n das Sichtbare, Gegenständliche. Im Yogasūtra ein Synonym für Prakriti.
Drona, Dronācārya [droṇa, droṇācārya] m Name eines prominenten Kampfkunstlehrers im Mahābhārata. Er unterwies sowohl die Pāndavas als auch die Kauravas und kämpfte im Krieg auf Seiten der letzteren. Nachdem Bhīshma gefallen war, führte Drona die Armee der Kauravas.
Drupada m Name des Königs der Pañcālas, Vater der Draupadī, der Ehegattin der Pāndavas.
Dschainismus siehe Jainismus.
Duhkha [duḥkha] n Schmerz, Leid, Sorge, gehört dem persönlichen Ich an und kann durch Yoga reduziert werden. So heißt es in der Bhagavadgītā 6.23: „Dies möge man als Yoga erkennen, das Erlöschen der Verbindung mit der Sorge.“
Duhshāsana [duḥśāsana] m einer der hundert Söhne des Dhritarāshtra. Er demütigte Draupadī, die Ehegattin der Pāndavas, in einer dramatischen Szene im Mahābhārata.
Durgā f bedeutet „schwer zugänglich“ (dur-gā). Die Gefährtin Shivas, mit einem kriegerischen und zerstörerischen Aspekt. Für ihre Anbeter zerstört sie deren Unwissenheit und räumt Hindernisse aus dem Weg. Sie erlegte auch viele Asuras wie Mahisha.
Durgāpūjā, die „Anbetung Durgās“, ist eine religiöse Feier zu Ehren der Göttin, insbesondere in Bengalen.
Durvāsas, Durvāsā m Name eines Asketen der vedischen Zeit, der für seine extreme Reizbarkeit wie auch seine übernatürlichen Kräfte bekannt war. Er war der Sohn von Atri und Anasūyā.
Durvāsāsana n Durvāsā-Haltung.
durvāsā - Eigenname eines Asketen; āsana – Haltung.
Duryodhana m Name des ältesten der einhundert Söhne des Kaurava-Königs Dhritarāshtra. Er ist im Mahābhārata der große Gegenspieler seiner Vettern, der Pāndavas, die er aufgrund von Neid und Eifersucht schon seit seiner Kindheit hasste.
Er verursachte ihnen viel Leid, verhinderte eine Einigung über die Nachfolge im Königreich und war letztlich verantwortlich für den Ausbruch des großen Krieges. In der Schlacht wurde er von Bhīma erlegt.
Dushkarman [duṣkarman] n böswillige Handlung, sündige Tat.
Dushyanta [duṣyanta] m Name eines Königs der Mond-Dynastie, Ehegatte Shakuntalās und Vater Bharatas.
Dvaipāyana m der „Insel-Geborene“, ein Name Vyāsas, der auf einer kleinen Insel im Ganges geboren wurde.
Dvaita n Zweiheit, Dualität.
Siehe auch Advaita
Dvaitādvaita-Vedānta m die Lehre von der Dualität und Nicht-Dualität (dvaita-advaita). Bezeichnung für eine Philosophie des dualistischen Nicht-Dualismus, welche besagt, dass das Brahman im Prinzip Eines ist, aber drei verschiedene Formen annimmt als unbelebte Welt, als individuelle Seele und als der persönliche Gott, Īshvara. Der Hauptvertreter dieser Lehre war Nimbārka.
Dvaita-Vedānta m eine dualistische Version der Vedānta-Philosophie, deren bekanntester Vertreter Madhva war. Die Unterschiede zwischen Gott, Welt und Einzelseele als getrennte Wesenheiten werden stark hervorgehoben.
Dvandva n Paar. Die Paare von Gegensätzen wie Schmerz und Freude, Licht und Dunkelheit, Hitze und Kälte. Der Yogī sucht diesen Polaritäten mit Gleichmut zu begegnen, wobei ihn Praktiken wie Āsana oder Prānāyāma unterstützen können.
Dvāpara-Yuga m das dritte der vier Weltzeitalter, siehe Yuga.
Dvārakā, auch Dvārkā, Dwārkā f Stadt an der indischen Westküste, am Arabischen Meer im heutigen Gujerat. Krishna zog mit seinen Stammesleuten, den Yādavas, dorthin, um sich den ständigen Angriffen König Jarasamdhas in Mathurā zu entziehen und in Frieden leben zu können. Der König hatte ihn achtzehnmal angegriffen, war jedoch stets besiegt worden.
Nach Krishnas Tod versank die Stadt im Wasser. In den 1980er Jahren wurden die mutmaßlichen Überreste der alten Stadt von dem indischen Archäologen S.R. Rao entdeckt.
Dvārapālaka m Torwächter, plaziert am Eingang eines Tempels oder Schreines. In der Hand trägt der Wächter oder (bei Göttinnen) die Wächterin das Emblem der jeweiligen Gottheit des Tempels.
Dvesha [dveṣa] m Hass, Zorn, Abneigung. Im Yogasūtra einer der fünf Kleshas, d.h. Leidursachen.
Dvi zwei. Dvi-hasta in Āsana-Bezeichnungen bedeutet mit zwei Händen, Dvi-pāda, mit zwei Füßen oder Beinen.
Dvija m ein Zweimal-Geborener, dvi-ja. Bezeichnung für die Angehörigen der ersten drei Kasten, d.h. Brahmanen, Kshatriyas und Vaishyas.
Der Begriff bezieht sich insbesondere auf die Brahmanen, die durch die Bekleidung mit der heiligen Schnur (Upanayana) eine zweite Geburt erfahren.
Siehe auch Kaste.
Dvīpa m oder n Insel, Halbinsel. In den Purānas Bezeichnung für ringförmige Sphären des Universums, die um den Berg Meru herum verlaufen. Die bedeutendste und zentrale ist Jambudvīpa.
Dvipādapīthamāsana, dvi-pāda-pītham-āsana n die Haltung des Hockers mit zwei Beinen; Schulterbrücke.
dvi – zwei; pāda – Bein; pīṭham – Hocker, Bank; āsana – Haltung.
Dvipādaviparītadandāsana,
Dvi-pāda-viparīta-dandāsana n
Zwei-Bein-umgekehrte-Stockhaltung; Kopfstandbrücke.
dvi – zwei; pāda – Bein; viparīta – umgekehrt; daṇḍa – Stock; āsana – Haltung.