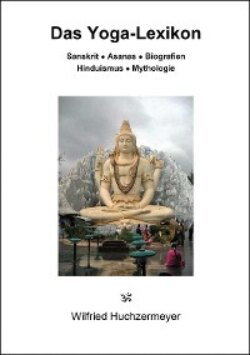Читать книгу Das Yoga-Lexikon - Wilfried Huchzermeyer - Страница 8
ОглавлениеA
A der erste Buchstabe des Sanskrit-Alphabets. Bedeutet oft als Vorsilbe am Anfang eines Wortes „nicht“ oder „un“ wie z.B. a-dharma, nicht-dharma. Vor Vokalen wird es zu an: an-ātman, Nicht-Selbst.
Vergl. dt. A-nomalie, Un-wissenheit.
Ābhāsa m Schein, Erscheinung; irrtümliche Vorstellung, falscher Anschein.
Abhāva m Nicht-Sein, Nicht-Existenz (a-bhāva); Abwesenheit.
Siehe auch Asat.
Abhāva-Yoga m „Yoga des Nicht-Seins“, in einigen Purānas erwähnt als Weg, bei dem über das eigene Wesen oder die Welt als Leere kontempliert wird.
Abhaya n Furchtlosigkeit. Die Bedeutung der Freiheit von Furcht wird in vielen Yoga-Texten hervorgehoben.
Abhayamudrā f Handgeste der Freiheit von Furcht und Gefahr (a-bhaya), d.h. der Sicherheit und des Schutzes. Eine Geste mit der erhobenen, offenen rechten Hand, die dem Empfänger des Segenswunsches zugewandt wird.
Abheda m Nicht-Zweiheit. Abheda-Jñāna ist das Wissen vom Einssein aller Dinge.
Siehe auch Bheda, Bhedābhedavāda.
Abhidhāna n Name, Titel; Vokabular, Wörterbuch.
Abhimāna m persönlicher, egoistischer Stolz; verletzter Stolz; Hochmut; ein Hindernis auf dem Weg des Yoga.
Abhimanyu m der Sohn von Arjuna und Subhadrā. Er heiratete Uttarā, und ihr Sohn Parikshit folgte König Yudhishthira auf dem Thron in Hastināpura nach.
Siehe auch Mahābhārata.
Abhinavagupta m ein bedeutender Philosoph des Kaschmir-Shivaismus (ca. 950-1020).
Abhinivesha [abhiniveśa] m Hingabe, Liebe. Zuneigung.
Im Yogasūtra 2.9 Lebensdrang, Anklammern ans Leben, d.h. einer der fünf Kleshas oder Leidursachen. V.S. Apte interpretiert diesen Begriff in seinem Sanskrit-Englisch-Wörterbuch als „eine Art von Unwissenheit, die Furcht vor dem Tod hervorruft; ein instinktives Festhalten am weltlichen Leben und körperlichen Freuden und die Furcht, dass man von ihnen allen durch den Tod abgeschnitten wird.“
Andere Interpreten sprechen von einem Urdrang zum Leben an sich.
Abhisheka [abhiṣeka] m das Benetzen oder Besprühen mit geweihtem Wasser. Eine Taufzeremonie bei der Initiation insbesondere im Tantrismus.
Abhyanga [abhyaṅga] m Salbung, Massage.
Ābhyantara-Vritti [vṛtti] f wörtl. innere Bewegung, Funktion; eine Übung mit tiefer und lang anhaltender Einatmung.
Abhyāsa m beständige Praxis. Im Yoga die regelmäßige Durchführung von Übungen.
Siehe auch Vairāgya, Abs. 2
Acala adj und m unbeweglich, fest; Berg.
Ācamana n Nippen, Schlürfen. Das Schlürfen von Wasser aus der Handfläche vor einem Ritual, vor Mahlzeiten etc. zwecks symbolischer Reinigung.
Ācāra m Verhalten, rechtes Benehmen; auch Methode oder Weg, wie z.B. in Dakshinācāra.
Ācārya, Āchārya m Lehrer, Gelehrter. Im Yoga ein spiritueller Lehrer, dem besondere Verehrung entgegengebracht wird, da er den Weg zur Erkenntnis weist.
Accha adj rein, klar, ohne Schatten. Im Hindī bedeutet das Wort „gut, o.k.“
Acintya adj undenkbar, unvorstellbar. Das Brahman, das unendliche Absolute, ist für unser mentales Denken unerfassbar.
Acintya-Bhedābheda-Tattva n das Prinzip von der unvorstellbaren Verschiedenheit und Nichtverschiedenheit, bezieht sich auf die gleichzeitige Verschiedenheit und Einheit von Materie und Geist.
Eine von Caitanya begründete philosophische Tradition des Vedānta.
Acit nicht-Cit, d.h. unbewusst. Siehe auch Cit.
Acro Yoga m eine Variante des Partner-Yoga mit akrobatischen Elementen, enwickelt von den Amerikanern Jason Nemer und Jenny Sauer-Klein. Neben Āsanas und dem akrobatischen Ansatz kommen als dritte Komponente Elemente aus der Thai-Massage hinzu mit Dehnungen und Streckungen, die den Muskelapparat entspannen.
Acyuta adj und m „nicht gefallen“, fest, unveränderlich. Name Krishnas in der Bhagavadgītā: Er bleibt stets im Einklang mit seiner göttlichen Natur und fällt nicht von ihr ab.
Adbhuta adj wunderbar, übernatürlich.
Ādhāra m Halter, Behältnis; Basis. Regionen im Körper, auf die der Yogī sich energetisch konzentriert (bis zu 16 werden genannt, von denen einige mit den Cakras identisch sind). Auch eine Bezeichnung für das menschliche psychophysische System als Basis des Yogas.
Adharma m Nicht-Dharma, das Fehlen von Recht und Redlichkeit. In der Bhagavadgītā 4.7 erklärt Krishna: „Immer wenn Dharma verfällt und Adharma wächst, manifestiere ich mich.“ Siehe auch Dharma.
Adhibhautika adj elementar, materiell.
Adhibhūta adj und n das Materielle, Physische, Gewordene.
Adhidaiva adj und n das Kosmische, Göttliche; die höchste Gottheit.
Adhikāra m Fähigkeit, Autorität. Die Befähigung eines Aspiranten für einen Yoga-Pfad, indem die rechten Voraussetzungen wie Aufrichtigkeit, Stetigkeit etc. gegeben sind.
Adhikārī, Adhikārin m jemand, der Adhikāra hat.
Adhishthāna [adhiṣṭhāna] n Basis, Grundlage, Stütze; zugrundeliegende Wahrheit; Wohnsitz, Residenz.
Adho-mukha „mit dem Gesicht nach unten“, ein Wortelement in Āsana-Bezeichnungen.
Adhomukhashvanāsana, adho-mukha-shvan-āsana n die Haltung des Hundes, dessen Gesicht nach unten zeigt; Hundestreckung.
adhaḥ – unten; mukha – Gesicht; śvan – Hund; āsana – Haltung. Nach einem Lautgesetz wird adhaḥ zu adho.
Adhomukhavrikshāsana, adho-mukha-vrikshāsana n die Baumhaltung mit Gesicht nach unten; Handstand.
adhaḥ – unten; mukha – Gesicht; vṛkṣa – Baum; āsana – Haltung. Nach einem Lautgesetz wird adhaḥ zu adho.
Adhvara m Opfer, besonders das Soma-Opfer.
Adhvaryu m einer der Hauptpriester beim vedischen Opfer, der Sprüche aus dem Yajurveda vorträgt.
Adhyāropa m in Shankaras Philosophie die fälschliche Überdeckung der Wirklichkeit mit einer irrtümlichen Vorstellung, indem man zum Beispiel in der Dunkelheit ein herumliegendes Tau für eine Schlange hält. In gleichem oder ähnlichem Sinn werden auch die Begriffe Adhyāsa und Vikshepa verwandt.
Adhyāsa m siehe Adhyāropa.
Adhyātma-Yoga m Yoga zur Verwirklichung des höchsten Selbstes, u.a. erwähnt in der Katha-Upanishad 1.2.12. adhi-ātma bedeutet: was sich auf das Selbst bezieht.
Ādhyātmika adj auf das höchste Selbst, Ātman, bezogen; spirituell.
Adhyayana n Lesen, Studieren, besonders der vedischen Texte.
Ādi m Anfang, Ursprung. In vielen Komposita bedeutet es „erster, erste“, z.B. Ādikavi, der erste Dichter, ein Epithet Vālmīkis, oder Ādiguru, der erste oder ursprüngliche Guru, d.h. die Gottheit, welche als Begründerin einer religiösen Sekte gilt.
Ādinātha m der ursprüngliche Herr, ein Beiname Shivas.
Ādīshvara [ādīśvara] m der ursprüngliche Herr, ein Beiname Shivas.
Aditi adj und f unendlich, grenzenlos. Höchste Natur, unendliches Bewusstsein. Im Veda Mutter der Götter, der Ādityas.
Siehe auch Deva (letzter Abs.).
Āditya m Sonne, Sonnengott. Die Ādityas sind die Söhne von Aditi.
Advaita-Vedānta m philosophisches System, dessen bekanntester Vertreter Shankara ist. a-dvaita bedeutet Nicht-Zweiheit, Nicht-Dualität. So handelt es sich um einen monistischen Vedānta, der letztlich Gott, Welt und Seele als eins und identisch sieht.
Die Welt der Dualität mit ihren vielfältigen Erscheinungen wird nicht an sich geleugnet, aber als irrealer Schein (Māyā) einer ichbezogenen Wahrnehmung analysiert.
Eine moderne Advaita-Bewegung, von Außenstehenden auch „Neo-Advaita“ genannt, geht auf H.W.L. Poonja zurück, dessen Schülerinnen und Schüler eine „Satsang-Bewegung“ begründeten. Im Neo-Advaita werden traditionelle Elemente indischer Spiritualität mit Ansätzen westlicher Psychologie verbunden.
Advāsana n entspannte Bauchlage. (Wort-Herkunft ungeklärt.)
Advaya-Tāraka-Upanishad [upaniṣad] f die Upanishad „des nicht-dualen Erlösers“, womit das transzendente Bewusstsein gemeint ist, welches sich in vielfältigen Lichterscheinungen offenbart. Eine Yoga-Upanishad, welche den Tāraka-Yoga darlegt.
Ādyashakti [ādyaśakti] f die uranfängliche (ādya) Kraft (shakti) des Universums; das göttliche Bewusstsein, das alles durchdringt und erfüllt.
Affen [Skrt. Vānara, Kapi] gelten den Hindus als heilige Tiere, weil sie dereinst – unter Führung des Hanumān – Rāma halfen, seine von Rāvana entführte Frau Sītā zurückzugewinnen.
Siehe auch Rāmāyana.
Āgama m Herkunft, Tradition, Zeugnis. Bezeichnet allgemein heilige Schriften und speziell tantrische Texte in der Tradition Shivas. In der Yoga-Philosophie Erkenntnis auf der Grundlage von authentischer Bezeugung durch eine vertrauenswürdige Autorität.
Āgāmi-Karma n künftiges Karma, das durch Handlungen in der Gegenwart ausgelöst wird.
Siehe auch Karma.
Agastya m Name eines berühmten Sehers im alten Indien, der mehrere Hymnen des Rigveda verfasst hat. Er gilt als Ahnherr der südindischen dravidischen Kultur, insbesondere der Tamil-Sprache und –Literatur. Im Rāmāyana erscheint der Weise als väterlicher Freund und Ratgeber Rāmas.
Aghora adj „nicht-furchtbar“, ein euphemistisches Epithet Shivas. Auch Bezeichnung für Anbeter Shivas und Durgās.
Agni m Feuer, Gott des Feuers. Im Rigveda ist Agni eine der wichtigsten Gottheiten, zahlreiche Hymnen sind ihm gewidmet. Als Mittler trägt er die Opfer der Menschen zu den Göttern. Er wird auch „der Unsterbliche in Sterblichen“ genannt und ist den Menschen ein Schirmherr und Helfer.
Er wird u.a. beschrieben als Agni Jātavedas, der Kenner aller Geburten; Agni Pāvaka, der Reinigende; Agni Tvashtā, der Schöpfende oder Gestaltende; Agni Vaishvānara, der Universelle, Allgegenwärtige.
Agnihotra n Ritus des Feueropfers, das viele Hindus täglich darbringen in Form von Milch, Öl und Grütze, welche morgens und abends in das Feuer gegeben werden.
Im tieferen Sinne steht das äußere Opfer symbolisch für eine innere Hinwendung zum Göttlichen.
Derjenige, der das Agnihotra ausführt, heißt Agnihotrin.
Agni-Purāna [purāṇa] n eines der 18 Mahāpurānas, wurde von Agni dem Seher Vasishtha mitgeteilt. Hauptanliegen des Textes ist die Verherrlichung Shivas, doch werden auch zahllose andere Themen abgehandelt.
Agnivesha [agniveśa] m Name eines vedischen Rishis, der als Autorität in der Heilkunde galt.
Ahalyā f die Frau des Rishis Gautama. Einst wurde sie von Indra verführt, der die Form des Gautama annahm und sie dadurch täuschte. Während der Rishi seine Frau verfluchte und in einen Fels verwandelte, verwünschte sie, nachdem Rāma sie aus ihrem Zustand befreit hatte, den Gott Indra, so dass er eine abstoßende Hautkrankheit bekam.
Ahalyā steht im Hinduismus für die überaus treue Ehefrau, die trotz falscher Anschuldigung des Ehebruchs zu ihrem Ehemann hält.
Agni-Sāra-Dhautī f Reinigung (dhautī) mittels (sāra) Feuer (agni), auch Vahni-Sāra-Dhautī genannt. Eine Reinigungstechnik, bei der der Nabel wiederholt gegen die Wirbelsäule gedrückt wird. Diese Praktik, beschrieben in der Gheranda-Samhitā, soll das Verdauungsfeuer anfachen und Magenkrankheiten heilen.
Agni-Yoga (1) m ein Yoga der Erweckung der Kundalinī, begründet von Russell Paul Schofield.
Agni-Yoga (2) m eine spirituelle Lehre, die in der ersten Hälte des 20. Jhs. von dem russischen Maler Nicholas Roerich und seiner Frau Helena übermittelt wurde. Sie soll auf okkultem Wege empfangen worden sein von Meister Morya, dem Guru Helena P. Blavatskys, der Gründerin der Theosophischen Gesellschaft.
Agni-Yoga sieht Agni, das „Feuer“, als eine wertvolle und starke transformative Energie, welche von großer Bedeutung ist im kommenden Neuen Zeitalter der Menschheit. Diese Energie manifestiere sich sowohl im physischen als auch im subtilphysischen Bereich und soll geläutert werden, um einen konstruktiven Umgang mit den evolutionären kosmischen Kräften zu gewährleisten.
Die Anhänger des Agni-Yoga glauben, dass künftig eine Bruderschaft von Mahātmās oder Adepten aus Shambhāla, einem mystischen Ort im Himālaya, die Menschheit regieren werde.
Aham bedeutet im Sanskrit „ich“ und meint in der Regel das persönliche, begrenzte Selbst, kann jedoch auch das unendliche spirituelle Selbst, Ātman, bezeichnen.
aham brahmāsmi „ich bin Brahman“ (ahaṁ brahma asmi). Einer der bekanntesten großen Lehrsprüche (Mahāvākya) der vedischen Tradition: Im Zustand der Erleuchtung erfährt das persönliche Ich sein Einssein mit dem höchsten Absoluten.
Ahamkāra m [ahaṁkāra] der „Ich-Macher“, das persönliche Ichbewusstsein. In der Sānkhya-Philosophie ein Teil des Antahkarana, des inneren Organs, das aus Buddhi, Ahamkāra und Manas besteht und die Grundlage aller geistigen Vorgänge ist.
Während Manas die Informationen der Erscheinungswelt aufnimmt und ordnet, schafft Ahamkara den individuellen Bezugspunkt für deren Verarbeitung: Es existiert dadurch ein persönliches Ich, das „anders ist als die anderen“, und auf dieser Basis des Separat-Seins entsteht erst die Vielheit der Wahrnehmungen, Wünsche, Willensakte.
Buddhi wiederum, als höchstes Element in dieser Dreiergruppe – und überhaupt in der Prakriti – besitzt die Intelligenz und die Fähigkeit, zu Erkenntnissen zu gelangen.
Āhāra m Nahrung, Ernährung.
Siehe auch Ernährung.
Ahimsā [ahiṁsā] f Gewaltlosigkeit, das Nicht-Verletzen in Gedanke, Wort und Tat. Eine der fünf ethischen Leitlinien der ersten Stufe des Rāja-Yoga.
Das Prinzip der Ahimsā wurde weltweit durch Mahatma Gandhi bekannt, der es zu einer Grundlage des indischen Freiheitskampfes machte.
Ursprünglich wurde Ahimsā jedoch von den Jainas und Buddhisten entwickelt, bevor es später auch im Hinduismus Einzug hielt.
Āhlāda m Freude, Glückseligkeit.
Āhlādinīshakti [śakti] f die göttliche Kraft, welche Glückseligkeit bringt; ein Name Rādhās.
Aikya n Einheit, Einssein, Vereinigung, Identität (mit dem Höchsten). Ein Zustand jenseits des Kreislaufs von Geburt und Tod.
Airāvata m Indras Reittier, ein weißer Elefant mit vier Stoßzähnen; gilt auch als Urahn der Elefantengattung. Er trat beim Quirlen des Milchozeans hervor.
Aishvara-Yoga [aiśvara] m in der Bhagavadgītā die Einheit des Herrn mit allem Dasein, dem er als höchstes Wesen (Īshvara) vorsteht.
Aishvarya [aiśvarya] n Herrschaft, Macht. Bezeichnet auch übernatürliche Kräfte eines Yogīs, die ihm eine Meisterschaft in seiner Beziehung zum Kosmos verleihen.
Aitareya-Upanishad [upaniṣad] f eine der älteren Upanishaden, erläutert den Ursprung der Welten aus dem Alleinigen Ātman, die Loslösung vom Kreislauf der Geburten und das Wesen des höchsten Selbstes.
Aitareya ist der Name einer Tradition, die auf den Rigveda zurückgeht.
Aiyanār [Tamil] in den Dörfern Tamil Nadus die legendäre Gestalt eines Nachtwächters, der auf einem Pferd Patrouille reitet und böse Geister verscheucht.
Aja adj ungeboren, nicht geboren (a-ja).
Ajapa-Mantra m die unwillkürliche Äußerung eines Mantras. So wird nach der Lehre des Hatha-Yoga mit jedem Atemzug der Laut ham-sa geäußert, was zu einem kontinuierlichen Mantra ham-sa-ham-sa mit der Bedeutung „ich bin Er“ und „Er bin ich“ wird.
aham – ich; saḥ – er; saḥ aham wird nach einer Lautregel zu so’ham.
Ajātashatru [ajātaśatru] adj oder m keine Feinde (shatru) habend; keine ebenbürtigen Gegner habend. Name Indras, Shivas und Yudhishthiras.
Ājñā-Cakra n eines der sieben feinstofflichen Energiezentren im menschlichen System. Es liegt an der Nasenwurzel zwischen den Augenbrauen und wird visualisiert als ein weißer Lotus mit zwei Blütenblättern. Darauf findet sich ein nach unten weisendes Dreieck als Symbol der Yonī, mit einem Linga darin. Die Keimsilbe ist OM, die Gottheiten sind Vishnu und Hākinī, das Tattva oder Grund-Element ist der Geist, Manas.
Diesem Cakra zugeordnet sind die Funktionen von Gedanke, Wille und Vision. ājñā bedeutet Weisung, Anordnung, daher nennt man es auch „Guru-Cakra“, weil der Schüler hier die inneren Weisungen des Gurus empfängt.
Ajñāna n Unwissenheit, identisch mit Avidyā. Das Nichtwissen, das zur Identifizierung mit dem Vergänglichen und Sterblichen führt und der wahren Erkenntnis, Jñāna, entgegensteht.
Akāma adj wunschlos, bedürfnislos. Eine Eigenschaft des Yogīs, der im höheren Selbst lebt und dort alle Erfüllung findet.
Akarman n das Nichttun, Tatenlosigkeit. In der Bhagavadgītā (3.8-9) wird ausgeführt, dass ein als Opfer dargebrachtes Handeln segensreicher sei als Inaktivität.
Ākarnadhanurāsana, ākarna-dhanur-āsana n die Haltung des bis zum Ohr gespannten Bogens. Pfeil und Bogen.
ā-karṇa – bis zum Ohr (der Ausdruck wird beim Bogenschießen gebraucht, wenn der Pfeil bis ans Ohr heran gespannt wird); dhanuḥ – Bogen; āsana - Haltung. Nach einem Lautgesetz wird dhanuḥ zu dhanur.
Ākāsha [ākāśa] m Raum, Äther. In älteren Texten der unendliche Raum als Bild für das höchste Selbst. Später eines der fünf Elemente des manifestierten Kosmos. Es ist das feinstofflichste Element und erfüllt das ganze Universum als subtiler Träger von Leben und Klang. Siehe auch Bhūta.
Ākāsha-Chronik in der Esoterik Bezeichnung für die Computer-Festplatte des Universums, auf der alle vergangenen Ereignisse detailliert gespeichert seien, welche von medial begabten Personen eingesehen werden können.
Ākāshagamana n das „Himmelsgehen“ oder Reisen im Äther. Eine übernatürliche Fähigkeit (Siddhi) des Yogīs, von der u.a. mehrfach in Paramahansa Yoganandas Autobiographie eines Yogi berichtet wird.
Auch in der alten indischen Tradition gibt es Zeugnisse. So heißt es in Mahābhārata 12.314.26, dass eines Tages Shuka, der Sohn des Mahābhārata-Autors Vyāsa, eine Reise zu König Janaka antrat. Daraufhin ermahnt ihn sein Vater, er möge „auf natürliche Weise“ reisen, nicht mittels yogischer Kräfte. Aber am Ende der Episode reist Shuka dann doch „auf dem ätherischen Wege“ vom Hof des Königs in die Berge des Himālaya, wo sein Vater einige Schüler unterrichtet. Dieser sieht seinen Sohn heranschweben „wie ein leuchtendes Feuer, ähnlich der Sonne, nicht Bäume oder Felsen berührend.“
Siehe auch Laghiman.
Akhanda-Kīrtana [akhaṇḍa] n das ununterbrochene Chanten von Gottesliedern.
Siehe auch Kīrtana.
Akrūra m Name eines Onkels von Krishna, der auch sein Berater war.
Akshamālā [akṣamālā] f Perlenkette, Rosenkranz. Dieser besteht meist aus fünfzig Perlen, welche für die Schriftzeichen des Sanskrit-Alphabets stehen. Aksha bedeutet getrocknetes Samenkorn.
Die Akshamālā ist das Attribut einiger Götter und kann auch aus getrockneten Beeren oder Schädeln bestehen.
Akshara [akṣara] adj und n unvergänglich, unzerstörbar. Das Wort bedeutet auch allgemein „Silbe“ und speziell die Ursilbe Om.
Akūpāra m Name einer mythischen Schildkröte, welche die Erde trägt.
Akushala [akuśala] adj Unheil bringend (a-kuśala).
Alakā f Name des Wohnsitzes von Kubera hoch im Himālaya, wo auch Shiva residiert.
Alakanandā f Name eines Quellflusses des Ganges, der im Himālaya entspringt. Der Name bedeutet wörtlich „die Haarlocken-Erfreuende“ (alaka-nandā), weil der Strom durch Shivas Haarlocken zur Erde floss.
Ālamba m Stütze, Halt. Ein Wortelement in Āsana-Bezeichnungen.
Alambushā-Nādī [alambuṣā-nāḍī] f einer der feinstofflichen Nervenkanäle (Nādī), durch welche die Lebenskraft im Körper fließt. Er endet im Mund.
Ālasya n Trägheit, Faulheit. In vielen Texten als Hindernis auf dem Weg genannt.
Ālaya m Stätte, Wohnung.
Alfassa, Mira siehe Mutter, Die.
Alignment [engl., Aussprache wie line] Ausrichtung. Die innere, körperliche oder energetische Ausrichtung bei der Durchführung von Āsanas.
Alinga [aliṅga] adj oder n das, was keine Kennzeichen hat, was undifferenziert ist. Auch eine Bezeichnung für die Prakriti im nicht-manifestierten Zustand.
Allahābād bekannter Pilgerort am Ganges, siehe Prayāga.
Alvars [ālvārs, Tamil, „in Meditation versunken“] zwölf südindische Dichter und Bhaktas, die zwischen dem 6. und 9. Jh. als glühende Anbeter Vishnus viele inspirierte Hymnen in der Tamil-Sprache verfassten. Diese wurden von Nāthamuni im Nalayira-Prabandha zusammengestellt.
Siehe auch Andal, Nammalvar.
Ama adj und m unreif, unverdaulich; Leid, Krankheit.
Im Āyurveda Bezeichnung für Schlackenstoffe, die durch unverdauliche Nahrung verursacht werden.
Amala adj rein, fehlerlos.
Amanaskatā f ein Zustand der Erleuchtung, in dem das Denken transzendiert wird. (a-manaska-tā, Nicht-Intellekt-heit)
Amarāvatī f die Wohnstätte der Unsterblichen (amara); Indras Wohnsitz im Himmel, liegt der Legende nach nahe dem Berg Meru.
Ambā f Mutter, Shakti, die göttliche Mutter.
Ambikā f Mutter, gute Frau. Name Pārvatīs, der Gattin Shivas.
Amma, Mata Amritanandamayi [ammā, mātā amṛtānandamayī] wörtl. „Mutter“, „die glückselige Mutter“. Bedeutende indische Heilige und Bhakti-Yoginī.
Amma wurde 1953 in Kerala als Kind mittelloser Fischer geboren und musste in ihrer Kindheit und Jugend schwere Lebensumstände ertragen, da sie aufgrund ihrer sehr dunklen Hautfarbe von ihrer Familie schlecht behandelt wurde. Doch schon früh hatte sie mystische Erfahrungen, sang devotionale Lieder, die ihr niemand beigebracht hatte, und fühlte die Nähe zum Göttlichen.
Sie zeigte großes Mitgefühl gegenüber den meist schlechtgestellten Menschen in ihrer Umgebung und half ihnen, wo immer es möglich war. Mit 17 Jahren erreichte sie einen Zustand tiefer Gottverwirklichung und sah hinfort die Welt als Manifestation des allerfüllenden Einen.
Im Anschluss an eine Phase intensiver spiritueller Übungen erfuhr sie die Vision der göttlichen Mutter und wurde eins mit ihr. Nachdem sie Monate in diesem glückseligen Zustand verbracht hatte, sagte eine innere Stimme ihr, sie solle diese Freude mit den Menschen teilen, was sie seitdem tat.
In ihrer Begegnung mit Menschen verkörpert Amma auf lebendige Weise Bhakti-Yoga und vermittelt ihnen sehr unmittelbar die Erfahrung göttlicher Liebe, indem sie alle Anwesenden herzlich umarmt. Manchmal sind es Tausende, in Europa, manchmal Zehntausende, in Indien, die bei Treffen in riesigen Hallen so ihren persönlichen Kontakt erfahren.
Während der Treffen finden auch Bhajans statt, von denen Amma einige persönlich komponiert hat, und ihr Chanten wird als ergreifendes Ereignis geschildert. Sie empfiehlt das Chanten von Bhajans, da es in unserer geräuschüberfluteten Zeit der leichteste Weg sei, um den Geist auf Gott zu konzentrieren.
Aber auch Meditation wird in ihren Zentren praktiziert, ferner empfiehlt sie Sevā, selbstlose Arbeit für andere Menschen, und gibt auch ständig ein Beispiel, indem sie sich persönlich an allen möglichen Arbeiten für die Gemeinschaft beteiligt.
Zudem betont sie auch den Wert von Japa, der Wiederholung des Mantras, welche den Geist natürlich sammelt und vor unerwünschten Eindringlingen schützt.
Doch das Hauptmotiv ihres Wirkens ist die Liebe: „Die Liebe ist die Grundlage für unser Leben. So wie unser Körper Nahrung braucht, benötigt die Seele Liebe, um sich zu entwickeln.“
Āmnāya m heilige Tradition, heilige Texte. Auch Bezeichnung für die Gesamtheit des Veda.
Amrita [amṛta] adj und n unsterblich; Unsterblichkeit; Nektar der Unsterblichkeit. Die Hatha-Pradīpikā berichtet von einem solchen „Nektar“, den der fortgeschrittene Yogī in den feinstofflichen Zentren erfährt, was zu einer Kräftigung des Körpers, Freiheit von Krankheit und sogar Unsterblichkeit führen könne.
Amrita-Bindu-Upanishad [amṛta-bindu-upaniṣad] f eine der Yoga-Upanishaden, enthält nur 22 Verse und lehrt einen Yoga der Entsagung sowie Japa der heiligen Silbe OM. Amrita-Bindu ist der „unsterbliche Bindu.“
Amrita-Nāda-Upanishad [amṛta-nāda-upaniṣad] f eine der Yoga-Upanishaden, erläutert einen sechsgliedrigen (shadaṅga) Yoga, der auf die Shvetāshvatara-Upanishad zurückgeht. Amrita-Nāda ist der ewige Klang.
Amshāvatāra [aṁśāvatāra] m Teilinkarnation (amśa-avatāra) einer göttlichen Persönlichkeit, wobei diese nur für einen begrenzten Zeitraum bestimmte Aspekte ihres Wesens manifestiert.
Siehe auch Pūrnāvatāra.
Anāhata-Cakra n wörtl. Cakra des nicht-angeschlagenen [Tones], trägt auch andere Bezeichnungen wie Hritpadma, Herz-Lotus. Es wird oft bildlich dargestellt als Hexagramm in einem Kreis mit zwölf Blütenblättern. Die Keimsilbe ist yam, das Tiersymbol die Gazelle, die Farbe gold-rosa, das Tattva oder Grundelement Wind, Atem (Vāyu). Die Gottheiten sind Īsha, d.h. Shiva, und Rākinī.
Der Yogī hört bei der Konzentration auf dieses Herz-Cakra den nicht extern hervorgerufenen, selbstexistenten göttlichen Klang Om, der auch Anāhata-Dhvani genannt wird.
Ānanda m oder n Freude, Seligkeit, die göttliche Glückseligkeit. Im Gegensatz zu Bhoga, dem Genuss der Sinne, ist Ānanda die höchste Seligkeit, die aus sich selbst existiert und nicht durch äußere Objekte bedingt ist. Ānanda ist eine der Grundeigenschaften des Brahman, das auch als Sat-Cit-Ānanda beschrieben wird, d.h. Sein-Bewusstsein-Freude.
In einigen Texten wird zwischen verschiedenen Formen von Ānanda-Erfahrung differenziert, insbesondere im Kaschmir-Shivaismus, der sieben Ebenen kennt.
Das Wort Ānanda wird bei Mönchen in der Tradition Shankaras am Ende eines Namens verwendet, z.B. Vivekānanda, Freude durch Viveka (Unterscheidungskraft), oder Śivānanda, Seligkeit durch Shiva.
Ānandamaya-Kosha [kośa] m eine der fünf Hüllen (Kosha), die das höchste Selbst umgeben, wobei die vorliegende (ānanda-maya - aus Glückseligkeit bestehend) die letzte und subtilste ist.
Ananda Moyi Ma, Sri Ma Anandamayi [śrī mā ānandamayī] die „glückselige Mutter“, eine der bedeutendsten Heiligen und Yoginīs des 20. Jhs.
Sri Ma wurde am 30. April 1896 in einem kleinen Dorf im heutigen Bangladesh geboren. Ihr Vater war ein Vaishnava, der meisterhaft devotionale Lieder vortragen konnte. Im Einklang mit den Gebräuchen jener Zeit wurde Sri Ma bereits mit dreizehn Jahren verheiratet und zog zunächst in die Familie ihres Gatten, während er selbst in einer anderen Stadt lebte und arbeitete. Mit Gleichmut trug sie ihr Schicksal und leistete in seiner Abwesenheit die schwere Hausarbeit, die ihr auferlegt wurde. Schon damals gelang es ihr, durch aufrichtige Zuwendung und natürliches Mitfühlen das Herz fremder Menschen zu gewinnen.
Im Alter von 18 Jahren zog sie zu ihrem Gatten, der intuitiv ihre spirituelle Bestimmung spürte und zölibatär mit ihr lebte. Eines Tages, beim morgendlichen Bad, empfing sie durch eine innere Stimme (Kheyal) die Weisung, eine Sādhanā, Yoga-Praxis, zu beginnen. Als sie am Abend den Namen Krishnas zu chanten begann, versank sie sogleich in eine innere Welt der Freude. Obgleich sie nichts von Yoga und Āsanas wusste, nahm sie spontan einige Stellungen ein. Auch als sie auf Wunsch ihres Gatten Bholanath, dessen Familie nicht der vishnuitischen Tradition angehörte, das Mantra wechselte und nun Shivas Namen chantete, blieb die Wirkung dieselbe und sie verbrachte oftmals viele Stunden in stiller Glückseligkeit.
Dieser Zeitabschnitt einer von innen her geführten Sādhanā dauerte etwa sechs Jahre. Spätere Gespräche, die sie mit Yogīs und Gelehrten über diese Phase führte, zeigten, dass sie während dieser Zeit ein höchst umfangreiches und detailliertes spirituelles Wissen erworben hatte, wie es sonst nur wenigen Experten der Sanskrit-Yoga-Literatur zugänglich ist.
Es war nun offensichtlich, dass sie bereits eine bedeutende spirituelle Verwirklichung besaß, und alsbald erhielt ihr Gatte auf eigenen Wunsch eine Einweihung von ihr. Auch in anderen Kreisen sprach sich ihre große Ausstrahlung herum und es trafen Besucher in großer Zahl ein.
Während der Kīrtans wurde immer wieder beobachtet, wie Sri Ma in Ekstase geriet, wobei sich ihre Augen schlossen und sie völlig selbstvergessen im Rhythmus der Musik hin und her schwankte. Oft lag sie danach Stunden im Samādhi und erhob sich erst wieder, wenn Bholanath sie zurück ins Wachbewusstsein rief.
Sie war im Jahr 1924 mit ihm nach Dhaka gezogen, doch verließen sie die Stadt 1932 und unternahmen viele Reisen. Im Laufe der Zeit ergaben sich Kontakte auch zu prominenten Indern wie der Nehru-Familie, die ihre Nähe und spirituelle Inspiration suchten. In vielen Städten bildeten sich Zentren von Anhängern, die gemeinsam Kīrtan durchführten.
Auch nach Bholanaths Erkrankung und Tod im Jahr 1938 setzte sie ihre Reisetätigkeit fort und nahm zahlreiche Einladungen zu religiösen Veranstaltungen an. Meist aß sie nur wenig, fastete häufig für lange Zeiträume oder nahm nur jeden zweiten Tag etwas zu sich. Wenn sie gesundheitliche Probleme hatte, wollte sie diesen nicht viel Beachtung schenken. Tatsächlich war die Ursache vor allem, dass die Begegnungen mit der schnell wachsenden Zahl von Anhängern sie viel Kraft kosteten.
Vor ihrem Lebensende führte sie noch ein großes vedisches Opfer durch, das unter ihrer Obhut bis ins kleinste Detail nach den traditionellen Vorschriften ablief und für die Teilnehmer zu einem bedeutenden spirituellen Ereignis wurde. Danach zog sie sich mehr und mehr zurück und wollte, als sie erkrankte, keine Gebete für ihre Heilung mehr entgegennehmen. „Dieser Körper hat keine Krankheit, er wird ins Nicht-Manifeste zurückgerufen“, erklärte sie ihren Anhängern. Am 27. August 1982 verließ sie ihren Körper.
Ananda Villages spirituelle Gemeinschaften, die von Paramahansa Yoganandas Schüler Swami Kriyananda gegründet wurden, um Yoganandas Lehren gemeinsam und auch im Alltag zu praktizieren. Insgesamt über 700 Bewohner leben in mehreren Gemeinschaften in den USA wie auch in der Nähe von Assisi in Mittelitalien. Es war Yoganandas Vision, dass überall auf der Erde solche spirituellen Gruppen gegründet würden, um der Menschheit zu zeigen, wie ein einfaches, inspiriertes Leben zu wahrem Glück führen kann.
Ananga [anaṅga] m körperlos; ein Beiname Kāmas, den Shiva zu Asche verbrannte.
Ananta adj und m ohne Ende (an-anta), unendlich. Name der kosmischen Schlange Shesha, auf der Vishnu ruht; bezeichnet auch Vishnu selbst.
Anantashayana [anantaśayana] m derjenige, der auf der Schlange Ananta ruht, d.h. Vishnu.
Anantāsana n Ananta-Haltung.
Ananta (s.o.); āsana – Haltung.
Anasūyā, Anusūyā f die Gattin des Rishi Atri und die Mutter von Durvāsā. Sie war bekannt für ihre aufrichtige Hingabe und Tugendhaftigkeit und verfügte über übernatürliche Kräfte.
Anātman m das Nicht-Selbst (an-ātman), d.h. alles, was als verschieden vom höchsten Selbst erfahren wird.
Anavasthitatva n Unstetigkeit beim Üben (an-avasthita-tva – Nicht-beständig-keit).
Anda [aṇḍa] n Ei. Auch Bezeichnung für das kosmische Ur-Ei, aus dem nach alten Mythen die Schöpfung hervorging.
Andal [āndāl] südindische Dichterin und Anbeterin Vishnus im 9. Jh., sie war die einzige Frau unter den Alvars.
Andhaka m Name eines Asuras der Dunkelheit (von andhaka, blind), welcher einst Pārvatī zu entführen versuchte, jedoch von Shiva getötet wurde.
Anga [aṅga] n Glied, Teil, Körper; Stufe eines Übungsweges.
Angiras [aṅgiras] m Name eines vedischen Rishis, Autor der Hymnen des 9. Mandala sowie von Abhandlungen über Recht und Astronomie.
Angula [aṅgula] m Finger; die Maßeinheit ein Finger breit.
Angushthāsana n die Daumenbreite-Haltung, Schwebesitz.
anguṣṭha – Daumen, Daumenbreite (über dem Boden); āsana - Haltung.
Animan [aĀiman] m Winzigkeit, Feinheit. Eine der übernatürlichen Kräfte (Siddhi), die der Yogī erwerben kann, d.h. die Fähigkeit, sich unendlich klein zu machen.
Aniruddha m der Sohn Pradyumnas, der wiederum ein Sohn Krishnas und Rukminīs war. Sein Name bedeutet wörtl. „unwiderstanden, ungehindert“.
Einst verliebte sich Ushā, die Tochter des Asura-Königs Bāna in Aniruddha und brachte ihn durch ihre okkulten Kräfte in ihre Gemächer. Als der König ihn aber durch seine Wächter gefangensetzen wollte, wehrte er sich und besiegte sie mit seiner eisernen Keule. Daraufhin machte Bāna von seinen Zauberkräften Gebrauch und hielt Aniruddha fest, bis schließlich Krishna, Balarāma und Pradyumna ihn befreiten.
Aufgrund einer Intervention Shivas wurde Bānas Leben jedoch verschont. Aniruddha und Ushā heirateten und begaben sich in die Heimat Aniruddhas, nach Dvāraka.
Anirvacanīya adj unsagbar, nicht mit Worten auszudrücken.
Añjali-Mudrā f Zusammenlegen der Hände auf Herzhöhe, um zu grüßen bzw. Ehrerbietung zu erweisen. Auch im modernen Hinduismus weit verbreitet.
Añjaneya m ein Name Hanumāns, abgeleitet vom Namen seiner Mutter, Añjanā.
Āñjaneyāsana n die Āñjaneya-Haltung; Halbmond; Mond.
Āñjaneya – Eigenname, Name Hanumāns; āsana – Haltung.
Ankusha [aṅkuśa] m od n Elefantenstachel; auch ein (glückverheißendes) Attribut Indras, Ganeshas und anderer Gottheiten.
Annamaya-Kosha [kośa] m die gröbste der fünf Hüllen, die das höchste Selbst umgeben, „aus Nahrung bestehend“ (anna-maya), d.h. der physische Körper.
Siehe auch Kosha.
Annapūrnā [annapūrṇā] f wörtl. diejenige, die voller Nahrung (anna) ist, d.h. die „Mutter der Fülle“, ein Name der Göttin Durgā oder Pārvatī. Sie wird mit einem Reistopf in den Händen dargestellt.
Antahkarana [antaḥ-karaṇa] n das „innere Instrument“, bezeichnet im Sānkhya das geistige Organ des Menschen, bestehend aus Buddhi, Ahamkāra und Manas.
Antakāla m die Zeit (kāla) des Endes (anta), die Todesstunde. Krishna erklärt in der Bhagavadgītā 8.5.: „Und wer in der Stunde des Todes, beim Verlassen des Körpers, an Mich allein denkt, der gelangt ohne Zweifel zu meinem Wesen.“
Antaka m ein Name des Todesgottes Yama, wörtl. der „Beender“.
Antarakumbhaka m oder n das Anhalten des Atems (kumbhaka) nach voller Einatmung (antara bedeutet innen, innerlich).
Antarāla n kleine Vorhalle zum Allerheiligsten eines Tempels.
Antaranga n der innere (antar) Teil (aṅga), bezeichnet im Yogasūtra die letzten drei der acht Stufen des Yoga.
Siehe auch Bahiranga und Ashtānga-Yoga.
Antarātman m das innere Selbst, der höchste Geist, der im Menschen wohnt.
Antarāya m ein Hindernis auf dem Weg des Yoga, wie z.B. Trägheit, Zerstreuung oder Begierde etc.
Antariksha [antarikṣa] n der „Zwischen-Raum“, d.h. der Bereich zwischen Erde und Himmel, die Sphäre der Gandharvas und Apsaras.
Antaryāmin m der innere Lenker, das Göttliche als innewohnende Gegenwart im Menschen.
Anugītā f ein Abschnitt im 14. Buch des Mahābhārata (14.16-51), mit Unterweisungen Krishnas für Arjuna. Dabei werden Themen wie die spirituelle Befreiung, Seelenwanderung, die Gunas u.a. erörtert.
Anugraha m Gunst, göttliche Gnade, die dem aufrichtigen Yogī zuteil wird.
Anukramani [anukramaṇī] f Tabelle, Liste. Textgattung, die für die vedischen Hymnen das erste Wort jeder Hymne, die Anzahl der Verse, den Namen und die Familie der Rishis sowie die Metren und Gottheiten benennt.
Anuloma-Prānāyāma [prāṇāyāma] m eine Atemübung, bei der durch beide Nasenlöcher eingeatmet und wechselweise durch je ein Nasenloch ausgeatmet wird.
Anuloma bedeutet „mit dem Strom, natürlich“.
Anumāna n in der Philosophie eine Schlussfolgerung aufgrund bestimmter Voraussetzungen.
Anurāga m Liebe, Hingabe.
Anushthāna [anuṣṭhāna] n Ausführung, Praxis. Die systematische Durchführung religiöser Praktiken über einen längeren Zeitraum.
Anushtubh [anuṣṭubh] f Name eines Versmaßes, das 4 x 8 Silben enthält.
Anusara Yoga m Yoga-Stil, der 1997 von dem Amerikaner John Friend begründet wurde. Das Wort anusāra bedeutet im Sanskrit „Folgen, Nachfolgen“ oder „natürlicher Zustand“ und wird hier frei übersetzt als „following one’s heart“, dem eigenen Herzen folgen, oder „flowing with grace“, mit der Gnade fließen. Ziel ist eine freudige Yogapraxis, die den Schülern hilft, „im Einklang mit dem Körper die innere Schönheit zu erleben.“
Fünf generelle Prinzipien der Ausrichtung (alignment) sollen den Übenden helfen, zu ihrer immanenten idealen Körperhaltung zurückzufinden und den Energiefluss im Körper zu verbessern. Aber nicht die Perfektion bei der Ausführung von Āsanas steht im Mittelpunkt, sondern die natürliche Freude, mit der sie ausgeführt und als Teil der persönlichen Entwicklung erlebt werden
John Friend verfügte über langjährige Erfahrung als Iyengar-Yoga-Lehrer und studierte intensiv das Tantra, bevor er sein eigenes System entwickelte, in das Elemente des Tantra einflossen. Yoga bedeutet für ihn, das Göttliche, das in allen Menschen präsent ist, zu erkennen und zu erwecken.
Meditieren, Chanten und das Studium heiliger Schriften sind Teil des umfangreichen Programms, das auch therapeutische Anwendungen beinhaltet.
Ānvīkshikī [ānvīkṣikī] f Logik, Philosophie, Metaphysik. Mit ihrer Hilfe wird die Erkenntnis dessen, was wahres Selbst und Nicht-Selbst ist, erarbeitet.
Āpah [āpaḥ] f (Plural von ap) Wasser. Eines der fünf Elemente, die die physische Natur konstituieren. Die anderen sind Erde, Feuer, Wind, Äther.
Siehe auch Pañcabhūta.
Apāna m wörtl. Herab-Atem oder -Energie (apa-āna). Einer der fünf Ströme des Prāna, wird im unteren Bereich des Körpers lokalisiert und reguliert Ausatmung und Ausscheidung.
Apānāsana n die Apāna-Haltung; Dehnung des unteren Rückens; Kniee zur Brust.
apāna – Apāna (s.o.); āsana - Haltung.
Aparā Prakriti [prakṛti] f die niedere Natur, die Welt des Stofflichen. Siehe auch Prakriti.
Apara-Vidyā f das niedere Wissen, die relative, indirekte Erkenntnis, die durch den Intellekt und die Sinne erlangt wird. Dagegen ist Para-Vidyā die direkte, absolute Erkenntnis des Brahman.
Aparigraha m Nicht-Ergreifen, Besitzlosigkeit, Freiheit von Habgier. Eine der fünf ethischen Leitlinien in der ersten Stufe des Rāja-Yoga. Siehe auch Yama.
Aparnā [aparṇā] die „Blattlose“, ein Name der Tochter Himavats. Einmal ging sie in eine so intensive innere Versenkung, dass sie nicht einmal ein Blatt zu sich nahm. Sie ist identisch mit Shivas Gattin Umā.
Āpastamba, Āpastambha m Name eines Rishis, der eine bedeutende vedische Schule begründete, in der unter anderem das Āpastambashrautasūtra entstand, ein Handbuch der Rituale.
Apavāda m in der Philosophie die Zurückweisung oder Widerlegung einer falschen Meinung.
Apavarga m spirituelle Befreiung, ein Synonym für Begriffe wie Moksha oder Kaivalya. Von apa-vṛj – abbiegen, verlassen (weltliche Geburten).
Appār [wörtl. Vater, Tamil] Name des südindischen Heiligen Tirunavukarasar, der im 7. Jh. lebte und einer der bedeutendsten Nayanmars war. Er verfasste zahlreiche an Shiva gerichtete Lieder und Gedichte.
Es wird berichtet, dass Appar zunächst Jaina war und dann zum Shivaiten konvertierte, nachdem er in einem Shiva-Tempel die wundersame Genesung von einer schweren Krankheit erfuhr. Er bekehrte später viele andere Menschen zum Shivaismus, so auch den jainistischen Pallava-Herrscher Mahendra, der ihn einmal gefangen setzen und schwer misshandeln ließ. Doch als der Heilige anschließend wie unversehrt Shiva lobpries, war Mahendra so beeindruckt, dass er an Stelle des Jaina-Klosters in der Hauptstadt einen Shiva-Tempel errichtete.
Apsarā f himmlische Nymphe, Wesen von überirdischer Schönheit. Apsarās treten bisweilen als Verführerinnen von Yogīs auf, wenn diese durch überehrgeizige Askese sich selbst oder die Welt aus dem Lot zu bringen drohen, oder wenn es deren Bestimmng ist, zum Vater eines Kindes zu werden.
Die Apsaras leben in Indras Himmel und sind die Gefährtinnen der Gandharvas.
Āptakāma m ein Mensch, dem alle Wünsche (kāma) erfüllt sind und der daher spirituell befreit ist, weil er kein Begehren mehr hat.
Apunya [apuṇya] adj und n unrein. Fehler, Verfehlung, Nicht-Punya.
Ārambhāvasthā f der Zustand (avasthā) des Anfangs (ārambha). Das erste von vier Stadien in der Entwicklung eines Yogīs, gemäß der Hatha-Pradīpikā verbunden mit dem Hören von mystischen Klängen und dem Durchtrennen des Brahma-Granthi.
Andere Quellen nennen als Merkmale dieses Stadiums das Rezitieren von Om oder die Reinigung der Nādīs.
Siehe auch Avasthā.
Āranyaka [āraṇyaka] n (Abhandlung) „den Wald betreffend“. Gattung vedischer Schriften, die sich an die Brāhmanas anschließen und für die Lektüre von Einsiedlern im Wald (aranya) bestimmt sind.
Āratī f abendliche Anbetung mit Blumen, Räucherstäbchen und einer Kampferflamme, welche kreisförmig um ein Götterbild geschwenkt wird. Dabei hat der Kampher eine symbolische Bedeutung: so wie er ohne Rückstände verbrennt, verzehrt die Flamme von Gottes Liebe das menschliche Ego.
Arcanā f Verehrung des Göttlichen durch verschiedene Rituale.
Architektur die Wissenschaft von der Baukunst existiert in Indien bereits seit alter Zeit unter den Namen Sthāpatya-Veda, Vāstu-Jñāna und Vāstu-Vidyā und zählt zu den Upavedas oder sekundären Vedas. Offenbart wurde sie nach alter Lehre den Menschen von Vishvakarman, dem göttlichen Ur-Architekten.
Dieses Wissen wurde von zahllosen Baumeister- und Handwerker-Generationen zunächst mündlich überliefert, bevor es ab ca. dem 4. Jh. auch schriftlich fixiert wurde.
Die Texte beschäftigen sich mit allen äußeren ebenso wie den esoterischen Aspekten insbesondere des Tempelbaus. So geht es nicht nur um das rechte Material und die rechte Farbe für den jeweiligen Bau, sondern auch um die Kunst der optimalen Anordnung von Räumen, wobei dem Feng-Shui verwandte Überlegungen eine Rolle spielen. Auch das fachkundig durchgeführte Ritual der Einweihung unter Berücksichtigung astrologischer Konstellationen ist von Bedeutung.
Während nordindische Tempel in der Regel nur eine begrenzte Größe aufweisen, wurden in Südindien teils riesige großflächige Anlagen errichtet.
Siehe auch Kunst.
Ardha halb, halbe, halber etc., ein Wortelement in Āsana-Bezeichnungen.
Ardhacandrāsana n Halbmond-Haltung.
ardha – halb; candra – Mond; āsana – Haltung.
Ardhamandalāsana n Halbkreis-Haltung.
ardha – halb; maṇḍala – Kreis; āsana – Haltung.
Ardhamatsyendrāsana n die halbe Matsyendra-Haltung; der halbe Drehsitz.
ardha – halb; matsyendra – Name eines Yoga-Meisters (Matsyendra); āsana – Haltung.
Ardhanārīshvara m der Gott Shiva als androgynes Wesen in halb männlicher und halb weiblicher Form, wodurch die transzendente Einheit von Shiva und Shakti symbolisiert wird.
ardha – halb; nārī - Frau; īśvara – Herr.
„Arische Einwanderung“ siehe Indoarische Migration.
Arishta [ariṣṭa] n Vorzeichen, Omen. Aufgrund der Vernetzung von Mikro- und Makrokosmos können bestimmte äußere Ereignisse als spirituell relevant gedeutet werden. So wurde z.B. von vielen Beobachtern ein ungewöhnlicher Lichtschweif am Himmel gesichtet, als Ramana Maharshi seinen Körper verließ.
Ārjava n Aufrichtigkeit, wird u.a. in der Bhagavadgītā als positive Eigenschaft des Yoga-Aspiranten genannt.
Arjuna, Ardschuna m im Mahābhārata einer der fünf Pāndava-Brüder und mächtiger Kämpfer. In der Bhagavadgītā, die Teil des Mahābhārata ist, tritt er als Schüler und Gesprächspartner Krishnas auf und empfängt von ihm dessen spirituelle Lehren in einem Augenblick großer persönlicher Niedergeschlagenheit. „arjuna“ bedeutet weiß, hell, rein. Siehe auch Pāndu.
Ārogya n Gesundheit. Im Hatha-Yoga kann dieser Begriff im Sinne einer Befähigung für bestimmte Praktiken wie z.B. Atemregulierung erweitert werden.
Ārohanāsana n die Hebestellung.
ārohaṇa – Anheben (der gestreckten Beine); āsana – Haltung.
Artha m Ding, Objekt; Reichtum, Wohlstand, Besitz; Ziel, Zweck. Das Wort bezeichnet auch speziell eines der vier Ziele menschlichen Strebens (Purushārtha), d.h. das Erwerben materiellen Wohlstands in der ersten Lebensstufe.
Arthashāstra [arthaśāstra] n Abhandlung über den (politischen) Nutzen, Lehrbuch der Staatskunst, gemäß der Überlieferung verfasst von Kautilya, auch Cānakya genannt. Allerdings vermutet die Forschung, dass es sich tatsächlich um eine Kompilation handelt, an der mehrere Autoren beteiligt sind.
Inhaltlich geht es in 15 Abschnitten um alle Fragen der Staatskunst und Regierung, die Ausbildung des Herrschers und seine Pflichten.
Aruna [aruṇa] m vedischer Gott der Morgenröte; Morgenröte; Kutscher der Sonne, Sūrya.
Arunāchala [aruṇācala] m ein heiliger Berg im südindischen Tamil Nadu, der nach örtlicher Legende älter als der Himālaya sein soll. Bekannt wurde der kleine Berg durch Ramana Maharshi, der viele Jahre in dessen Höhlen meditierte und später seinen Ashram in der Nähe begründete. An seinem Fuß befindet sich auch der riesige Arunāchaleshvara-Tempel.
Die wörtliche Bedeutung ist rötlicher (aruṇa) Berg (acala). aruṇa bedeutet auch Sonne, Morgenröte.
Arunāchaleshvara-Tempel siehe Tiruvannāmalai.
Arundhatī f die Frau des Sehers Vasishtha, sie gilt den Hindus als ideale Ehefrau.
Ārya adj und m das Wort bedeutet in seiner Grundbedeutung „edel“ und wurde in der vedischen Zeit für aufrichtige spirituelle Sucher verwandt, während unaufrichtige oder nicht fähige „anārya“ waren. Es stand auch allgemein für Menschen, die aufstreben, sich um etwas bemühen.
Das Wort erhielt erst auf der Grundlage von Interpretationen einiger westlicher Gelehrter die Bedeutung „Arier“ im Sinne eines überlegenen Volkes.
Siehe auch Indoarische Migration.
Aryaman m Name eines Āditya, einer vedischen Gottheit, die oft zusammen mit Mitra und Varuna angerufen wird. Aryaman steht für die Kraft des Opfers, die nach Wahrheit strebende Aktion.
Ārya Samāj m arische oder edle Gesellschaft. Eine Vereinigung, die 1875 von Svami Dayananda Sarasvati gegründet wurde, um die alte und ursprüngliche vedische Tradition neu zu beleben und zu bekräftigen. Teil der Arbeit der Gesellschaft war es, der Konvertierung von Hindus in andere Religionen entgegenzuwirken und diese, wenn möglich, rückgängig zu machen.
Die Zuwendung auch zu den Angehörigen niederer Kasten und Kastenlosen fand keine Akzeptanz in höheren Gesellschaftsschichten, so dass die Bewegung in Indien nur begrenzte Wirkung entfalten konnte.
Der Ārya Samāj fand zum Teil auch im Ausland unter Bürgern indischer Abstammung Anklang und unterhält heute weltweit zahlreiche Zentren, welche vor allem soziale und philanthropische Aktivitäten koordinieren.
Siehe auch Dayananda Sarasvati, Svami.
Asamprajñāta-Samādhi [asaṁprajñāta] m die zweite und höchste Stufe des Samādhi. Bei der ersten (samprajñāta – bewusst) wird der Geist des Meditierenden eins mit dem Gegenstand der Konzentration, aber es existiert beim Individuum noch das Bewusstsein eines Objekts.
Beim asamprajñāta (nicht-bewusst, überbewusst) wird auch diese Vorstellung eines Objektes gelöscht. Wenn man lange in diesem absoluten Zustand verharrt, werden die Samskāras, die unterbewussten Wünsche, Impressionen etc. aufgelöst, die bei der ersten Stufe zwar unter Kontrolle sind, aber noch weiter im Keim bestehen bleiben. So bewirkt dieser Samādhi die Loslösung von allen Karma-Ketten und führt zur spirituellen Befreiung.
Er wird auch Nirbīja-Samādhi genannt („ohne Keim“), im Vedānta Nirvikalpa-Samādhi („ohne Differenzierung“ von Subjekt und Objekt).
Āsana n Sitz; Matte; Körperhaltung. Die Grundbedeutung leitet sich ab von der Wurzel ās, sitzen. Ursprünglich bezeichnete das Wort die besondere Fläche, auf welcher der Yoga-Übende sitzt. Texte wie die Bhagavadgītā (6.11) führen detailliert aus, wie dieser Untergrund beschaffen sein soll, d.h. nicht zu hoch oder zu tief, sauber und in ruhiger Umgebung. Auch die Art des Sitzes, aus heiligem Gras, Tuch oder Tierfell, wird ausführlich beschrieben.
Die Bedeutung „Yoga-Haltung“ ist die bekannteste. In der Bhagavadgītā 6.13 und im Yogasūtra 2.46 wird das Thema „Körperhaltung“ (während der Meditation) nur sehr kurz angesprochen, aber Schriften wie die Hathapradīpikā oder Gheranda-Samhitā stellen zahlreiche Āsanas im Detail vor.
Einige Texte sagen, Shiva habe ursprünglich 840 000 Haltungen dargelegt, die individuell den verschiedensten Arten von Lebewesen gerecht werden. Aber für den praktischen Gebrauch werden, je nach Quelle, 32 oder auch 84 gängige Āsanas genannt. Aktuelle Yoga-Titel stellen zum Teil weit über 100 vor. Die historisch ältesten Abbildungen von Āsanas wurden auf den Siegeln der Indus Kultur gefunden (siehe auch Hatha-Yoga, vorletzt. Abs.).
Der ursprüngliche Zweck der Haltungen war, den Körper während langer Meditationen zu stabilisieren, wobei z.B. empfohlen wird, Rücken, Hals und Kopf möglichst in gerader Linie zu halten. Ferner sollten Āsanas generell auch die Gesundheit des Übenden stärken. Die so erworbenen Erfahrungen legten die Grundlage für erfolgreiche therapeutische Anwendungen in unserer Zeit.
In Yoga-Schulen werden Āsanas in zahlreichen Übungsstilen unterrichtet. So können die einzelnen Stellungen z.B. eher langsam und meditativ oder zügig, fließend und kraftvoll durchgeführt werden.
Viele Variationen sind auch bei der Anzahl von Āsanas in einer Übungseinheit möglich, ebenso bei der Zusammenstellung von bestimmten Sequenzen, indem die einzelnen Stellungen so aufeinanderfolgen, dass eine optimale Wirkung erzielt wird. Dabei können Sequenzen auch individuell erstellt werden, um den Voraussetzungen und Erfordernissen des Einzelnen zu entsprechen.
Einige Schulen verwenden Hilfsmittel wie Blöcke und Seile und legen großen Wert auf die präzise Durchführung der Āsanas, wobei die Lehrenden persönlich eingreifen und korrigieren. Andere sagen nur die Übungen an und heben mehr den Aspekt der inneren Erfahrung hervor.
So kann auch grundsätzlich die Zielrichtung des Unterrichts variieren, indem die Āsanas in der einen Schule primär als Teil einer spirituellen Praxis verstanden werden, während eine andere vor allem Zwecke wie Fitness und Therapie verfolgt.
Ein wichtiger Aspekt der Āsanas ist ihr Einfluss auf den feinstofflichen Körper, d.h. die Nādīs und Cakras, deren Energieströme gezielt gelenkt werden. Eine entsprechende Übungspraxis ist in der Regel nicht Teil des populären Yoga-Unterrichts, wird aber von einigen Yoga-Zentren als Teil ihres Programms angeboten.
Einige bekannte Übungsstile sind Anusara-Yoga, Ashtānga-Vinyāsa-Yoga, Iyengar-Yoga, Pilates-Yoga, Sivananda-Yoga, Viniyoga, Yesudian-Yoga.
Siehe auch Hatha-Yoga.
Asat n das Nicht-Sein (a-sat). Bezeichnet den unbeschreiblichen und unerkennbaren Urgrund des Seins, aber auch das Un-Wirkliche, welches nicht echtes Sein ist.
Ein bekanntes Gebet in den Upanishaden, beginnt mit den Worten: asato mā sad gamaya – vom Nichtsein führe mich zum Sein.
In der Schöpfungshymne in Rigveda 10.129.1-2 heißt es: „Seiendes war nicht, noch Nichtsein. Nicht Erde oder Luftraum oder Himmelsgewölbe... Ewig waltete das Ureine ohne Atem, und außer Ihm war nichts im weiten Kosmos.“
Siehe auch Sat.
Āshādha [āṣāḍha] m Name des vierten Monats im Hindu-Kalender (Juni/Juli).
Āshaya [āśaya] m Ruhestätte, Sitz, Platz, Behältnis. In der Yoga-Philosophie die Ansammlung von Früchten früherer Handlungen, auch Karma-Āshaya („Handlungsdepot“) genannt. Diese reifen in den unterbewussten Schichten des Menschen und beeinflussen seine Geburt, Lebensdauer und Lebenserfahrung.
Siehe auch Samskāra.
Ashoka (1) [aśoka] m od adj wörtl. “ohne Sorge”, a-shoka. Name eines stets grünen heiligen Baumes (Saraca indica). Dessen rote Blüten dienen, zu Girlanden gebunden, der Verehrung des Liebesgottes. Der Rinde des Baumes werden im Āyurveda Heilwirkungen zugeschrieben.
Ashoka (2) [aśoka] m Name eines berühmten Königs, der im 3. Jh. v.Chr. in Nordindien lebte (272 – ca. 231). Eine tiefe innere Krise nach einem blutigen Feldzug bewirkte seinen Übertritt zum Buddhismus, dessen Verbreitung er nach Kräften förderte.
Āshrama (1) [āśrama] m oder n Einsiedelei; Mönchszelle; religiöses oder spirituelles Zentrum, Ashram. Von der Wurzel śram, sich anstrengen, denn dies ist ein Ort, wo sich Schüler unter Anweisung eines Lehrers um Fortschritt bemühen. In Indien tragen viele große Yoga-Zentren diese Bezeichnung.
Āshrama (2) [āśrama] m in den vedischen Schriften Bezeichnung für die vier klassischen Lebensstadien des Menschen: Brahmacarya, die Zeit des Lernens als Schüler; Grihastha, das Stadium des Familienvaters und Haushälters, der seine entsprechenden Pflichten erfüllt; Vānaprastha, die spirituelle Suche in der Einsamkeit; und Samnyāsa, Entsagung aller gesellschaftlichen Bindungen und ausschließliches Streben nach Moksha, spiritueller Befreiung.
Ashtādhyāyī [aṣṭādhyāyī] f die bekannte Sanskrit-Grammatik des Pānini, wörtl. „Jene, welche acht Kapitel hat“. Pānini vermochte es, die zahlreichen, teils komplizierten Regeln der Sanskrit-Grammatik in äußerst knappe Formeln zu fassen, wofür er sich eine eigene Kürzel-Sprache schuf.
Ashtānga-Yoga [aṣṭāṅgayoga] m der Yoga der acht (aṣṭa) Glieder (aṅga). Der aus acht Stufen bestehende Yoga-Weg des Patañjali: Yama, Niyama, Āsana, Prānāyāma, Pratyāhāra, Dhāranā, Dhyāna, Samādhi.
Siehe ausführliche Erläuterungen unter diesen Sanskrit-Begriffen und eine zusammenfassende Darstellung unter Rāja-Yoga.
Ashtānga-(Vinyāsa-)Yoga m Bezeichnung für ein Körperarbeitssystem, das insbesondere K. Pattabhi Jois, ein Schüler von Krishnamacharya, im südindischen Mysore etwickelt hat. Das Übungssystem besteht aus sechs Serien von Āsanas, die jeweils einem bestimmten Muster folgen, indem die energetische Intensität ständig zunimmt, einen Höhepunkt erreicht, dann wieder abflacht und in tiefer Entspannung endet.
Die einzelnen Āsanas sind durch Bewegungselemente mit synchronisierter Atmung verbunden (Vinyāsa heißt „Bewegung, Stellung; Verbinden“) und werden dynamisch durchgeführt, wobei auf eine korrekte, gesundheitsfördernde Ausrichtung der Gelenke Wert gelegt wird.
Die Übungen erzeugen eine große innere Hitze, die die Muskeln geschmeidig werden lässt und das Nervensystem reinigt, während die Körperzellen reichlich Sauerstoff und Energie erhalten. So soll der Körper stark und flexibel werden und der Geist ruhig und konzentriert. Als sehr wichtig wird die bewusste Wahrnehmung des Atems während der Übungsfolgen bezeichnet.
Ashtāvakra [aṣṭāvakra] m Name eines bekannten Weisen, der ein Lehrer Patañjalis war. Aufgrund eines Fluches seines Vaters trug er acht (aṣṭā) körperliche Missbildungen (vakra), von denen er jedoch später durch den Segen seines Vaters wieder befreit wurde. Aṣṭāvakra lehrte einen reinen Jñāna-Yoga oder Weg der Erkenntnis.
Ashtāvakrāsana n die Ashtāvakra-Haltung.
aṣṭāvakra – Eigenname (s.o.); āsana – Haltung.
Ashva [aśva] m Pferd. Als Ur-Pferd gilt in der indischen Mythologie Uccaihshravas, welches beim Quirlen des Milchozeans hervortrat. Indra eignete sich dieses göttliche, weiße Pferd an und stutzte ihm seine Flügel, damit es auf Erden bliebe.
In den Purānas heißt es, Vishnu werde am Ende des Kali Yuga auf einem weißen Schimmel reitend erscheinen und ein neues Zeitalter des Lichts und der Wahrheit einläuten.
Schon im Rig-Veda finden Pferde Erwähnung, und die Brihadāranyaka-Upanishad eröffnet mit einem imposanten Bild, in welchem der ganze Kosmos in Gestalt eines gewaltigen Opferrosses visualisiert wird.
In der epischen Literatur spielt das Pferd eine wichtige Rolle als Streitross.
Siehe auch Ashvamedha-Yajña.
Ashvamedha-Yajña [aśvamedha] m Pferde-Opfer, ein sehr umfassendes vedisches Ritual, das von Königen zur Erlangung von Nachkommen oder in Verbindung mit der Erweiterung des Reiches durchgeführt wurde.
Ein besonders edler Hengst wurde auserwählt und lief dann ein Jahr frei herum, begleitet von einem Wächter des Königs. Dabei fiel dem König jedes Land zu, welches das Pferd betrat, sofern der lokale Herrscher nicht Widerstand leistete. Am Ende wurde das Pferd im Verlaufe einer großen öffentlichen Zeremonie geopfert.
Ashvasamcalanāsana ashva-samcalanāsana n die Reiter-Haltung.
aśva – Pferd; saṁcalana - Bewegen; āsana – Haltung.
Ashvattha [aśvattha] m der heilige Feigenbaum (Ficus religiosa), auch Pipal oder Bodhi genannt. In der Bhagavadgītā 15.1 wird das Bild des unvergänglichen Ashvattha-Baumes gebraucht, dessen Wurzeln oben (im Himmel) sind, während seine Zweige sich nach unten in die Erde erstrecken.
Dieser Baum gilt als Weisheitsbaum. Wer ihm zu Füßen meditiert, soll – wie dereinst der Buddha – zur Erleuchtung gelangen.
Ashvatthāman [aśvatthāman] m im Mahābhārata der Sohn Dronas, einer der Generäle der Kauravas. Er gehörte auf deren Seite zu den drei einzigen Überlebenden der großen Schlacht und soll der Legende nach unsterblich sein.
Āshvina [āśvina] m Name des siebten Monats im Hindu-Kalender (Sept.-Okt.).
Ashvins [Skrt. aśvinau] m ein vedisches Götterpaar, Zwillingssöhne der Sonne, die als Ärzte, Heiler und Erlöser auftreten.
Sie erscheinen am Morgen auf einem von Pferden gezogenen Wagen am Himmel und lenken ihn zur Erde, wo sie die Menschen vor Unheil bewahren und sie zur Erleuchtung führen.
Ashvinī-Mudrā f [aśvinī] eine Praktik, bei der wiederholt die Schließmuskeln des Anus zusammengezogen werden. Die Übung soll kräftigend wirken und helfen, die Kundalinī, die verborgene Schlangenkraft, zu erwecken.
Ashvinī ist der Name einer Nymphe, der Gemahlin der Sonne, die sich einst in Form einer Stute verbarg.
Askese siehe Tapas.
Asmitā f Ich-heit (asmi-tā), das Ichgefühl. Die Wahrnehmung seiner selbst als gesondertes Wesen. Im Yogasūtra einer der fünf Kleshas oder Leidursachen.
Asteya n das Nicht-Stehlen. Eine der fünf ethischen Leitlinien der ersten Stufe im Rāja-Yoga. Mit „Stehlen“ (steya) ist nicht nur das Entwenden im rechtlichen Sinn gemeint, sondern auch allgemein das Begehren von Dingen, die anderen gehören.
Siehe auch Yama.
Āstika adj oder m jemand, der gläubig ist oder an die Existenz Gottes glaubt. Von asti, er, sie, es ist oder existiert.
Āstikya n Glauben, Vertrauen. Glauben an die Realität der Welt (im Gegensatz zum Māyāvāda) und der Allgegenwart des Göttlichen in ihr.
Astra n Waffe, Pfeil, Schwert, Geschoss. Oft auch Waffen, die im Kampf zwischen Göttern und Asuras verwendet wurden und aufgrund okkulter Kraft besondere Wirkung entfalten konnten.
Astralreisen siehe unter Ākāshagamana.
Astrologie siehe Jyotisha.
Asura m ungöttliches Wesen, Dämon, Titan. Ursprünglich hatte dieses Wort genau die entgegengesetzte Bedeutung und steht im Veda (mit Ausnahme einiger weniger Hymnen) und im Avesta der Parsen (Ahura) für das höchste göttliche Wesen. Die spätere negative Bedeutung entstand vermutlich aus der – eigentlich falschen – etymologischen Deutung a-sura, un-göttlich.
Der Kampf zwischen Göttern (Devas) und Asuras ist ein häufig wiederkehrendes Motiv in den indischen heiligen Schriften. Die Asuras, die ursprünglich Kräfte des Göttlichen waren, sich jedoch in einer frühen Phase der Schöpfung wie gefallene Engel vom Einen abwandten, verfügen über gewaltige Kräfte und bringen die Götter oft in große Bedrängnis.
Die Bhagavadgīta widmet das ganze 16. Kapitel dem „Yoga der Unterscheidung zwischen dem Göttlichen und Asurischen“.
Atem siehe Prāna.
Atharvaveda m der vierte Veda, benannt nach dem Feuerpriester Atharvan, dem ältesten Sohn Brahmās; der Text enthält im wesentlichen seine magischen Zaubersprüche, aber auch bereits einige Gedanken und Ansätze, die zu späteren Yoga-Praktiken hinführen.
Siehe auch Veda.
Ātmabodha m Selbst-Erkenntnis, auch Name eines Werkes Shankaras.
Ātman m das unvergängliche Selbst, die Seele. Der Gedanke eines unsterblichen transzendenten Selbstes wird bereits in den ältesten Upanishaden ausgesprochen und ist von großer Bedeutung für den Vedānta und Yoga. So schreibt Shankara in seinem Werk Vivekacūdāmani: „Der spirituelle Sucher... widmet sich der Übung der Kontemplation und meditiert über den Ātman in sich selbst als dem Ātman in allen Wesen. So löscht er vollständig das Gefühl der Trennung aus... und identifiziert sich mit dem Brahman.“
In der Taittirīya-Upanishad wird ausgeführt, dass das höchste Selbst von fünf Hüllen umgeben sei, die sich – ausgehend vom Grobstofflichen – immer mehr verfeinern (siehe Kosha).
Viele Texte erklären, dass es unmöglich sei, das Selbst verbal zu erfassen und zu beschreiben, es enthülle sich in seiner Realität nur in der ureigenen Erfahrung des Selbstes durch das Selbst.
Das Wort Ātman trägt im Sanskrit nicht notwendigerweise die bekannte spirituelle Bedeutung, sondern kann in anderen Zusammenhängen auch das gewöhnliche menschliche Selbst bezeichnen oder reflexiv für „sich“ stehen.
Manchmal wird auch die Schreibweise „Ātmā“ gebraucht, d.h. der Nominativ Singular des Wortes, während Ātman der Stamm ist (vergl. Yogī, Yogin). In Komposita, zusammengesetzten Wörtern, erscheint unter Umständen auch „Ātma“.
Ātmajñāna n die Selbst-Erkenntnis, das Wissen vom Ātman.
Ātmanivedana n vollständige Hingabe an das Selbst, sich dem Göttlichen anvertrauen.
Ātmasākshātkāra [ātmasākṣātkāra] m die direkte, intuitive Wahrnehmung des Selbstes durch das Selbst.
Atri m Name eines bedeutenden Rishis, der mehrere vedische Hymnen verfasste, gerichtet u.a. an Agni, Indra und die Ashvins. Die Atris sind eine Familie vedischer Weiser, denen das 5. Mandala des Rig-Veda zugeschrieben wird.
Aum siehe Om.
Aurobindo, Sri [śrī] indischer Yogī, Dichter und Philosoph (1872-1950), Schöpfer des Integralyoga. „Aurobindo“ ist abgeleitet von Sanskrit Aravinda, Lotus.
Sri Aurobindo wurde am 15. August 1872 in Kalkutta geboren, doch schickte sein europäisch orientierter Vater ihn schon im Alter von sieben Jahren nach England, wo er eine klassisch-humanistische Ausbildung erhielt. Als er mit 21 Jahren nach Indien zurückkehrte, hatte er bei seiner Ankunft in Bombay eine überwältigende Erfahrung unsagbaren Friedens.
Er vertiefte nun seine Kenntnisse der indischen Kultur und Geschichte und lernte Sanskrit, die Sprache der heiligen Schriften Indiens. Doch sein Augenmerk galt zunächst vor allem der indischen Widerstandsbewegung, zu deren geistigem Führer er bald wurde. Er wollte Freiheit und Unabhängigkeit für sein Land und schrieb zahlreiche inspirierte Artikel in mehreren Zeitschriften.
Parallel zu diesen politischen Aktivitäten entwickelte sich auch sein Interesse am Yoga. Im Jahr 1904 begann er mit Prānāyāma-Übungen und fühlte ständig eine Art elektrische Kraft um seinen Kopf, woran sich viele kleinere spirituelle Erfahrungen anschlossen.
Der große Durchbruch ereignete sich im Jahr 1908, als er den vedantischen Yogī Vishnu Bhaskar Lele traf. Dieser wies ihn an: „Setze dich hin, beobachte, und du wirst sehen, dass deine Gedanken von außen in dich eintreten. Bevor sie eintreten, wirf sie zurück.“ Sri Aurobindo folgte dieser Anweisung und erreichte innerhalb von drei Tagen die Erfahrung ewiger Stille. Es war das raumlose, unbegrenzte Brahman, das Nirvāna, auf desen Hintergrund die Welt wie ein Film erscheint, der vorüberzieht. Es war die Erfahrung der Māyā, der Unwirklichkeit der Welt, die für Sri Aurobindo nur ein Durchgang sein sollte.
Indessen verunsicherten die Aktivitäten der Freiheitskämpfer die britische Kolonialregierung, und so wurde Sri Aurobindo 1908 mit vielen anderen führenden Persönlichkeiten verhaftet. Während der einjährigen Untersuchungshaft im Gefängnis von Alipur hatte er weitere spirituelle Erfahrungen. Wenn er vor seiner Zelle auf und ab ging, spürte er, wie die Kraft des Göttlichen ihn erfüllte: „Ich schaute auf das Gefängnis... und die hohen Mauern kerkerten mich nicht mehr ein, es war Krishna, der mich umgab...“
Zu dieser Zeit erschien ihm auch in einer Vision Swami Vivekananda und erklärte ihm zwei Wochen lang höhere Bewusstseinsebenen, einen wichtigen Bereich spiritueller Erfahrung, über den er zu Lebzeiten nie gesprochen hatte.
Ein angesehener indischer Anwalt verteidigte Sri Aurobindo im Prozess und erreichte schließlich mit einem brillanten Plädoyer seinen Freispruch von der Anklage der Verschwörung gegen die britische Krone.
Im Jahr 1910 erhielt Sri Aurobindo eine innere Weisung, sich von der politischen Arbeit zu lösen und nach Puducherry (Pondicherry) zu fahren, einer französischen Kolonie südlich von Chennai (Madras) an der Ostküste Indiens. Dort widmete er sich nun intensiver innerer Arbeit und entwickelte seinen ganzheitlichen Integralyoga.
1914 kam es zu einer ersten Begegnung mit Mira Alfassa, die bereits einen langen spirituellen Weg mit vielen Erfahrungen hinter sich hatte. 1920 reiste sie endgültig nach Puducherry und blieb dort bis an ihr Lebensende als Sri Aurobindos spirituelle Mitarbeiterin, „die Mutter“. Unter ihrer Leitung bildete sich allmählich der Sri Aurobindo Ashram heran, indem immer mehr Wahrheitssucher aus Indien und aus dem Westen nach Puducherry kamen.
Im November 1926 hatte Sri Aurobindo eine wichtige Erfahrung, die er als „Herabkunft Krishnas ins Physische“ deutete. Es war eine entscheidende Vorstufe für sein eigentliches Ziel, die Herabkunft (descent) des Supramentalen (supermind), eines weltdynamischen Wahrheitsbewusstseins, das nach seiner Schau bereits von einzelnen vedischen Rishis realisiert worden war, jedoch nur individuell und nicht kollektiv für die Menschheit als generell etablierte Bewusstseinsstufe.
Während des Ersten Weltkriegs veröffentlichte Sri Aurobindo in einer langen Artikelreihe zahlreiche Schriften, welche zu seinen Hauptwerken wurden, darunter auch Das göttliche Leben, Die Synthese des Yoga und Essays über die Gita. Später kamen die Briefe über den Yoga als wichtige Informationsquelle hinzu.
In seinem Werk Das göttliche Leben entwirft Sri Aurobindo in einer grandiosen Vision das Bild einer progressiven Evolution mit ungeahnten künftigen Möglichkeiten, aber auch teils schwierigen Phasen. Die Synthese des Yoga und die Briefe zeigen den integralen Yoga-Weg auf, der es sich zum Ziel setzt, das irdische Leben nicht zurückzuweisen, es nicht nur als Durchgang zur spirituellen Befreiung zu betrachten, sondern vielmehr ganzheitlich zu akzeptieren und zu transformieren, indem es schrittweise vom Licht der Wahrheit erfüllt und zu einer freudigen Teilnahme an Schöpfung und Evolution geführt wird.
Hauptelemente aus der indischen Tradition sind die drei Wege, die in der Bhagavadgītā aufgezeigt werden: Der Pfad der Werke, der Erkenntnis und der Liebe. Techniken und Erkenntnisse aus anderen Systemen und Weisheitslehren können ebenfalls mit Gewinn integriert werden, wenn dies dem persönlichen Entwicklungsgang entspricht. Dies gilt insbesondere für Japa, die Wiederholung eines Mantras, welches die Mutter in der letzten Phase ihres Lebens intensiv praktizierte und in dem betreffenden Stadium ihrer Sādhanā für unverzichtbar hielt.
Ein zusätzliches Element im Integralyoga ist die schon erwähnte „Herabkunft des Supramentalen“, eines globalen, gnostischen Wahrheitsbewusstseins, das alle Teilung, z.B. auch jene der Religionen, in einem grenzenlosen Einheitsempfinden aufhebt. Die Dualität und Gegenüberstellung von Geist (Spirit) und Materie soll auf dieser Ebene endgültig überwunden werden: Materie ist Geist-Stoff.
Der Mensch kann dieses Bewusstsein nicht durch sein Ego anstreben, sondern sich nur durch allmähliche Aufgabe oder Umpolung des Egos und die Sehnsucht der innersten Seele ihm öffnen, es hereinlassen. Voraussetzung dafür ist eine gründliche Vorbereitung des Wesens, eine geduldige Sādhanā, so dass die mentale, vitale und physische Natur unter den Einfluss des Lichts kommt und allmählich transformiert wird. Hilfreich bei dieser Arbeit sind innere Haltungen wie Aufrichtigkeit, Hingabe an das Göttliche und Gleichmut
Das Streben nach ganzheitlicher Entwicklung bleibt nicht auf den Einzelnen beschränkt. Es kann zu spirituell orientierten Gemeinschaften führen, die kollektiv auf das Ziel der Transformation hinarbeiten. Im politischen Bereich wäre das Ziel eine auf Einheit und Harmonie ausgerichtete Weltgemeinschaft, die im wesentlichen von Kräften des Lichts regiert wird, was gewiss eine ferne Vision ist.
Als Sri Aurobindo am 5. Dezember 1950 die (physische) Erde verließ, war sein Körper 111 Stunden in ein supramentales Licht gehüllt, das jede Zersetzung verhinderte und von vielen Anhängern gesehen werden konnte. Sri Aurobindo hatte beschlossen, wegen starker Widerstände im Erdbewusstsein von der subtilphysischen Ebene weiterzuarbeiten, während die Mutter den Yoga der Transformation im Körper fortsetzen würde.
Das bedeutendste literarische Werk Sri Aurobindos ist neben dem Titel Das göttliche Leben sein spirituelles Epos Savitri, eine mantrische Dichtung in englischer Sprache, die den Sucher auf einer langen Reise durch das Universum führt, durch seine sichtbaren und unsichtbaren Welten, seine Evolutionsgeschichte, seine spirituellen Gipfel und tiefen Abgründe. Der gesamte Text – fast 24.000 Zeilen in Blankvers – liegt auch in zwei deutschen Übertragungen vor.
Siehe auch Mutter, Die; Auroville, Evolution (Abs. 2-3); Seele (Abs. 3).
Auroville eine internationale Gemeinschaft, die im Jahr 1968 von der Mutter (Mira Alfassa) in Südostindien nahe der Stadt Puducherry (Pondicherry) und dem Sri Aurobindo Ashram gegründet wurde, um ein kollektives Experiment für den Fortschritt der Menschheit zu unternehmen.
Ziel des Projektes ist es, durch das gleichberechtigte Zusammenleben von Menschen aller Nationen ein urbanes Modell menschlicher Einheit und gelebter Völkerverständigung zu schaffen, wobei jeder einzelne die Möglichkeit für ein freies spirituelles Wachstum haben soll.
Die Arbeit der Aurovillianer führte zu vielfältigen interkulturellen, architektonischen, ökologischen und sozialen Ansätzen. Dabei hat sich auch das äußere Bild der Region geändert: Ein ursprünglich völlig ausgedörrtes Gebiet wurde in eine grüne Oase mit über 1,5 Millionen Bäumen und Büschen verwandelt, und es wurden zahlreiche Häuser, Gärten, Sportstätten, Betriebe und Schulen errichtet. Die Unesco hat ihre Mitgliedsstaaten in mehreren Resolutionen zur Förderung des Projekts eingeladen.
Das spirituelle Zentrum Aurovilles ist das Matrimandir, „die Seele Aurovilles“ in Form einer sphärischen (oben und unten leicht abgeflachten) Kugel, errichtet auf einem Grundgerüst von vier Pfeilern. Im Inneren findet sich ein großer Meditationssaal mit einem großen, in Deutschland gefertigten Kristall im Zentrum.
Avadhūta m ein Asket, der jede Bindung an weltliche Dinge abgeschüttelt hat (ava-dhūta) und sich mit extremer Entsagung ganz seinen spirituellen Praktiken widmet. Der bereits vollkommene Avadhūta wird auch Paramahamsa genannt, der noch unvollkommene Parivrāj, Wanderer.
Avadhūtagītā f ein Werk des späten Vedānta, das den Lebensstil des entrückten Asketen beschreibt, der sich ganz von der Welt gelöst hat.
Āvarana [āvaraṇa] n Verbergen, Verhüllen, Verschleiern; Schleier der Unwissenheit.
Avasthā f Zustand, Bewusstseinszustand. Dieser Begriff wird zum einen gebraucht, um den Status des Yoga-Aspiranten auf seinem Weg zu beschreiben, zum anderen (in der Tradition des Vedānta), um vier grundlegende Bewusstseinszustände des Menschen zu bezeichnen, d.h. Wachen, Träumen, Schlafen und den „Vierten“, reines Bewusstsein. Diese werden ausführlich in der Māndūkya-Upanishad erläutert.
Siehe auch Ārambhāvasthā, Ghatāvasthā, Paricayāvasthā, Nishpattyavasthā, sowie Jāgrat, Svapna, Sushupti, Turīya.
Avatāra m Herabkunft, Avatār (von der Wurzel ava-tṛ, herabkommen). Bezeichnet die Inkarnation des Göttlichen auf Erden, die jenseits aller karmischen Zwänge erfolgt mit dem Ziel, die Menschheit in ihrer Evolution und spirituellen Entwicklung voranzubringen. So sagt Krishna in Vers 4.7 der Bhagavadgītā: „Immer wenn Dharma verfällt und Adharma zunimmt, manifestiere ich mich.“
Die Purānas beschreiben die zehn Inkarnationen Vishnus, zu denen neben Krishna auch Rāma, Buddha und Kalki gehören – letzterer soll am Ende des Kali Yuga, des dunklen Zeitalters, auf einem weißen Schimmel reitend erscheinen und für die Menschheit ein neues Zeitalter des Lichts einläuten.
Auch viele Yogīs der Vergangenheit und Gegenwart wurden von ihren Anhängern als Avatār bezeichnet.
Siehe auch Amshāvatāra, Pūrnāvatāra.
Avidyā f Nicht-Wissen (a-vidyā), Nichterkenntnis. Im spirituellen Kontext die Unfähigkeit, zwischen dem vergänglichen Unwirklichen und der unvergänglichen Realität zu unterscheiden. Yogasūtra II, 3-4 erklärt, dass Avidyā als erster der fünf Kleshas oder Leidfaktoren ursächlich für die anderen vier sei. In Sūtra 5 heißt es: „Unwissenheit ist es, wenn man das Nicht-Ewige, Unreine, Schmerzliche und das Nicht-Selbst für das Ewige, Reine, Freudvolle und das (wahre) Selbst hält.“
Avyakta adj und n nicht-offenbar (a-vyakta), unmanifestiert. Bezeichnet im Sānkhya die Urnatur, Prakriti, in ihrem noch unentfalteten Zustand.
ayam ātmā brahmā „dieser Ātman ist Brahman“, ein großer Lehrsatz (Mahāvākya) der Upanishaden.
Ayodhyā f im Epos Rāmāyana die Hauptstadt im Reich des Königs Rāma; eine der sieben heiligen Städte des Hinduismus. Wörtlich „die Unbezwingbare“.
Āyurveda m die Wissenschaft vom Leben (oder: vom langen Leben), āyur-veda. Der älteste überlieferte Text, die Caraka-Samhitā, geht wahrscheinlich auf das 2. Jh. zurück und ist ein bemerkenswertes Zeugnis des Genius der altindi-schen Medizinwissenschaft, die gleichzeitig auch eine Lebenslehre war. Ein spiritueller Kontext wird hergestellt, indem es in der Einleitung heißt, dass Freiheit von Krankheit die Basis für die Verwirklichung der vier Lebensziele des Menschen (Purushārtha) sei, deren höchstes Moksha ist, spirituelle Befreiung.
Der Āyurveda basiert auf dem System der drei Doshas, d.h. Humore oder Körpertemperamente. Wenn sie aus dem Gleichgewicht geraten, entstehen gesundheitliche Störungen und Erkrankungen.
Die Therapien des Āyurveda beinhalten Anwendungen wie Massage, Ölguss, Wasserbad und pflanzliche Heilmittel, welche einzelne Doshas stärken und das Gleichgewicht wieder herstellen sollen. Doch gleichzeitig wird der Patient auch ermutigt, eine gesunde geistige Grundhaltung in Form von Gleichmut und Frohsinn zu kultivieren, da negative Gemütszustände die körperliche Gesundheit in Mitleidenschaft ziehen können.
Traditionell bestand eine enge Verbindung zwischen Āyurveda und Yoga. Aktuell widmen einige Buchtitel sich der Frage, wie die Erkenntnisse des Āyurveda eingesetzt werden können, um z.B. Āsanas optimal auf die individuelle Konstitution des Übenden abzustimmen.