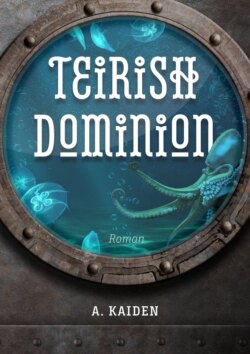Читать книгу Teirish Dominion - A. Kaiden - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 2
ОглавлениеTailor – Samstag, 16:45 Uhr
Dampf umschlingt die Leute in einem dichten Nebel. Hektisches Geklapper von Töpfen, Pfannen und Geschirr überall. Schweiß dringt aus unseren Poren und in der Luft liegt der betörende Geruch von angebratenem Fleisch und gekochtem Gemüse. Die Stimmung ist angespannt und zeichnet sich in den Gesichtern meiner Kollegen wider. Nur in meinem nicht. Ich liebe meine Arbeit durch und durch, auch wenn meine Mutter zuerst gegen meine Berufswahl war, so hat sie mich nicht davon abhalten können, die Ausbildung als Koch zu beginnen. Wahrscheinlich hat sie gehofft, ich würde nach kurzer Zeit meine Meinung und meinen Berufsweg ändern, jedoch musste ich sie enttäuschen. Sie wird drüber wegkommen, da bin ich mir sicher. Monotone Büroarbeit oder technische Dinge waren noch nie mein Ding gewesen. Ich liebe es einfach, Menüs für andere zuzubereiten. Den Duft des Essens, während es vorbereitet wird und wenn es fertig ist. Die Gerichte auf den Teller ansprechend zu verteilen. Und vor allen Dingen die erfreuten Gesichter oder zumindest die Vorstellung daran, wenn die Gäste das bestellte Essen serviert bekommen und es sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich könnte mir keinen anderen Beruf für mich vorstellen. Deswegen macht mir wohl der Stress nicht ganz so viel aus wie meinen Arbeitskollegen, doch ich bin mir sicher, sie haben ihren Beruf gern, auch wenn sie sich meistens beschweren. Warum wären sie sonst noch hier?
„Tailor, bist du mit der Soße fertig?“
„Fast. Gib mir eine Minute“, rufe ich mit einem Lächeln im Gesicht zurück, das schon manch einen hier auf die Palme gebracht hat. Schnell schmecke ich die Brühe ab, während Niklas drängelt.
„Wir haben keine Minute mehr Zeit! Die Pommes und die Schnitzel sind fertig und müssen raus!“
„Alles klar. Schmeckt perfekt und ist heiß. Just in time.“
Ich verteile die Soße geübt auf die fertigen Teller und Niklas verdreht genervt die Augen, bevor er sie zur Theke bringt und läutet.
„Du solltest ihn nicht immer so reizen, auch wenn ich es immer wieder zum Schießen finde.“
Thomas lacht beherzt auf und seine Grübchen treten dabei zum Vorschein, die ihn noch sympathischer machen, als er ohnehin schon ist. Ich grinse verschmitzt, während ich nach der nächsten Ladung Pommes sehe.
„Ich weiß nicht, was du meinst. Hab ja schließlich nichts gemacht.“
Er zwinkert mir noch einmal zu und widmet sich dann wieder den Salaten zu, während Niklas zurückkommt. Ich hätte es mit meiner Ausbildungsstelle nicht besser treffen können. Die Bezahlung ist in Ordnung und die Mitarbeiter sind top, die Vorgesetzten fair. Was kann ich mehr verlangen? Mein Leben könnte nicht besser laufen. Mit innerer Ruhe gebe ich mich voll und ganz meiner Arbeit hin.
*
Es ist fast 17 Uhr, als ich meine Pause antrete und kurz frische Luft schnappe, die mir kalt entgegenschlägt und meine erhitzte und verschwitzte Haut mit einem Schauer abkühlt. Ich schließe kurz meine müden Augen und beginne sanft, mit den Fingern mein Gesicht zu massieren. Da heute drei Leichenschmäuse anstanden, bin ich schon seit elf Uhr morgens dort. Heute sind wohl Überstunden angesagt, aber das macht mir nichts aus. Damit habe ich schon gerechnet. Langsam bewege ich meinen Kopf abwechselnd nach links und nach rechts, sodass mein Genick laut knackt. Das hat gutgetan. Ich atme tief durch, um die letzten Spuren der Müdigkeit, wenn auch nur kurzfristig, zu vertreiben. Für einige Augenblicke stehe ich einfach nur da und lausche den Geräuschen um mich herum. Kinder streiten sich um einen MP3-Player und belustigtes Lachen von einer Männergruppe mittleren Alters hallt zu mir herüber. Ein paar junge Frauen kichern und lästern über andere, die zurzeit nicht bei ihnen sind. Eine ältere Dame tadelt ihren Ehegatten, weil er einer jungen Bedienung hinterhergesehen hat. Ein amüsiertes Schmunzeln rinnt über mein Gesicht. Entspannt öffne ich meine Lider und strecke mich kurz. Die Sonne steht hoch am Himmel und schenkt uns einen milden Septembertag. Ein wundervoller Tag. Meine Gedanken schweifen kurz zu meiner Familie. Ich hoffe nur, dass meine kleine Schwester das Wetter nutzt und irgendetwas mit ihren Freundinnen unternimmt. Sie schließt sich viel zu oft in ihrem Zimmer ein, um zu lesen. Dabei täte es ihr gut, öfter rauszukommen. Auch wenn sie es nicht offen sagt, so sehe ich doch, dass unser Zuhause sie erdrückt.
Ich seufze leicht auf, als mein Handy plötzlich anfängt in der Hosentasche zu vibrieren. Etwas ungeschickt krame ich es hervor und starre kurz auf das Display, bevor ich den Anruf annehme.
„Mama?“
Ein mulmiges Gefühl durchzieht meine Eingeweide. Meine Mutter ruft mich sonst nie auf meinem Handy an, außer wenn etwas passiert ist.
„Tailor? Ich habe dich schon fünfmal versucht zu erreichen, doch du bist nicht drangegangen!“
Die Stimme meiner Mutter überschlägt sich und etwas Vorwurfsvolles klingt in ihr mit.
„Tut mir leid, aber während der Arbeit kann ich nicht an das Telefon gehen. Das weißt du doch. Außerdem hab ich es nicht bemerkt. Was ist …“
„Ja, aber wieso kannst du denn jetzt telefonieren?!“
Ich verdrehe kurz meine Augen und massiere mit meiner freien Hand die Schläfe. Manchmal kann sie dermaßen anstrengend sein. Besonders wenn es um meine Ausbildung zum Koch geht, da hat sie einfach kein Verständnis dafür. Für einen Moment vergesse ich das flaue Gefühl, das sich in meinem Magen eingenistet hat.
„Ich habe gerade Pause, Mama. Was gibt es? Wieso rufst du mich an?“
Ein kurzes Schweigen tritt ein und ich bin mir nicht sicher, ob sie meine Frage verstanden hat. Als ich diese gerade wiederholen möchte, antwortet sie.
„Deine Schwester, sie … sie liegt im Krankenhaus. Sie wacht nicht mehr auf. Gerhard und ich sind gerade dort und warten, bis wir in die Intensivstation dürfen.“
Für einen Moment steht die Zeit still. Die Worte habe ich wohl verstanden, doch ich weigere mich, sie in mein Gehirn dringen zu lassen. Meine Hände zittern und fühlen sich mit einem Mal taub an, sodass mir mein Handy fast aus den Händen gleitet. Ein unsichtbares Band schnürt meine Kehle zu und das Atmen fällt mir schwer.
„Tailor? Tailor, bist du noch dran?“, hallt die ängstliche, schon fast hysterische Stimme meiner Mutter an mein Ohr.
„Ich … ja. Wie konnte das passieren?“, antworte ich krächzend, da ich kaum einen Ton herausbekomme. Es scheint, als hätten mich alle Kräfte verlassen und ich sacke langsam auf den Boden. Vor meinen Augen wird es kurz schwarz. Ich kann nicht verstehen, was gerade geschieht. Das darf doch nicht wahr sein! Das kann unmöglich jetzt passieren! Doch leider passiert es und es gibt kein Entrinnen.
„Das wissen wir nicht. Deine Schwester hat sich mal wieder in ihr Zimmer verkrochen und ich habe sie gerufen, damit sie mir hilft, das Mittagessen zu machen. Als keine Reaktion erfolgt ist, wollt ich sie holen gehen. Sie … sie lag regungslos in ihrem Bett.“
Meine Mutter stockt und mir wird schwindelig. Warum kann es nicht ein Traum sein? Ein einfacher, schlimmer Albtraum aus dem ich in wenigen Sekunden erwache?
„Was, was war dann?“, frage ich kraftlos nach und meine eigene Stimme klingt fremd und verzerrt.
„Ich hab sie versucht zu wecken, doch sie hat auf nichts reagiert. Tailor, ich hab ihr sogar eine Ohrfeige gegeben! Sie ist einfach nicht aufgewacht! Was hätte ich anderes tun sollen? Gerhard hat schließlich den Krankenwagen gerufen.“
Ich schließe kurz meine Augen und warte, bis meine Umgebung aufhört, sich zu drehen. Dann schlage ich sie wieder auf und richte mich vorsichtig auf meine wackeligen Beine auf.
„In Ordnung. Ich mache mich sofort auf den Weg.“
Ohne eine Antwort abzuwarten, lege ich auf und schwanke wie ein Betrunkener zurück zu meinen Kollegen und Vorgesetzten.
*
Ich drücke hastig auf den Knopf für den Fahrstuhl. Es dauert viel zu lange, bis er ankommt. Nervös wende ich mich ab und schlage den Weg ins Treppenhaus ein. Immer zwei Stufen auf einmal nehmend renne ich nach oben. Jede Sekunde ist kostbar. Ich darf keine Zeit verlieren. Die seltsamen Blicke der Leute, die ich streife, nehme ich aus meinen Augenwinkeln wahr, jedoch nur flüchtig. Schnell reiße ich die Tür auf und folge der Beschilderung in Richtung Intensivstation. Nur mit Mühe kann ich mich beherrschen, nicht zu rennen. Die Flure erscheinen mir endlos, erinnern mich an ein unüberschaubares Labyrinth. Als ich um die nächste Ecke eile, sehe ich meine Mutter mit ihrem Freund. Erwartungsvoll blicke ich beide an, doch meine Mutter schüttelt ihr aschfahles Gesicht. So blass habe ich sie noch nie gesehen. Meine nicht ausgesprochene Frage ist mit ihrer Geste beantwortet und raubt mir beinahe jegliche Hoffnung. Ich nehme meine Mutter in den Arm und streiche ihr tröstend über den Rücken, bevor ich Gerhard zur Begrüßung die Hand reiche.
„Wart ihr schon bei ihr drin?“, frage ich und versuche, meiner Stimme einen festen Klang zu verleihen, was mir nicht ganz glückt.
„Ja, allerdings durften wir nicht lange bleiben“, antwortet mir Gerhard und nimmt meine Mutter in den Arm.
„Wir haben aber Bescheid gesagt, dass du noch kommst und auch rein musst. Das geht in Ordnung. Wir müssen nur klingeln“, fügt meine Mutter schnell hinzu und ich nicke ihr zu.
„Danke.“
Gerhard zeigt mir, wo ich meine Hände desinfizieren kann und einen Kittel sowie Handschuhe herbekomme. Meine Mutter betätigt die Klingel und es dauert ganze weitere fünf Minuten, bis eine Schwester schließlich öffnet.
*
Außer Melisse sind fünf andere Personen im Zimmer der Intensivstation. Blaue Plastikvorhänge trennen die verschiedenen Betten. Es ist zu eng und viel lauter, als ich gedacht habe. Von jeder Seite hört man das mechanische Piepen der Geräte. Menschen stöhnen und ächzen und für einen kurzen Moment ertappe ich mich dabei, wie meine Gedanken einen Vergleich mit einem Versuchslabor für Menschen machen. Ich schüttle schnell meinen Kopf. Dafür ist jetzt keine Zeit. Ich ziehe den Vorhang beiseite und trete an das Bett. Am liebsten würde ich meine Schwester sofort hier rausbringen. Wie soll sie sich hier erholen? Wie zu sich kommen? Ich balle meine Hände zu Fäusten und ich sehe langsam auf sie herab. Mein Herz macht einen schmerzenden Sprung, als ich sie so daliegen sehe. Leblos. Die Hände flach neben sich liegend. Zögernd streiche ich ihr über ihre kalte Wange. Ich fühlte mich so hilflos. Was soll ich tun? Kann ich überhaupt etwas unternehmen?
Vorsichtig setze ich mich auf den Rand des Bettes und greife nach ihrer Hand. Irgendwo habe ich mal gelesen oder gehört, dass Bewusstlose Berührungen und Worte wahrnehmen können. Ob das stimmt, weiß ich nicht, doch ich hoffe darauf.
„Ähm, hallo Melisse. Wie geht es dir?“, beginne ich zögernd, lache im nächsten Moment beschämt auf. Kann man sich denn noch bescheuerter verhalten? Wie geht es dir? Bestimmt super, deswegen liegt sie auch in einer Art Koma. Was bin ich doch für ein dämlicher Idiot! Ich beiße mir auf meine Unterlippe und der Schmerz hilft mir, meine Tränen zu unterdrücken.
„Die Frage war überflüssig. Tut mir leid. Es ist nur so … ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll“, murmle ich aufs Neue und drücke sanft ihre Hand. So klein, zierlich und reglos. Ein Krampf schüttelt meinen Körper und in mir beginnt etwas zu schreien.
„Melisse, ich bitte dich. Bitte, wach auf! Was ist passiert? Wie soll es denn jetzt weitergehen? Was soll ich machen ohne dich? Wie soll ich denn so ein Auge auf dich haben? Okay, nicht witzig, nicht wahr?“
Eine Träne bahnt sich ungehindert ihren Weg aus meinem Auge und hinterlässt eine fast unsichtbare Spur auf meiner Wange. Die Hilflosigkeit verbündet sich mit dem Schmerz und frisst mich von innen auf. Meine Schwester rührt sich nicht. Ich bin mir sicher, sie hört mich nicht. Alles Unsinn, was in den Medien verbreitet wurde. Schwachsinn. Ich bin so ein Idiot. Ich hätte es verhindern müssen. Sie aufhalten. Sie retten. Auch wenn ich nicht weiß, wie ich das hätte machen sollen. Ich weiß nicht einmal, was passiert ist. Als eine Krankenschwester mir bedeutet, dass meine Zeit um ist, hauche ich Melisse einen leichten Kuss auf die Hand. Dann verlasse ich schweren Herzens die Intensivstation.
*
Seit Stunden wälze ich mich ruhelos im Bett. Zu viele Gedanken gehen mir durch den Kopf. So kann ich unmöglich schlafen. Immer wieder sehe ich Melisse vor mir, wie sie mich heute Morgen noch verabschiedet und mir viel Spaß und Erfolg für meinen Tag gewünscht hatte. Was mag danach nur passiert sein? Was hat sie noch gemacht?
Seufzend hieve ich mich auf meinen Rücken und starre an die Zimmerdecke. Ich habe meine Mutter zigmal ausgefragt, jedoch keine andere Aussage oder mehr Informationen wie am Telefon erhalten. Ratlos schließe ich kurz meine Augen und reibe mir mit meinen Händen über meine Lider. Dieses scheußliche Zimmer der Intensivstation … Dort kann sie sich nicht wohl fühlen, auch wenn sie nicht bei Bewusstsein ist. Das weiß ich. Ich kenne sie.
„Verdammt!“
Ich schlage mit der flachen Hand auf die Matratze und fluche leise vor mich hin. Dann stehe ich mit einem Ruck auf und schleiche mich in die Küche im Erdgeschoss, wo ich mir ein Glas Wasser einschenke. Ruhelos lasse ich mich auf dem Stuhl am Fenster nieder und starre hinaus auf die dunkle Landschaft, die nur schwach vom Schein einzelner Laternen beleuchtet wird. Die Straßen sind menschenleer und trostlos. Nicht einmal das schimmernde Licht der Sterne und des Mondes ist zu sehen. Eine dichte Wolkendecke verbirgt sie. Ich seufze lautlos auf. Meine innere Unruhe möchte nicht weichen. Wie soll ich auch schlafen, wo meine Schwester bewusstlos ist und mir keiner sagen kann, wann und ob sie jemals wieder aufwacht? Verzweifelt trete ich gegen die Wand. Ein altes Bild springt mir ins Auge und lässt mich verharren, scheint meine Wut zu lähmen. Es zeigt meine Schwester und mich, als ich gerade eingeschult worden bin. Das war kurz nachdem unser Vater uns verlassen hat. Ein leichtes Schmunzeln umspielt meine Mundwinkel bei der Erinnerung, wie das Bild geschossen wurde. Ich habe es schon früher gehasst, fotografiert zu werden. Ich hatte mich auch damals geweigert und meine Mutter konnte mich nur damit überreden, dass auch Melisse mit auf das Bild durfte und die wollte damals unbedingt meine Schultüte halten. Sie war so stolz gewesen und ich fand sie dermaßen niedlich, dass ich ihr gleich die Hälfte meiner Süßigkeiten abgegeben habe. Na ja, zumindest nachdem ich sie fast den ganzen Tag geärgert und ihr die Nase lang gezogen hatte. Nachdenklich fahre ich mir durch mein wirres Haar und nehme noch ein Schluck vom Wasser. Auf dem Bild sieht man deutlich den Kontrast. Wir sehen uns optisch nicht sehr ähnlich. Meine Schwester kommt komplett nach unserem Vater: haselnussbraune Haare und mandelförmige, walnussbraune Augen. Ich dagegen bin völlig nach unserer Mutter geraten: blond mit kristallblauen Augen, wie es Melisse immer beschrieben hat. Na ja. Das Einzige, was wir äußerlich gemeinsam haben, ist die Form unserer Augen und unser brauner Teint. Ansonsten sind wir völlig verschieden. Auch charakterlich gehen wir weit auseinander. Ich bin mehr der offene Typ, wobei sie mehr verschlossen und in sich gekehrt ist. Doch das war nicht immer so … oder? Gedankenverloren stiere ich auf die Fotografie. Nein, früher war sie sehr lebhaft gewesen. Erst mit den Jahren hat sie sich in die Richtung entwickelt. Ich weiß gar nicht mehr, wann es begann, dass ich nicht mehr zu ihr durchdringen konnte.
Abermals seufze ich auf, bevor ich ermattet aufstehe und zurück in mein Bett wanke. Meine Suche nach Antworten bleibt erfolglos. Heute Nacht werde ich sie nicht finden. Schlafen kann ich jedoch auch nicht.