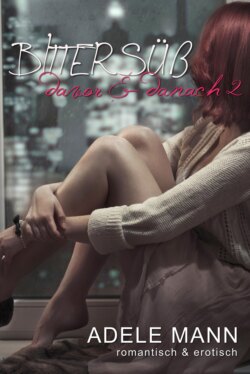Читать книгу Bittersüß - davor & danach 2 - Adele Mann - Страница 3
Kapitel 1
ОглавлениеJan – 2013
Ich lebe.
Seltsamerweise bringt dieser Gedanke kein bisschen Erleichterung mit sich. Noch immer ist alles völlig schwarz. Ich fühle dumpf pochenden Schmerz überall. Im Moment macht genau das meine Welt aus.
Aber wieso?
Was ist passiert?
Da war ein Unfall. Ich hatte einen Unfall.
Aber egal wie sehr ich versuche, mich zu erinnern, die Bilder entgleiten mir schneller, als ich sie zusammensetzen kann. Es hilft nichts. Ich muss die Augen öffnen, auch wenn jede Faser meines Körpers sich dagegen sträubt. Meine Lider fühlen sich unfassbar schwer an, und je mehr ich versuche, sie auseinanderzubekommen, desto stärker wird das Pochen in meinem Schädel. Als würde eine derart banale Bewegung mir alles an Kraft abverlangen. Frustriert stoße ich Luft aus meiner Luge. Ein dummer Fehler. Sofort lodert ein stechender Schmerz in Brust und Bauch auf, der die bohrenden Kopfschmerzen fast vergessen macht. Doch es ist etwas ganz anderes, das mir wirklich Angst einjagt. Ich fühle unterhalb meines linken Oberschenkels kaum etwas. Angetrieben von der Panik, die genau dieser Gedanke ausgelöst hat, ziehe ich die verklebten Augen so lange auseinander, bis ein verschwommener heller Raum erscheint. Erst jetzt nehme ich die Geräusche dieses Zimmers bewusst wahr. Ein gleichmäßiges Piepen, das mit jeder Sekunde in einem immer schneller werdenden Rhythmus zu hören ist.
Krankenhaus. Unzufrieden stöhne ich. Allmählich fügen sich die einzelnen Bausteine zusammen. Ich hatte einen Autounfall, habe Schmerzen und liege in einem Krankenhaus, mit Gott-weiß-was für Verletzungen.
Scheiße!
Der Versuch zu sprechen, um nach Hilfe zu rufen, scheitert kläglich an meiner völlig trockenen Kehle und diesem widerlich pelzigen Geschmack in meinem Mund, der mir Übelkeit verursacht. Langsam wage ich es, mich umzudrehen. Vielleicht ist ja noch jemand mit mir hier drinnen.
Fehlanzeige. Bei der kleinsten Bewegung fühlt sich mein Kopf an, als hinge eine Kanonenkugel an ihm, eine ziemlich schwere sogar. Ich kann mich nicht erinnern, je solche Kopfschmerzen gehabt zu haben. Also gebe ich meinen Versuch, den Kopf zu drehen, auf und taste stattdessen mit den Fingern, die ich – Wunder, oh Wunder – tatsächlich schmerzfrei bewegen kann, nach einer Art Klingel. Doch außer einer Menge Schläuche, die mir eine Scheißangst machen, finde ich nichts dergleichen. Gleichzeitig sehe ich an die Decke und versuche mein Sehvermögen zu verbessern, indem ich mich so lange auf die Deckenverkleidung konzentriere, bis die porösen Platten klar vor mir erscheinen. Mein scharf gestellter Blick offenbart mir aber lediglich das, was ich ohnehin schon weiß. Ich liege in einem Krankenhauszimmer, allein. Mein linkes Bein hängt an einer Art Vorrichtung, und ich bin froh, dass ich es nicht genau sehen kann, denn bei dem Anblick wird mir richtig schlecht. Ein scheußlich saurer Schwall drängt sich meine Speiseröhre nach oben. So schnell ich kann, drehe ich mich zur Seite, was höllisch schmerzt und dennoch zu spät kommt. Ich kotze hässliche grüne Masse auf eine schneeweiß bezogene Matratze. Verdammter Mist! Wieso ist mein Erbrochenes grün?
Panik erfasst mich. Ich will hier weg. Nur weg. Was zur Hölle ist los mit mir? Das Piepen neben mir wird lauter und schneller, immer lauter und schneller. Mir bricht der Schweiß aus. Mein flacher Atem fällt schwer, und wütende Tränen brennen in meinen müden Augen.
Die Tür zu meinem Zimmer wird aufgerissen und zwei ernst aussehende Schwestern kommen an mein Bett gestürmt. Eine – groß, Mitte vierzig mit dunklen Haaren – drückt mich vorsichtig zurück ins Bett. Die andere – jünger und aschblond – überprüft die Schläuche, die an mir hängen, und drückt einen Knopf an einer schmalen Säule neben mir, die ich bisher gar nicht wahrgenommen habe. Während ich mich instinktiv dagegen wehre, länger hier festgehalten zu werden, fühle ich, wie sich eine dumpfe Müdigkeit über mich legt, die auch den Schmerz davonspült. Dankbar dafür, fallen mir die Augen zu.
Als ich wieder zu mir komme, riecht es sauber und die Schweinerei auf den Krankenhauslaken ist verschwunden. Auch das trockene Gefühl im Mund ist besser. Offenbar hat mir eine von ihnen Flüssigkeit eingeflößt. Erschrocken bemerke ich, dass drei Männer neben meinem Bett stehen und mich besorgt und befangen ansehen. Einer davon ist Arzt. Er muss Ende fünfzig sein. In dem weißen Kittel wirkt er größer, als er eigentlich ist. Er hat dichtes graues Haar. Nur der Ausdruck auf seinem Gesicht gefällt mir nicht. So sieht jemand aus, der schlechte Nachrichten hat. Genau so sehen auch die anderen Männer aus, die in Polizeiuniform hinter dem Arzt warten. Beide sind etwa in meinem Alter. Vielleicht ist der größere auch schon dreißig. Stumm blicke ich sie an, während sie mich ganz offen anstarren.
„Herr Herzog. Mein Name ist Doktor Nowak. Die Herren hinter mir sind von der Polizei und haben ein paar Fragen zum Unfall, in den Sie verwickelt waren. Zuerst einmal … fühlen Sie sich schon bereit, mit ihnen zu sprechen?“
Ruhig und abwartend mustert der Arzt mich. Keine Ahnung, ob ich bereit bin. Ich will nur endlich wissen, was passiert ist.
„Ich denke schon“, krächze ich. Dr. Nowak reagiert sofort und reicht mir eine Schnabeltasse mit Flüssigkeit. Wasser. Noch nie hat einfaches Wasser so gut geschmeckt. Selbst aus dieser peinlichen Kindertasse.
„Gut. Wenn die Herren sich kurz fassen würden. Herr Herzog und ich müssen uns noch ausführlich über seinen Gesundheitszustand unterhalten. Das hat in jedem Fall Vorrang.“
Er wirft den Beamten einen warnenden Blick zu, ehe er den Raum verlässt. Nun bin ich alleine mit den beiden Polizisten. Der Kerl, der in meinem Alter ist und vielmehr wie ein Boxer aussieht als ein Gesetzeshüter, tritt näher an mein Bett heran.
„Ich hoffe, Sie haben nicht allzu schlimme Schmerzen?“ Betreten blickt er mich von oben bis unten an.
„Es ist besser, seit sie mir irgendein Zeug über diesen Knopf da geben“, lasse ich ihn wissen und blicke dabei auf die Säule neben meinem Bett, an der ein Infusionsbeutel hängt.
Knapp nickt er.
„Was können Sie uns über den Unfallhergang erzählen?“
Sein Kollege öffnet einen Notizblock und starrt mich dabei unverkennbar an, was mir gar nicht gefällt und mich wütend macht. Die Mütze ist ihm zu groß, was lächerlich aussieht.
„Ich weiß nur noch, dass ich mit dem Auto unterwegs war und einer von der anderen Spur zu mir rüber geschlittert ist. Alles danach ist irgendwie ein einziges Durcheinander … Es ging so schnell … Ich konnte nicht ausweichen und dann ist er mir reingefahren … Nach dem Aufprall kann ich mich an nichts mehr richtig erinnern. Da sind ein paar Bilder … aber viel zu undeutlich“, sage ich ihnen. Die Beamten sehen sich kurz an.
„Das ist nicht ungewöhnlich, Herr Herzog.“ Der jüngere Polizist verzieht mitleidig seinen Mund und richtet die schlecht sitzende Mütze.
„Weiß man schon, wieso der andere Fahrer auf meine Seite geraten ist?“, frage ich ihn und schlucke ein paarmal.
„Die Untersuchungen dazu laufen noch, und wir werden Ihnen natürlich Bescheid geben, sobald wir etwas Endgültiges wissen.“ Ernst sieht er mich an.
„Fest steht bisher nur, dass der Fahrer etliche Kilometer vor der Unfallstelle bereits zweimal auf die falsche Spur geraten ist. In der Notrufzentrale sind zwei Meldungen von Verkehrsteilnehmern dazu eingetroffen … Zu Ihrem Glück.“
Verständnislos sehe ich ihn an.
„Als die zweite Meldung über einen Fahrer bei uns eintraf, der beinahe mit einem Wagen zusammengekracht wäre, haben wir sofort eine Einheit losgeschickt, um die Strecke nach dem gemeldeten Fahrzeug abzusuchen. Dieses Einsatzfahrzeug hat Sie gefunden und den Notarzt gerufen, gerade noch rechtzeitig. Sonst wären Sie verblutet … Wissen Sie, auf dieser Strecke ist normalerweise um diese Zeit nicht besonders viel Verkehr.“
Eiskalt läuft es mir den Rücken hinab. Ich habe also nur überlebt, weil dieser Verrückte vor mir fast schon einmal mit einem anderen zusammengekracht wäre.
„Was ist mit dem anderen Fahrer?“ Wut brodelt in mir hoch.
„Ihr Unfallgegner ist tot. Er hat den Aufprall nicht überlebt.“
Ich schlucke, doch die Wut geht nicht weg. Sie ist wie eine harte Faust in meinem Magen. Er ist also tot. Und ich hätte auch tot sein können. Stattdessen liege ich hier und weiß noch nicht einmal, wie es um mich steht, weil der Arzt noch nicht mit mir gesprochen hat.
„Ist alles so weit in Ordnung, Herr Herzog?“, fragt der Beamte, der die ganze Zeit mitgeschrieben hat. Ich möchte schreien, dass nichts in Ordnung ist und er nicht so eine dumme Frage stellen oder sich zumindest eine anständige Mütze besorgen soll. Stattdessen nicke ich unbestimmt und schlucke alles andere runter.
„Mein Wagen … Er ist bestimmt ein Totalschaden.“
Jetzt sind es die beiden, die stumm nicken. Was soll’s. Ich werde einen neuen leasen, sobald ich hier rauskomme. Je früher, desto besser. Hier ist es nicht auszuhalten.
„Wir haben übrigens Ihre Eltern verständigt. Sie sind derzeit im Ausland und kommen so schnell sie können.“
Mit einem Lächeln wartet er auf meine Reaktion. Doch er wartet vergebens. Denn das ist nicht die aufmunternde Nachricht, die ich mir erhofft habe. Denn ich weiß, sobald sie hier sind, werden sie eine Show abziehen und mit ihrem Geld um sich werfen, mir aber dennoch still und heimlich verübeln, dass mein Unfall ihren Urlaub zunichtegemacht hat. Ich kenne meine Eltern. Diese Polizisten würden das nicht verstehen. Vermutlich würden ihre Eltern panisch vor dem Zimmer sitzen, voller Sorge, ihres Lebens nicht mehr froh, weil ihr geliebter Sohn hier drinnen liegt. Wütend darüber presse ich die Augen zu und schiebe Schmerzen vor.
„Könnten Sie jetzt vielleicht meinen Arzt reinschicken?“
„Natürlich. Wir waren ohnehin fertig. Fürs Erste.“
Erleichtert atme ich aus und warte, bis die Polizisten den Raum verlassen haben und der Arzt zurückkommt.
Dr. Nowak schließt die Tür hinter sich. Er kommt langsam und vorsichtig auf mich zu. In der Hand hält er ein Klemmbrett. Er nimmt auf einem Stuhl neben meinem Bett Platz und setzt dabei eine randlose Brille auf.
„Herr Herzog.“
„Herr Doktor.“
Sein Blick huscht über die Blätter auf dem Klemmbrett, ehe er mich direkt ansieht. Kurz atmet er tief ein. Sein Blick ist freundlich, aber besorgt. Ich spüre eine Gänsehaut.
„Bevor wir zu Ihrer Operation und den Narben in Ihrem Gesicht kommen, müssen wir über Ihr Bein sprechen.“
Mehr muss er gar nicht sagen. Sein Blick und seine Körpersprache reichen völlig aus. Meine Finger tasten nach Verbänden in meinem Gesicht. Oh Gott! Wieso habe ich das nicht vorher bemerkt? Haben sie mich deshalb so angestarrt?
Ich bin am Arsch. Ich weiß es. So schnell komme ich hier nicht weg. Er muss es gar nicht aussprechen, auch wenn er das gleich tun wird. Ich weiß auch so, dass mein Bein kaputt ist, dass ich kaputt bin. Und allein.