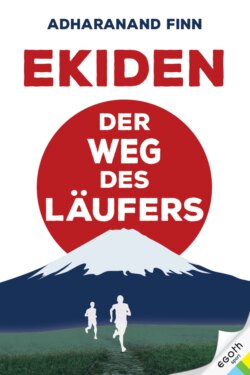Читать книгу Ekiden - Adharanand Finn - Страница 11
6
ОглавлениеWenn man an der Ritsumeikan-Universität am Rande von Kyoto ankommt, so sieht man als Erstes eine Laufbahn. Die Bahn liegt in einer mit Gras bepflanzten Senke vor den Hauptgebäuden. Alle, die mit den endlosen Shuttlebussen von und zur Zugstation ankommen oder abfahren, sehen die Laufbahn und die Athleten, die darauf laufen. Es ist eine ständige Erinnerung an die zentrale Rolle, die der Sport, und im Speziellen das Laufen, an japanischen Universitäten einnimmt.
Zusätzlich zu seinem Amateurverein Blooming hat Kenji vor Kurzem begonnen, die Ekiden-Teams der Männer an der Ritsumeikan-Universität zu trainieren. Diese Mannschaft ist eine der größten außerhalb Tokios und Umgebung.
In Japan sind Universitätsteams die beliebtesten Ekiden-Teams. Das liegt zum Teil daran, dass – wie Kenji es schon seinen Läufern von Blooming gesagt hat – die Profimannschaften zu berechenbar und die Rennen dadurch nicht mehr so aufregend sind. Doch zum Großteil liegt es am Hakone.
Im Herzen des japanischen Laufsports gibt es einen Wettbewerb, eine Veranstaltung, die weit über allen anderen steht: der Hakone Ekiden. Schon jetzt taucht dieser Name bereits überall auf, doch erst am Ende meiner sechs Monate in Japan weiß ich, wie viel Drama und Bedeutung bei diesem Wort mitschwingen. Ich sehe, wie die Leute reagieren, wenn ich dieses Wort erwähne, wie ihre Augen größer werden.
„Ikimasu“, sage ich dann ganz ehrfürchtig zu ihnen, ich werde dort sein, so als ginge es um eine Pilgerreise ins Heilige Land. Wenn sie mich das sagen hören, wissen sie, wie ernst ich es meine.
Der Hakone ist nicht nur der größte Wettbewerb im japanischen Rennkalender, er ist die größte jährliche Sportveranstaltung in Japan. Das Rennen dauert über zwei Tage und erreicht normalerweise Einschaltquoten von fast 30 Prozent im japanischen Fernsehen. Die Quoten sind ähnlich denen des Super Bowl in den USA und höher als die eines FA-Cupfinales in Großbritannien. Dazu kommt, dass dieses Event am 2. und 3. Jänner stattfindet, zur Hauptsendezeit, wenn die Menschen nach den Neujahrsfeiern noch frei haben.
Zusätzlich zu den Zusehern vor den Bildschirmen sind die Straßen entlang der 217,9 Kilometer langen Strecke mit unzähligen Zuschauern gesäumt. Es ist wirklich episch.
Schon Monate vor dem Rennen erhalten wir Werbung in unserem Briefkasten in Kyotanabe, die zum Kauf von Hakone-Merchandise anregen soll: Handtücher, Jacken, Baseballkappen. Sapporo bringt für diesen Anlass sogar ein Bier auf den Markt.
Der Hakone Ekiden reicht weit über die Grenzen des Laufsports hinaus und spricht auch Leute an, die sich normalerweise nicht fürs Laufen interessieren. Es ist eine landesweite Veranstaltung. Wahrscheinlich ist es sogar der meistgesehene Laufwettbewerb der Welt. Doch so wie ein schwarzes Loch alles, was ihm zu nahe kommt, verschlingt, so bringt auch die ungeheure Popularität des Hakone Ekiden einiges an Problemen für den japanischen Laufsport mit sich.
So sind zum Hakone ausschließlich männliche Universitätsmannschaften aus Japans Kanto-Region, der Gegend rund um Tokio, zugelassen. Im Grunde genommen ist es also ein lokaler Laufwettbewerb zwischen Universitäten. Und da wären wir schon einmal beim ersten Problem, nämlich, dass dieser Wettbewerb alle anderen Universitäten des Landes, auch Kenjis Ritsumeikan in Kyoto, die sich in der Region Kansai befindet, von vornherein ausschließt.
Natürlich wollen die besten Läufer in den Schulen den Hakone laufen. Das bedeutet, dass ein Coach wie Kenji, der nach Läufern für seine Nicht-Hakone-Universität sucht, sich mit den Burschen begnügen muss, die von den Hakone-Teams übriggelassen wurden, nachdem sie sich die größten Talente einverleibt haben. Natürlich gibt es auch immer wieder Spätzünder oder Läufer, die sich in der Schule verletzt oder dort das Training nicht ernst genug genommen haben und ihr Talent erst später entwickeln, doch im Großen und Ganzen werden die Topläufer aus den Sekundarschulen auch zu den Topläufern an den Universitäten.
Das Ergebnis ist ein unüberwindbares Zweiklassensystem: Unis aus der Region Kanto und diejenigen, die sich nicht in der Region Kanto befinden.
Was Universitäten in Kanto alles tun, um den Hakone zu gewinnen, kann man anhand eines Gebäudes sehen, das für das Gewinnerteam von 2012, die Toyo-Universität, errichtet wurde und knapp vor meiner Ankunft in Japan eingeweiht wurde. Die Universität hat ihrem Ekiden-Team ein eigenes, hypermodernes Hauptquartier gebaut, mit Fitnessraum, Whirlpool, Eisbad, Speisesaal und genügend Schlafräumen für 100 Personen. Das Gebäude befindet sich neben der Laufbahn der Universität, wobei die Schlafräume allerdings alle in Richtung eines nahe gelegenen Parks blicken.
„Wenn du die ganze Zeit nur die Laufbahn siehst, kannst du nicht richtig abschalten“, erklärte der Toyo-Cheftrainer, der eine Schlüsselrolle bei der Planung dieses Gebäudes gespielt hat.
Interessanterweise hat der Hakone genau den gegenteiligen Effekt, wenn es um den Ekiden bei den Damen geht. Während die Universitäten der Region Kanto alles in ihre Herrenteams stecken, in der Hoffnung, beim Hakone zu glänzen, vernachlässigen sie ihre Damenteams. Und da die Universitäten im Rest des Landes keinen Hakone haben, stecken sie mehr Zeit und Geld in ihre Damenmannschaften, was darin resultiert, dass die besten Ekiden-Teams bei den Damen von Universitäten stammen, die nicht am Hakone teilnehmen. Das beste von allen ist das Damenteam der Ritsumeikan, die Landesmeister von 2012, die mit sieben Meistertiteln auch den Rekord halten.
Bei meiner ersten Fahrt zum Campus der Ritsumeikan-Universität sitze ich auf der Rückbank von Kenjis Wagen. Er holt mich und Max vom Bahnhof ab. Am Beifahrersitz sitzt eine Schülerin aus der Realschule.
„Osaka, Nummer zwei“, sagt er stolz.
Anscheinend ist sie die zweitschnellste 3000-Meter-Läuferin ihrer Altersklasse im nahe gelegenen Osaka. Kenji hat sie unter seine Fittiche genommen und setzt große Hoffnungen in sie.
„Olympische Spiele in Tokio“, sagt er, und seine Augen leuchten dabei vor Freude.
Das Mädchen lächelt nur höflich.
Als wir das Tor zum Universitätscampus passieren, läuft das Damenteam gerade in einer großen Gruppe auf der Bahn. Sie laufen alle in diesem typischen Stil, den alle japanischen Läuferinnen haben. Dieser Stil mag zwar effektiv sein, doch er sieht sehr unspektakulär aus. Aus der Ferne betrachtet, könnte das auch eine Gruppe von Joggerinnen sein, und nicht eine der stärksten Damenlaufstaffeln der Welt.
Leider hat die Trainerin des Damenteams ihren Athletinnen verboten, mit Kenji oder irgendjemand anderem aus dem Männerteam zu sprechen. Sie will nicht, dass ihre Mädchen abgelenkt werden oder vom Weg abkommen. Einmal, einige Monate später, stoßen wir auf zwei der Läuferinnen in der Ritsumeikan-Kantine. Sie sind freundlich, blicken sich aber immer wieder um, ob sie vielleicht beobachtet werden. Schließlich haben sie zu viel Angst davor, dabei gesehen zu werden, wie sie mit uns reden, und verlassen uns.
Kenji lacht, als ich ihn frage, ob es mir erlaubt wäre, eine der Läuferinnen zu interviewen.
„Nein, nein“, winkt er ab und schüttelt den Kopf.
Er parkt sein Auto neben den Publikumsbänken aus Beton am Rande der Laufbahn, wo sich das Herrenteam versammelt hat und sich angeregt unterhält, während sie auf ausgebreiteten Gummimatten Dehnungsübungen machen.
„Os“, murmeln sie, als wir uns nähern.
Kenji trägt mehrere Schnellhefter und Clipboards, macht einen Witz und kichert in sich hinein. Einige der Läufer lächeln gequält, doch die meisten fahren mit ihren Dehnungsübungen fort.
Ich bin nicht sicher, ob sie mich erwartet haben. Max sagte mir, dass Kenji kein Problem damit hätte, wenn ich mich mit seinem Team unterhalten und vielleicht sogar mit ihm laufen wolle, also bin ich in meinem Trainingsoutfit gekommen. Auch Max ist bereit, mitzulaufen.
„Lass uns sehen, was passiert“, meint er.
Nachdem Kenji alle begrüßt hat, stellt er uns seinem Teamkapitän, Daichi Hosoda, vor. Daichi hat lange Haare, die er offen trägt, und ein breites, jugendliches Lächeln. Er gibt uns die Hand, verbeugt sich höflich und heißt uns beim Training willkommen. Insgesamt besteht das Ekiden-Team aus ungefähr 30 Läufern. Kenji erklärt, dass das heutige Abendtraining aus einem 15-Kilometer-Zeitlauf in der Gruppe besteht. Er fragt, ob wir mitmachen wollen.
„Ju Kilo“, schlägt er vor, ein entschärftes Training für Max und mich. Zehn Kilometer. „Okay?“
Es ist ein Tempo von etwa vier Minuten pro Kilometer geplant, deutlich schneller als das der Amateurgruppe. Allerdings nicht so schnell, dass ich nicht über zehn Kilometer mithalten könnte. Nach unserer einmonatigen Reise nach Japan habe ich bereits zwei Wochen Lauftraining intus, und ich fühle, wie meine Fitness langsam wiederkehrt. Die Strecke ist ein 1,25 Kilometer langer Straßenabschnitt, den wir auf und ab laufen. Somit kommen wir immer nach 2,5 Kilometern am Start vorbei, was uns genügend Möglichkeiten gibt, auszusteigen, wenn es uns zu viel wird. Es ist ein ziemlich heißer Abend, doch die Luftfeuchtigkeit ist im Gegensatz zu den vorherigen Wochen etwas niedriger.
Bevor es losgeht, bilden wir zusammen einen großen Kreis, und Kenji stellt Max und mich offiziell vor. Er erklärt seinen Schützlingen, dass sie sich nicht scheuen sollen, mit uns zu reden. Einer aus dem Team fragt uns sofort nach unserem Alter. Max sagt, dass ich 39 Jahre alt sei und er 35. Der Mann, der die Frage gestellt hat, sagt etwas darauf, worauf Max etwas erwidert, und alle zu lachen beginnen.
„Was hat er gesagt?“, frage ich Max.
„Er hat gesagt, ich sehe viel jünger aus“, antwortet Max lachend.
Ich bekomme keine Komplimente, und so gehen wir hinüber zum Start, wo wir uns schnell aufstellen und alle ihre Uhren einstellen. Und nach noch einmal Durchzählen und ein paar aufmunternden Worten geht es los. Ich suche mir einen Platz in der Mitte der Gruppe. Vorne an der Spitze läuft der Kapitän des Teams. Es ist schon eine Weile her, dass ich mit höherem Tempo in einer Gruppe gelaufen bin, und es fühlt sich gut an, zurück in einem Rudel mit anderen zu sein und das rhythmische Geräusch unserer Schritte auf dem Asphalt zu hören. Alle laufen ohne Anstrengung, doch keiner spricht auch nur ein Wort. Die Herausforderung kommt erst. Jetzt heißt es erst einmal abwarten und sich in Geduld üben.
Die Straße schlängelt sich um die Rückseite der Universität, vorbei an Tennisplätzen und ein paar größeren Parkplätzen. Dann erreichen wir einen am Boden markierten Punkt, drehen um und laufen wieder zurück.
Max kommt uns entgegen. Er musste abreißen lassen, doch er gibt noch immer alles. In seinem Gesicht sieht man förmlich die Anstrengung, und er ignoriert uns, als wir vorüberlaufen. Als wir wieder am Start ankommen und auf die zweite Runde gehen, ruft uns ein Team an Betreuern und Trainern unsere Zeiten zu. Einer von ihnen, der Teamtrainer, macht Fotos mit einem iPad.
Und so geht es auf die zweite Runde. Erst jetzt registriere ich, dass es beim Hinlaufen leicht bergauf geht. Inzwischen macht sich die schwüle Nacht, die sich immer mehr über mich legt und mir die Energie aus den Beinen saugt, immer mehr bemerkbar. Ich merke, wie ich langsam ans Ende des Feldes zurückfalle. Bergab, am Rückweg zum Start, bemühe ich mich, an der Gruppe dranzubleiben, doch ich spüre, wie ich mich anstrengen muss.
Als wir auf die dritte Runde gehen, falle ich zusammen mit einem anderen Läufer zurück. Ich blicke zu ihm hinüber. Er sieht mich an. Sein Kopf ist leicht zur Seite geneigt, und er sieht nervös aus.
Mein Vorteil ist, dass ich jederzeit stehen bleiben kann. Die anderen warten nur darauf, bis es so weit ist. Ich bin kein Läufer. Ich bin ein Autor. Ich mache das hier nur zum Spaß. Dieser Gedanke ist in solchen Momenten, wenn es hart auf hart geht und meine Beine darauf drängen, langsamer zu werden, immer ein Trost. Andererseits schwingt aber auch eine gewisse Enttäuschung mit. In meiner eigenen Vorstellung bin ich ein Läufer. Allerdings nur so lange, bis ich es mit richtigen Läufern zu tun bekomme. Diese Erfahrung kann dann ziemlich demotivierend sein.
Doch der Bursche neben mir läuft um seine Zukunft, um seinen Platz im Team. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass er seinen Platz an dieser Uni aufgrund seiner läuferischen Leistung in der Schule bekommen hat. Vielleicht hofft er sogar, Profi zu werden. Vor dem Training hat mir einer der anderen Studenten erzählt, dass die meisten hier im Team hoffen, nach der Uni einmal Profi zu werden. Das ist der Weg, den sie verfolgen. Doch nicht alle würden es auch schaffen.
Mein nervöser Begleiter und ich absolvieren zusammen die dritte Runde, bevor ich erschöpft aufgebe. Er läuft tapfer weiter und macht sich auf die vierte Runde. Als sich das Tempo erhöht, beginnen nun auch andere Läufer am Ende der Gruppe zurückzufallen. Noch immer führt der Teamkapitän das Feld an.
Ich blicke auf meine Uhr. Ich bin 7,5 Kilometer in 30 Minuten gelaufen. Ich schwöre mir, dass ich das nächste Mal zehn Kilometer durchhalten werde.
Während wir auf die Läufer warten, fragt mich Kenji, ob die Kenianer auch im Gänsemarsch laufen.
„Nicht wirklich“, erkläre ich ihm.
Anstatt auf einem kurzen Straßenabschnitt auf und ab zu laufen, laufen die Kenianer kilometerlang auf staubigen, unbefestigten Wegen. Sie laufen eigentlich so gut wie nie auf Asphalt, wenn sie es vermeiden können.
Kenji sagt, es sei für Ekiden-Läufer wichtig, auf der Straße zu trainieren, da es deine Beine an Straßenrennen gewöhne. Als ich darauf hinweise, dass sich die Kenianer auch ohne Asphalttraining ziemlich gut auf der Straße schlagen,3 meint er, dass sie noch viel besser wären, wenn sie auf Asphalt trainierten.
Es ist ein Thema, auf das Kenji und ich wieder zu sprechen kommen werden, doch für den Augenblick nicke ich nur und gebe ihm damit zu verstehen, dass ich seiner Logik folgen kann, auch wenn ich nicht ganz damit einverstanden bin.
Bevor wir Kenji an diesem Abend verlassen, sagt er uns, dass sie nächste Woche auf ein einwöchiges Trainingslager in den Bergen fahren und wir herzlich willkommen seien, uns ihnen anzuschließen. Ich akzeptiere diese Einladung sofort. Es scheint, als hätte ich doch noch ein richtiges Ekiden-Team gefunden, dem ich beitreten kann.
Während der Hakone der Höhepunkt der universitären Ekiden-Saison der Männer ist, gibt es im Vorfeld noch zwei andere bedeutende Bewerbe. Den Izumo Ekiden und den landesweiten All-Japan National Ekiden. An diesen Wettkämpfen nehmen Teams aus allen Teilen des Landes teil, ganz im Gegensatz zum Hakone, der nur auf Teams aus der Region Kanto beschränkt ist. Für die Mannschaften aus dem restlichen Japan bedeutet das, dass sie zwei Gelegenheiten haben, sich selbst ins Rampenlicht zu stellen, wenn sie gegen die viel prestigeträchtigeren Hakone-Teams antreten und versuchen, sie zu besiegen.
Kenjis Job ist es also, das Herrenteam der Ritsumeikan so gut wie möglich auf diese beiden Rennen vorzubereiten und zu zeigen, dass es auch ein Leben abseits des Hakone gibt. Um sein Team für diese Aufgabe in Form zu bringen, fährt er mit seinen Leuten für ein einwöchiges Trainingscamp in die Berge. Max und ich sind mit von der Partie und stoßen am dritten Tag nach einer sechsstündigen Fahrt über kurvige Autobahnen von Kyoto nach Nigata zu ihnen. Hier oben ist die Luft nicht mehr so feucht. Wir befinden uns nun auf etwa 900 Höhenmetern, nicht besonders hoch, doch genug, damit die Lungen etwas mehr arbeiten müssen.
Wir kommen am Nachmittag an und gesellen uns zu den anderen auf der Laufbahn. Es gibt auch einige andere Teams, die hier trainieren. Die Laufbahn hat nur drei Bahnen, und weit und breit ist nichts von Wurfkäfigen oder Sandkästen für den Weitsprung zu sehen – das Ganze ist einzig und allein für die Langstreckenläufer da. In den Sommermonaten wird das gesamte Areal für Ekiden-Teams hergerichtet, mit Laufbahnen und Trails, so weit das Auge reicht. Da es im Winter sehr viel schneit und die Gegend oft unter einer dicken Schneedecke begraben ist, leben nur sehr wenige Menschen hier. Alles erscheint ziemlich verlassen, abgesehen von den Läufern. Es ist ein Paradies für Laufsportler.
Das Ritsumeikan-Team hat bereits einen Morgenlauf hinter sich und ist nun beim „freien Laufen“. Das heißt, dass jeder Läufer sein eigenes Tempo, seine eigene Route und Distanz wählen darf. Kenji weist den Teamkapitän an, uns auf einen Lauf mitzunehmen.
Obwohl sich die Berge hier über viele Kilometer erstrecken, laufen wir einen markierten kurzen, zickzackförmigen Pfad im Wald neben der Laufbahn entlang. Mit den vielen Kurven ist er etwa 800 Meter lang, und so drehen wir eine Runde nach der anderen, bis der Kapitän entscheidet, dass es reicht. Die anderen Läufer tun es ihm gleich. Wie Züge einer kleinen Modelleisenbahn, die vor- und zurückfahren.
Ich frage den Teamkapitän, ob er auch professioneller Ekiden-Läufer werden will, wenn er mit der Uni fertig ist. Soweit ich es beurteilen kann, ist eine Karriere im Laufsport eine der Triebfedern für das viele Training. Im Vereinigten Königreich sind die Aussichten, Profiläufer zu werden, so gering, dass die meisten Leute den Gedanken daran aufgeben, wenn sie auf die Uni gehen. Wenn du nicht gerade Mo Farah heißt, dann bedeutet eine Karriere als professioneller Langstreckenläufer, dass du, wenn du Glück hast, ein wenig Sponsorengeld einer Lotteriegesellschaft und ein paar Ausrüstungsgegenstände von einem Sponsor zur Verfügung gestellt bekommst, sowie den Hungerlohn, den du als Preis- und Antrittsgeld bei Rennen erhältst. Da aber die Kenianer und Äthiopier fast alle Straßenrennen auf der Welt gewinnen, bleiben für die meisten britischen Läufer gerade einmal ein paar Hundert Pfund übrig – und das nur hin und wieder. In Japan können sogar die langsamsten Profis zumindest so viel wie ein Büroangestellter verdienen, während der finanzielle Anreiz für die Topathleten noch viel größer ist.
Als der Kapitän dann meint, dass er nicht Profi werden will, kommt das überraschend für mich. Er will Feuerwehrmann werden. Er erzählt, dass sein Vater auch Feuerwehrmann sei. Doch als Teamkapitän muss er sicherlich der beste Läufer sein. Warum will er also nicht Profi werden?
Er lächelt schüchtern, fast so, als ob ihm die Frage unangenehm sei. Es stellt sich heraus, dass er nicht einer der besten Läufer ist. Er ist vor allem deswegen Kapitän, weil er der Älteste im Team und ein guter und recht beliebter Student mit guten sozialen Kompetenzen ist. Der Typ, der auch mit Fragen eines ausländischen Journalisten umgehen kann. „Die Karriere eines Ekiden-Läufers ist kurz“, sagt er. „Wenn deine Zeit vorbei ist, stecken sie dich hinter einen Schreibtisch. Und das auch nur, wenn es ein gutes Unternehmen ist. Andere Firmen entlassen dich einfach.“
Ich muss zugeben, dass sich das nicht mehr so toll anhört, wenn man es aus diesem Blickwinkel betrachtet. Als wir an der Bahn vorbei zurücklaufen, dreht dort eine Gruppe von drei Profiläuferinnen mit hohem Tempo ihre Runden. An ihren Gesichtern kann man ablesen, wie sie leiden, jede Einzelne scheint am Rande eines Zusammenbruchs zu stehen.
Wir laufen an ihnen vorbei und dann wieder zurück in den Wald.
„Wirst du für die Feuerwehr Ekiden laufen?“, frage ich unseren Kapitän.
„Ja“, antwortet er.
Ich frage ihn, warum er läuft. Was ihn dazu antreibt, weiter zu trainieren, ein Teil des Teams zu sein? Er sieht mich verdutzt an und läuft dann ohne etwas zu sagen weiter. Auf dem Waldweg sind unsere Schritte kaum zu hören. Nach etwa einer Minute blickt er zu Max hinüber, so als hoffe er, dass sich die Frage in Luft aufgelöst hat.
„Eigentlich laufe ich gar nicht so gern“, sagt er.
Dann zuckt ein kurzes Lächeln über sein Gesicht. Vielleicht ist er erleichtert, es endlich einmal ausgesprochen zu haben.
„In der Schule habe ich sehr viel Sport betrieben, doch im Laufen war ich eben besser als in den anderen Sportarten. Die Leute haben mich unterstützt und angespornt.“
Einige Monate später bekommt er seinen Job als Feuerwehrmann. Ich freue mich für ihn. Vielleicht kann er nun endlich mit dem Laufen aufhören. Oder er macht gegen seinen Willen weiter, nur um andere zufriedenzustellen.
Nach dem Training gehen wir in die Teamunterkunft. Das Haus gehört einem älteren Ehepaar und ist ein spitz zulaufendes Holzgebäude mit zwei schlafsaalähnlichen Zimmern mit Stockbetten für die Sportler. Im Waschraum wird es eng, und so sitzen wir zu dritt oder zu viert in der großen verfliesten Badewanne, voll mit dampfend heißem Wasser. Nun, da das Training vorbei ist, unterhalten sich alle entspannt und lachen.
Nachdem wir sauber sind, versammeln wir uns im neonbeleuchteten Esszimmer. Lange Tische mit grünen, geblümten Tischtüchern, auf denen sich das Essen stapelt. Da sind Schüsseln mit Suppe und in Streifen geschnittenem, rohem Gemüse. In der Mitte eines jeden Tisches stehen kleine Wärmeplatten mit Töpfen, in denen sich eine Suppe mit Fisch und Seetang befindet. Max und ich kommen als Letzte. Zwei Plätze gegenüber von Kenji sind für uns reserviert, die Essstäbchen liegen bereits ordentlich auf ihren Haltern am Tisch.
Ich bin zwar Vegetarier, doch ich denke, dass ich mich diesmal etwas anpassen muss. Die Töpfe sind voll mit Gemüse, Nudeln und Fisch. Ich versuche, die Fischstücke so gut wie möglich zu vermeiden, und fülle meine Schale mit dem Rest. Zusätzlich gibt es noch genügend Reis, an dem man sich sattessen kann. Und Misosuppe. Und Natto – eine streng riechende Beilage aus fermentierten Sojabohnen. Das erste Mal, als ich Natto kostete, war vor zwölf Jahren, als ich meinen Bruder besuchte und er den Ekiden für seine Schule am Tag nach dem Nacktfest lief. Ich konnte es damals nicht ausstehen, und die Japaner machen sich einen Spaß daraus, es unbedarften Fremden vorzusetzen und es sie probieren zu lassen. Abgesehen davon, dass es nach nassen, stinkenden Stiefeln riecht, ist es auch noch mit einem ekeligen Schleim bedeckt. Doch heute probiere ich es zum zweiten Mal, und irgendwie schmeckt es gar nicht einmal schlecht.
„Natto strotzt nur so von gesunden Bakterien“, meint Max. Genauso wie Miso.
„Die japanische Küche kennt viele fermentierte Gerichte, so wie diese hier“, erklärt Max. „Sie fördern die Produktion guter Mikroorganismen in deiner Darmflora, die wiederum deine Verdauung anregen, was wichtig für die Gesundheit und das generelle Wohlbefinden ist. Speziell für Sportler ist das gut, denn sie können dadurch mehr Energie aufnehmen.“
Alle Sportler, die ich in Japan treffe, folgen einer ziemlich traditionellen japanischen Ernährungsweise aus Reis, Misosuppe, Natto, Seetang, Fisch, Buchweizennudeln, Tofu und Gemüse als Basisnahrungsmittel ihres täglichen Essens. Jeden Tag essen sie eine Kombination daraus zum Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Das ist eine unglaublich gesunde Ernährung, die auch dazu beiträgt, dass Japan eines der gesündesten Länder der Erde ist. Das Land hat nicht nur die höchste Lebenserwartung, wie ja weithin bekannt ist, sondern in einer 2013 von der UNO erstellten Liste der übergewichtigsten Staaten der Ersten Welt hatte Japan mit einem Anteil von nur 4,5 Prozent von übergewichtigen Menschen in der erwachsenen Bevölkerung den niedrigsten Wert. Im Vergleich dazu belegte Großbritannien mit 24,9 Prozent an übergewichtigen Erwachsenen Platz 23.4
Eine weitere großangelegte Studie der American Heart Association im Jahr 2013 fand heraus, dass Kinder in den entwickelten Ländern heute im Schnitt etwa 90 Sekunden länger brauchen, um eine Meile zu laufen, als noch vor 30 Jahren. Ein gewisser Verlust an Fitness wurde in allen Staaten der Ersten Welt festgestellt, bis auf einen: Japan, wo die Kinder und Jugendlichen heute schneller laufen als noch ihre Eltern. Obwohl dies natürlich auch teilweise auf die Bedeutung des Sports an den Schulen zurückzuführen ist, so kann man davon ausgehen, dass eine gesunde Ernährung bei solch niedrigen Zahlen ebenfalls eine Rolle spielt.
Natürlich existieren in Japan auch industriell hergestellte Frühstückszerealien, Sandwiches, Burger, Pizzas und anderes ungesundes Essen, doch sind sie nicht so allgegenwärtig wie in der westlichen Welt, und sie bilden keinesfalls die Basis der Ernährung der Menschen.
Weizen, eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel in Europa und Amerika, das über die letzten Jahre als ungesunde, problematische Nahrungsressource in Kritik geraten ist, wird in Japan weitaus seltener gegessen. Wenn man in Japan im Supermarkt einen Laib Brot kaufen will, bekommt man nur drei Scheiben abgepacktes Brot. Für meine Kinder, die gerne Toast zum Frühstück essen, bedeutet das, dass wir fast immer das ganze Regal leerräumen, wenn wir einkaufen gehen.
Zudem sind die Portionen in Japan generell kleiner als in der westlichen Welt. Einmal bemerke ich in einem Restaurant, dass man Pommes frites als Beilage zu einem Gericht bestellen kann. Da kann ich nicht widerstehen. Als ich dann mein Essen bekomme, liegen da genau drei Pommes in einer winzigen Schüssel.
Es gibt zahlreiche Studien, die die Auswirkung der Portionsgröße auf unsere Essgewohnheiten untersucht haben, und alle kamen zu dem wenig überraschenden Ergebnis: Wenn man einer Person eine größere Portion von etwas anbietet, isst diese Person auch mehr. In einer Studie wurde sogar 14 Tage altes, schales Popcorn verwendet. Diejenigen, die eine größere Portion bekamen, aßen auch mehr davon, selbst wenn sie danach zugaben, dass es scheußlich schmeckte. Kleinere Portionen und weniger Kalorien sind zurzeit Modebegriffe im Gesundheitsbewusstsein der westlichen Welt. Doch genau diese Dinge werden in Japan schon seit langem praktiziert. Die gängige japanische Phrase „Hara hachi bu“ bedeutete so viel wie „Iss, bis du zu 80 Prozent satt bist“.
Außerdem verhindert das Essen mit Essstäbchen, dass man sich über-isst, denn man ist gezwungen, langsamer zu essen, was wiederum bedeutet, dass man sich schneller satt fühlt. Inzwischen bin ich es gewohnt, mit Stäbchen zu essen, und wann auch immer ich die Gelegenheit habe, mit einer Gabel zu essen, kommt es mir so vor, als würde ich das Essen wie ein gieriges Monster in mich hineinstopfen.
Raffinierter Zucker, eines der schlechtesten Nahrungsmittel, die man essen kann, und das unserem Körper seine Energie entzieht und laut Robert Lustig, dem bekannten Kinderarzt und Professor für Neuroendokrinologie, besser als Gift eingestuft werden sollte, wird in Japan auch weit weniger verwendet. So ist es in Japan nicht so wie in unseren Breitengraden üblich, eine Mahlzeit mit einem süßen Dessert zu beenden. Im Ritsumeikan-Trainingscamp steht überhaupt kein Zucker auf dem Speisplan.
Aber lassen wir die Kirche einmal Dorf. Auch Japan ist nicht perfekt, und es gibt genügend Läden, die Unmengen an farbenfrohem und grell verpacktem Junkfood verkaufen. Doch selbst dort sind Schokoriegel und Tüten mit Süßigkeiten kleiner als in anderen Ländern. Dazu kommt, dass salzige Snacks nicht aus Chips oder Wurstsemmeln bestehen, sondern aus Reisbällchen, die mit fermentierten Pflaumen oder Fisch gefüllt und in Seetang oder Tofu eingewickelt sind.
Ich habe einmal den angesehenen Ernährungswissenschaftler Tim Noakes dazu befragt, was er von der japanischen Kost hält und ob diese Ernährungsweise der Verbesserung der sportlichen Leistung dienen könnte. Seine Antwort war, dass sich diese Ernährung „großartig“ anhört.
Dr. Kevin Currell, der Leiter der Abteilung für Performance Nutrition am English Institute of Sport, stimmt dem zu: „Es ist eine exzellente Kombination aus Nahrungsmitteln für jeden Athleten. Die richtige Mixtur aus Kohlenhydraten, Proteinen und Gemüse – und am wichtigsten ist, dass das Essen von guter Qualität und frisch zubereitet ist, denke ich. Das ist die Ernährungsweise, die wir unseren Athleten empfehlen würden.“
Nach meinen sechs Monaten in Japan, in denen ich mich größtenteils von der traditionellen japanischen Küche ernährte – außer zum Frühstück, wenn ich Toast und Porridge aß, weil mein Gaumen am Morgen so sehr an Süßes gewöhnt ist –, wog ich weniger als jemals zuvor in meinem Erwachsenenleben (67 Kilo – als wir von England losfuhren, hatte ich 73 Kilo). Obwohl ich einen großen Teil dieser sechs Monate mit Laufen verbrachte, trainierte ich aber nicht härter als in den letzten beiden Jahren zuvor in England. Selbst als ich für den London Marathon trainierte und wirklich viel lief, wog ich nie unter 71 Kilo.
Nach dem Abendessen ziehen sich die Athleten auf ihre Zimmer zurück. Max und ich haben ein Zimmer, das wir uns teilen. Es ist im typisch japanischen Stil gehalten und besteht aus einem Boden mit Tatamimatten und einem Schrank mit Bettzeug. Für Max und mich ist es noch zu früh, schlafen zu gehen, und so erkunden wir in unseren Hausschuhen ein wenig das Haus.
Unten wurde ein Behandlungsraum eingerichtet. Die Tür steht offen, und ich stecke meinen Kopf hinein. Auf dem Tisch wird gerade einer der Läufer von einem Trainer massiert. Eine Assistentin, eine Studentin, massiert einen anderen Läufer, der am Boden liegt. Ein gedrungener Student mit Brille untersucht derweilen sein Knie mit einem Ultraschallgerät, während der Rest derer, die sich in dem Raum befinden, rundherum am Boden sitzen und sich unterhalten. Kenji sitzt auch am Boden. Sein Laptop steht geöffnet vor ihm, und er gibt die gestoppten Zeiten von heute in eine Tabelle ein.
„Komm rein“, sagen sie und machen ein wenig Platz. Meine Anwesenheit sorgt für ein kurzes Schweigen im Raum. Ich kann förmlich sehen, wie der eine oder andere versucht, sich einige Worte auf Englisch zu überlegen.
„Itai?“, frage ich den Läufer mit dem Ultraschallgerät. Tut es weh?
Alle beginnen zu lachen. Ich bin unsicher, ob dies an meinem Versuch, Japanisch zu sprechen, liegt, oder an der Idee, dass das Gerät Schmerzen bereiten könnte. Vielleicht liegt es auch nur an der generellen Verlegenheit.
Glücklicherweise erscheint kurz darauf Max. Alle sind erleichtert, da dies die Kommunikation deutlich erleichtert, und es wird wieder gelacht und geblödelt. Es herrscht ein reges Kommen und Gehen. Man entspannt zusammen und genießt das Beieinandersein.
Die Späßchen, die entspannte Atmosphäre sind Teil des Mannschaftsgeistes, den Kenji zu fördern versucht. Andere Coaches seien viel ernster, sagt er, viel strikter. Ich frage ihn, ob er in seiner aktiven Zeit gerne an diesen Laufcamps teilnahm. Da weiten sich seine Augen.
„Nein“, sagt er und schüttelt dabei den Kopf. „Es war immer sehr, sehr ernst. Kein Spaß.“
Dann sagt er etwas zu Max. Er will, dass wir uns ein Video auf seinem Computer ansehen. Wir setzen uns um seinen Laptop, und er zeigt uns eine alte, verschwommene Aufnahme eines Bahnrennens. Es ist das 10.000-Meter-Finale bei den Asienspielen von 1998. Man sieht einen jungen Japaner mit einer Halskette am Start stehen. In seinem Gesicht ist die Anspannung bemerkbar, als er seine Backen aufbläst. Es ist Kenji.
Ungeduldig spult er die erste Hälfte des Rennens vor, in der sich eine Gruppe von sechs Läufern, einschließlich Kenji, vom Rest des Feldes absetzt.
„Okay“, sagt er und lehnt sich etwas zurück, als die Läufer auf dem Bildschirm die Hälfte des Rennens hinter sich haben. Bei der 5000-Meter-Marke setzt sich Kenji an die Spitze der Gruppe und verschärft das Tempo, dabei bewegen sich seine Schultern im Takt vor und zurück. Aber das Rennen dauert noch lange.
Wir drängen uns um den Laptop. Wir sehen, wie Kenji das Tempo weiter erhöht, bis ihm nur mehr ein Läufer folgen kann. Es ist ein hochgewachsener Läufer aus Katar.
„Rivale“, sagt Kenji und deutet auf den Mann.
Während man dem jungen Kenji die Anstrengung und Nervosität ansieht und sich seine Arme wie die Kolben eines Motors auf und ab bewegen, sieht der Läufer aus Katar selbstsicher und entspannt aus und wartet geduldig auf den richtigen Moment. Ein Szenario, das wir schon unzählige Male gesehen haben. Fast immer gewinnt der Läufer, der an zweiter Stelle liegt.
Mit noch einer Runde zu laufen, liegt der Mann aus Katar nun gleichauf mit Kenji, der allerdings noch einmal das Tempo steigert. Nach der letzten Kurve starten beide ihren Endspurt. Sie fliegen nur so dahin, der Katarer neben Kenji. Doch Kenji lässt ihn nicht vorbei. Es sieht fast so aus, als wäre da eine unsichtbare Hand, die Kenji ausstreckt, um seinen Konkurrenten zurückzuhalten. Beide sind am Ende ihrer Kräfte, als sie die Zielgerade Seite an Seite und vorbei an überrundeten Läufern entlangsprinten. Noch immer sieht es so aus, als würde der Katarer jede Sekunde vorbeigehen. Doch Kenji findet noch ein letztes Mal die Kraft für einen kurzen Antritt und überquert mit erhobenen Armen als Erster die Ziellinie. Die japanischen Kommentatoren applaudieren nur. Sie sprechen kein Wort. Es war ein unglaubliches Rennen.
Es scheint, als ob die anderen Anwesenden das Video bereits kennen, denn sie sagen eigentlich kaum etwas dazu und wenden sich wieder anderen Dingen zu.
„Großartiges Rennen“, sage ich zu Kenji. „Ich dachte wirklich, dass er dich am Ende noch überholt.“
„Ich habe wegen dem Ekiden-Training gewonnen“, sagt er. „Beim Ekiden lässt du niemanden an dir vorbei.“
3 In jenem Jahr, 2013, kamen 13 der Top 20 Marathonläufer der Welt aus Kenia. Die anderen sieben waren Äthiopier, die ebenfalls weicheren Boden im Training bevorzugen.
4 Die dickste Nation der Welt war Mexiko mit 32,8 Prozent an Übergewichtigen, gefolgt von den USA mit 31,8 Prozent.