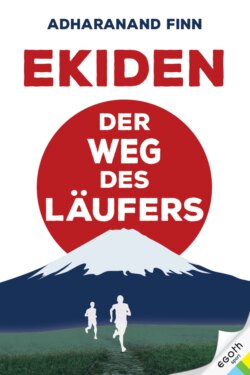Читать книгу Ekiden - Adharanand Finn - Страница 7
2
ОглавлениеDer Gorki-Park in Moskau ist eine Promenade für herumstolzierende Männer und Frauen. Wir warten in einer Menschenschlange vor einem Fahrradverleih. Die starke Augustsonne röstet langsam meinen Nacken. Ich habe vergessen, Sonnencreme aufzutragen, und habe auch keine Kopfbedeckung dabei. Trotzdem will ich meinen Platz in der Schlange nicht aufgeben, immerhin stehe ich hier schon seit gut 40 Minuten. Meine Kinder hängen an meinen Beinen.
Auf der anderen Seite der Moskwa finden die Weltmeisterschaften im Marathonlauf statt. Ich möchte zusehen, doch ich habe meinen Kindern versprochen, dass ich ihnen erst Fahrräder miete. Endlich sind wir an der Reihe. Ein Schild in englischer Sprache weist darauf hin, dass Ausländer ihren Pass vorweisen müssen, und so lege ich dem Mann an der Kasse unsere Pässe vor. Ohne mich auch nur anzublicken, schüttelt er seinen Kopf und wendet sich den Wartenden hinter mir zu.
„Pässe“, sage ich. Vielleicht hat er sie ja nicht gesehen. Ich halte sie vor seine Nase, so, dass er sie sehen muss.
„Keine Ausländer“, sagt der Mann und bedient einen Kunden hinter uns.
Ich spüre eine gewisse, beinahe aggressive Frustration in mir aufsteigen. Keine Ausländer? Überall stehen diese Schilder, auf denen in Englisch geschrieben steht: „Willkommen beim Gorki-Park Fahrradverleih“ etc., etc. Wer stellt diese Schilder denn auf? Ich stehe hier schon seit einer Stunde mit drei kleinen Kindern bei brütender Hitze in der Schlange. Und ich verpasse den Marathon.
„Neue Regeln“, sagt er und blickt mich mit zugekniffenen Augen an, als wäre er überrascht darüber, dass ich noch immer hier bin.
Also gehen wir, enttäuscht und fluchend.
„Was ist denn los?“, fragen mich meine Kinder, verwirrt darüber, dass wir ohne Fahrräder abziehen. „Warum bekommen wir keine Fahrräder?“
Ich überlasse die Kinder meiner Frau Marietta, die ihnen ein Eis kauft, während ich mir meinen Weg durch die Massen in Richtung Marathon bahne. Wenn ich mich beeile, sehe ich die Führenden wenigstens noch kurz, wenn sie zum letzten Mal an dieser Stelle vorbeilaufen. Um auf die andere Seite des Flusses zu gelangen, muss ich über eine Fußgängerbrücke. Ich laufe die Stiegen hinauf. Meine Kamera baumelt an meinem Hals, und mein Hemd ist durchgeschwitzt. Es hat 27 Grad. Ich weiß nicht, wie die es schaffen, einen Marathon bei diesen Temperaturen zu laufen.
Die Brücke ist voller Menschen, die in Richtung Park wollen. Überall sehe ich lange, nackte Beine. Unten am Flussufer liegt eine Frau oben ohne vor einer Bar und sonnt sich. Die Luft ist mit einer fast schon bedrohlich wirkenden Mixtur aus Reichtum und Anarchie schwanger. Hier trifft Sex in the City auf Mad Max. Oben auf der Brücke spazieren zwei Frauen lässig auf den riesigen gebogenen Stahlträgern, die die Brücke halten. Doch keiner scheint sie zu beachten, fast so, als ob dies ganz alltäglich wäre. Am höchsten Punkt des Stahlbogens setzen sie sich hin und genießen die Aussicht, während sich ihre langen Kleider wie Segel in der leichten Brise aufblasen.
Ich lasse das Gedränge hinter mir und steige eine Stahltreppe hinunter auf Straßenniveau. Die Straße ist abgesperrt und hier, auf dieser Seite des Flusses, ist alles ruhig. Aus ein paar dünnen Rohren wird Wasser auf den leeren Asphalt gesprüht, während eine Handvoll Leute geduldig an der Brüstung im Schatten der Brücke lehnen.
In einem kleinen Pavillon sitzen zwei Fernsehtechniker vor einem Pult mit elektronischen Geräten und einem Bildschirm. Auf dem Monitor ist eine kleine Gruppe Läuferinnen zu sehen. Eine Italienerin liegt in Führung. Dicht hinter ihr die üblichen Verdächtigen: eine Kenianerin, eine Äthiopierin und zwei japanische Athletinnen.
Ich behalte den Bildschirm im Auge und wünschte mir, dass ich etwas zu trinken dabeihätte. Währenddessen höre ich in der Ferne einen Helikopter. Das muss der Helikopter sein, der die Läuferinnen aus der Luft beobachtet. Von der anderen Seite des Flusses dringt der ausgelassene Lärm des Parks herüber.
Plötzlich stehen zwei Japanerinnen neben mir, so, als hätten sie sich gerade materialisiert. Beide tragen Jogginganzüge in den Nationalfarben Japans und unterhalten sich angeregt, während sie immer wieder gespannt die Straße in Richtung Helikopter hinaufblicken. Auf der anderen Seite der Straße beobachte ich, wie einige Leute eine japanische Flagge über die Absperrung hängen. Kaum sind die Läuferinnen in Sichtweite, beginnen sie mit ihren hohen Stimmen zu jubeln. Die beiden japanischen Frauen neben mir springen auf und ab und feuern ihre Teamkameradinnen an, als die fünf Führenden vorbeilaufen.
„Gambare, gambare“, rufen sie, bevor sie davonrauschen, wahrscheinlich, um noch einen weiteren Blick an einer anderen Stelle der Strecke auf die Athletinnen zu erhaschen.
Es war übrigens meine Frau, die die Idee hatte, auf dem Landweg nach Japan zu reisen. Nachdem ich meine Familie für sechs Monate nach Kenia mitgenommen hatte, wurde ich mit Kommentaren überflutet, in denen immer wieder gesagt wurde, wie geduldig und verständnisvoll Marietta sein müsse. Die Leute scherzten oft, dass, wenn sie ihren Partnern so etwas vorschlagen würden, sie sich gleich auf eine Scheidung gefasst machen könnten. Was diese Leute allerdings nicht wussten, war, dass Marietta eine geborene Abenteurerin ist und ganz entzückt darüber war, nach Kenia zu ziehen.
Japan hatte anfangs jedoch nicht die gleiche Anziehungskraft auf sie. Vielleicht weil es nicht exotisch genug ist. Erst als sie die Idee hatte, über Land zu reisen, entwickelte sie richtige Begeisterung für das Projekt.
„Fliegen ist irgendwie komisch“, sagte sie. „Du wirst an einer Stelle in die Luft gehoben und an einem vollkommenen anderen Ort auf der Erde und in einer anderen Zeitzone abgesetzt. Das ist ein Schock für dein System. Und du erfährst nichts über die Zeit und den Raum, die Welt, die dazwischen liegt.“
Ihrer Ansicht nach fühlt es sich natürlicher an, die Welt über Land zu bereisen. Außerdem lieben die Kinder Züge. Es würde Spaß machen. „Denk nur an all die Orte, die wir am Weg besuchen werden.“
Ich blickte sie nervös an. Ich wünschte, ich wäre auch so begeistert davon gewesen, zusammen mit drei kleinen Kindern mehr als 14.000 Kilometer auf dem Landweg zu reisen, doch allein der Gedanke daran erfüllte mich mit Panik.
So bestieg ich an einem Montag Ende Juli mit feuchten Händen den Zug um 9:06 an der Tiverton Parkway Station in Devon und machte mich auf nach Kyoto, Japan.
Unsere Route führte nördlich der Ostsee durch Dänemark, Schweden und Finnland. Mit Kindern durch Skandinavien zu reisen, war eine wahre Freude. Als wir in Finnland den Zug von Turku nach Helsinki erwischen wollten, bemerkte die Dame am Ticketschalter, dass wir Kinder dabeihatten.
„Wollen Sie in der Nähe des Spielwaggons sitzen?“, fragte sie. Dort gab es eine Rutsche und eine Spielzeugeisenbahn, in der Kinder sitzen können, sowie eine Bücherecke. Die Zeit verging wie im Flug.
Das alles änderte sich schlagartig, als wir Russland erreichten. Kaum waren wir in Moskau angekommen, sah mich meine jüngste Tochter Uma an und sagte: „Paps, in Finnland hat es mir besser gefallen.“
Dabei hatten wir noch nicht einmal den Bahnhof verlassen. Ich wollte kein vorschnelles Urteil abgeben, aber ich wusste, was sie damit meinte.
Diese Vorahnung sollte sich in den nächsten Wochen bestätigen. Freundliches Service scheint in Russland ein Fremdwort zu sein. Die meisten Kellner und Bediensteten in Kaffeehäusern, Zügen oder an anderen Orten sind anscheinend der Ansicht, dass Gäste oder Kunden ignoriert und mit einem gleichgültigen Achselzucken bedacht gehören, sollten sie sich weiter dem Aberglauben hingeben, bedient zu werden.
Es ist ein glücklicher Zufall, dass wir just zur Zeit der Leichtathletikweltmeisterschaften in Moskau ankommen. Doch die Veranstaltung scheint am Großteil der Einwohner vorüberzugehen, auch wenn ich an der einen oder anderen Bushaltestelle ein paar wenige Poster, auf denen Usain Bolt zu sehen ist, erspähe. Wie sich herausstellt, ist Bolt, genauso wie Uma, auch nicht besonders begeistert von der Stadt. In einem Interview meint er: „Die Russen lachen nicht gerade viel.“
Nach dem Marathon der Frauen – bei dem die beiden Japanerinnen am Ende den dritten und vierten Platz belegen – geselle ich mich wieder zu meiner Familie im Gorki-Park. Die Sonne brennt nun nicht mehr ganz so schlimm herunter, und ich finde Marietta und die Kinder auf einem staubigen Spielplatz. Zu ihrem Glück habe ich bereits ein weiteres Highlight eingeplant – einen Abend im Luschniki-Olympiastadion, um bei den Leichtathletikbewerben zuzusehen.
Das Stadion ist halb leer, trotz der Tatsache, dass Usain Bolt in den 100-Meter-Läufen startet. Wir finden uns umgeben von fahnenschwingenden Briten aus Basingstoke und Cheltenham. Irgendwie hat es etwas Beruhigendes an sich, zu hören, wie sich andere in einem vertrauten Dialekt über den russischen Service beschweren.
Vor uns sitzt ein älteres russisches Ehepaar, das aufgrund des Heus, das noch unter ihren Hemden hervorschaut, so aussieht, als käme es aus einem entlegenen Dorf. Das ist eines der Dinge, die ich an der Leichtathletik liebe – dass sie Leute wie diese anzieht. Trotz dem übertriebenen Rummel rund um die Sprinterstars ist die Leichtathletik im Kern doch noch etwas altmodisch geblieben.
Heute Abend findet das 10.000-Meter-Finale der Herren statt. Ich bin genauso aufgeregt wie alle anderen, den britischen Champion Mo Farah gegen die besten Kenianer und Äthiopier laufen zu sehen. Das Starterfeld wird dann noch von den restlichen Europäern und ein paar Japanern komplettiert. Trotz ihrer Stärke bei Straßenrennen haben die Japaner schwache Ergebnisse auf der Bahn, und es kommt daher auch nicht überraschend, dass sich ihre drei Läufer in diesem Rennen schnell am Ende des Feldes wiederfinden, als sich die Geschwindigkeit erhöht.
Farah spielt sich mit der Konkurrenz und läuft eine Zeitlang ziemlich am Ende des Feldes, bevor er beginnt, es von hinten aufzurollen, und das Rennen schlussendlich mit einem komfortablen Vorsprung gewinnt. Nach dem Wettkampf gehe ich hinunter an den Rand der Bahn, um ihn auf der Ehrenrunde abzufangen, und komme gleichzeitig mit seinem Coach, Alberto Salazar, an, der seinem Schützling gerade gratuliert. Nach der Umarmung und der Freude über den Sieg geht Salazar an mir vorüber.
„Gute Arbeit“, sage ich zu Salazar.
Er ist einer der genialsten Trainer auf der Welt. Neben Farah, dem Doppelolympiasieger von 2012, war noch ein weiterer seiner Athleten, der US-Amerikaner Galen Rupp, der in London Silber gewann, hier am Start gewesen und belegte den vierten Platz. Wenn also jemand vorzeigen kann, wie man die Kenianer und Äthiopier schlägt, dann Salazar.
„Danke“, antwortet er und verschwindet.
Seit wir mit der Planung für unsere Reise nach Japan begonnen haben, war die siebentägige Fahrt von Moskau bis Wladiwostok mit der Transsibirischen Eisenbahn etwas, das mir Magenschmerzen verursachte.
Wir beginnen unsere Zugfahrt an einem sonnigen Sonntagmorgen. Am Bahnsteig warten schon mehrere Familien zwischen Bergen an Gepäck. Als der Zug einfährt, steigen wir ein und machen uns auf die Suche nach unserem Abteil, wobei jeder von uns abwechselnd die schweren Taschen den Korridor entlangschleppt. Viele der Reisenden stehen draußen und säubern die Fenster ihres Abteils. Ein Reiz dieser Reise ist es, dazusitzen und die Welt draußen vorbeiziehen zu sehen. Doch die Fenster sind voller Schmutz. Marietta holt einige Feuchttücher hervor, geht zu unserem Abteilfenster und nimmt an der Massenputzveranstaltung teil.
Einige Minuten später fordert sie ein Schaffner auf, wieder einzusteigen, und dann fährt der Zug ab. Wir lassen Moskau hinter uns und fahren vorbei an Holzhäusern und grauen Plattenbauten, durch kleine Ortschaften und endlose Wälder, immer weiter, tage- und nächtelang, über den Ural und dann nach Sibirien. Die Landschaft ist überraschend schön, übersät mit kleinen Häusern mit spitzen Dächern und Holzbrunnen im Garten, fast wie aus einem Märchen.
Russen wundern sich oft darüber, dass Touristen sich diese Zugfahrt zum Spaß antun. Für sie ist es nur ein Mittel, um von A nach B zu kommen, und nichts weiter. Der Prunk an Bord des Zuges ist eher vernachlässigbar. Die Abteile in unserem Waggon sind modrig, und die Waschräume bestehen aus nichts anderem als einer schmutzigen Metalltoilette und einem Waschbecken. Der Speisewagen besteht aus abgestoßenen Holztischen und ausgebleichten Vorhängen. Außerdem ist er meist voll mit deutschen Touristen oder betrunkenen Russen, die traurig vor sich hin starren. Als wir den Speisewagen aufsuchen, drückt uns die Kellnerin eine Speisekarte in die Hand, voll mit lecker klingenden Gerichten, die so gut wie allesamt nicht verfügbar sind.
„Borschtsch“, sagt sie, in einem Tonfall, der andeutet: entweder das oder gar nichts.
Nach einem zweitägigen Aufenthalt in Irkutsk, wo wir am Ufer des tiefsten Sees der Welt, dem Baikalsee, sitzen, Eis essen und Steine hüpfen lassen, besteigen wir eine noch ältere und klapprigere Garnitur. Die Luft im Zug ist drückend heiß, und es stinkt nach Zigarettenrauch. Zu unserem Horror müssen wir feststellen, dass die Fenster sich nicht öffnen lassen. Als wir aus der Station fahren, ziehe ich mir mein T-Shirt aus. Ich schwitze, während ich versuche, unsere Betten zu machen, und zähle bereits die Stunden, die wir in diesem Ofen verbringen müssen, bis wir Wladiwostok erreichen.
Die nächsten drei Tage verbringe ich damit, die Türen zwischen unserem Waggon und dem nächsten offen zu halten, damit der Zigarettengestank durch die kleine Öffnung abzieht. Doch immer wieder kommt jemand, der die Tür schließt. Drei Tage lang bunkern wir uns ein und halten die Tür zu unserem Abteil geschlossen, um unsere Atemluft zu schützen. Wir verbringen die Zeit gemeinsam mit Lesen, Schachspielen und Filme sehen. Nicht gerade die beste Vorbereitung auf mein Abenteuer in Japan. Abgesehen davon, dass ich einmal im Amager Fælled Park in Kopenhagen laufen war, hatte ich auf unserer Reise keine Gelegenheit gehabt, mich fit zu halten. Normalerweise genieße ich es, laufen zu gehen, wenn ich im Ausland bin, und nutze es, um meine neue Umgebung kennenzulernen, doch wenn wir nicht gerade in einem Zugabteil eingepfercht waren, hatten wir andere Dinge zu tun, wie etwa etwas zu essen aufzutreiben oder eine Übernachtungsmöglichkeit zu finden.
Als der Zug am letzten Tag dann mitten in der Gluthitze der sibirischen Taiga zum Stehen kommt, glaube ich, dass ich endgültig durchdrehe. Während die Stunden vergehen, reicht der Gedanke daran, dass wir die Fähre verpassen und in Wladiwostok festsitzen könnten, aus, dass ich am liebsten in das metallene Bettgestell beißen möchte. Glücklicherweise laufen die Kinder, die sich tragischerweise bereits an die verrauchte Luft gewöhnt haben, den Gang rauf und runter und spielen mit den anderen Kindern im Zug.
Ich bin an einem Punkt angelangt, an dem ich nicht mehr weiß, wie lange ich das noch ertragen kann, als der Zug plötzlich einen Ruck macht und sich langsam wieder in Bewegung setzt.
Am nächsten Morgen sind wir schon ganz aufgeregt und freuen uns darauf, Russland mit der koreanischen Fähre zu verlassen. Als wir Wladiwostok hinter uns lassen und die frische Luft und die warme Sonne auf unseren Gesichtern spüren, können wir endlich wieder befreit durchatmen. Nach zwei Tagen auf See erreichen wir Japan.