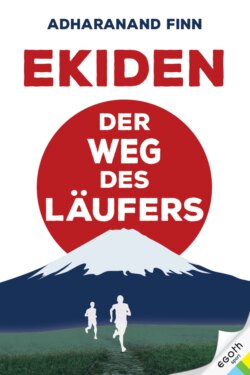Читать книгу Ekiden - Adharanand Finn - Страница 8
3
ОглавлениеWir nehmen den Hochgeschwindigkeitszug nach Kyoto, unserem Zielort. Das Innere des Zugs ist so breit wie ein Flugzeug, und auch die Sitzplätze sind in zwei Reihen zu je drei Sitzen angeordnet. Der Zug ist voll mit Leuten, die gerade von der Arbeit kommen. Kaum jemand spricht. Es ist eine Art ruhiger Tagesausklang. Ich sitze neben Lila, meiner ältesten Tochter. Sie liest. Auf der anderen Seite von mir sitzt ein Mann, der mit seinem Telefon spielt. Ich blicke an ihm vorbei durch das Fenster und beobachte, wie Städte und Ortschaften in der bläulichen Abenddämmerung vorbeiziehen. Wir fahren auf Höhe der Hausdächer. Jenseits der beleuchteten Straßen und Gebäude erheben sich bewaldete Berge, wie große Schatten, umgeben von weißem Nebel.
„Argh, aufhören“, höre ich Uma rufen, die etwas weiter hinten im Waggon sitzt. „Das ist ungezogen, Ossian. Umbaya.“
Dem folgt ein herzzerreißendes Jaulen als Antwort.
„Ach du liebe Zeit“, sage ich zu Lila. Sie grinst und amüsiert sich darüber, dass ihre beiden Geschwister das einzige Geräusch verursachen, das neben dem sanften Brummen des Zugs zu hören ist.
Hinten bricht ein richtiger Streit aus. Lila wirft einen Blick den Mittelgang hinunter und sieht mich dann glucksend an.
„Die sind so laut“, sagt sie.
Es ist vier Wochen her, seit wir mit unseren Koffern den Zug am Tiverton Parkway in Devon bestiegen haben. Nun sind wir endlich an unserem Ziel.
„In Kürze erreichen wir Kyoto“, ertönt es auf Englisch durch die Sprechanlage des Zugs, der nun immer langsamer wird. „Der Ausstieg befindet sich auf der rechten Seite.“
Wir schleppen unsere Koffer aus den hell beleuchteten Tiefen des Bahnhofs durch ein riesiges unterirdisches Einkaufszentrum hinaus in die warme Nacht. Alles in allem 13 Koffer und Taschen, wovon einige so schwer sind, dass sich beinahe der Boden des Waggons senkte, als wir sie in den Zug hievten.
Ossian, unser Jüngster, sitzt auf seinem Koffer und betrachtet die hohen Gebäude ringsherum.
„Wohin fahren wir jetzt?“, fragt er.
„Wir sind da“, sage ich. „Nur noch eine letzte Taxifahrt, dann ist es geschafft.“
Wir stehen neben einem riesigen Parkplatz. Ein Taxi nach dem anderen fährt an uns vorbei, doch keines bleibt stehen. Sie sehen uns, mit dem vielen Gepäck und den Kindern, und fahren weiter. Es sind kleinere Limousinen mit weißen Schutzbezügen auf den Sitzen und uniformierten Fahrern, die weiße Handschuhe tragen. Die beleuchteten Taxischilder auf den Taxidächern sind herzförmig. Endlich hält eines vor uns an.
„Hoteru?“, fragt der Fahrer.
Ich gebe ihm einen Zettel, auf dem eine Adresse auf Japanisch steht. Wir haben uns für ein paar Tage bei einem alten Freund namens Max einquartiert. Der Fahrer studiert den Zettel ein paar Sekunden, nickt, nimmt die schwersten Koffer und hebt sie in den Kofferraum seines Wagens.
Es ist nicht einfach, alles zu verstauen, doch er gibt sich Mühe. Einige unserer Taschen stellt er zu unseren Füßen hin, andere müssen wir auf den Schoß nehmen. Dann sind wir und unser Gepäck endlich verstaut. Wir fahren durch das Zentrum Kyotos in Richtung Norden, vorbei am kaiserlichen Palast, Fahrrädern und Menschen, die in Gruppen – wie Touristen – durch die Straßen ziehen, sowie an jungen Männern, die in Schaufenstern stehen und Comics lesen.
Im Wagen selbst hören die Kinder fasziniert der japanischen Stimme des Navis zu. Der Fahrer stellt den Bildschirm auf Fernseher. Es läuft gerade eine Gameshow. Man hört viel Gelächter und sieht, wie die Kandidaten immer wieder am Boden liegen. Draußen auf der Straße wird es langsam leerer, und auch die Häuser werden kleiner, bis wir nach einer etwa 25-minütigen Fahrt anhalten. Wir erkennen die Silhouette eines Mannes, der an der Straße steht. Ein Engländer in Leinenhosen und einem weißen T-Shirt.
Ich hatte Max zum ersten Mal vor zwölf Jahren in London getroffen. Beide folgten wir damals den Lehren eines Inders namens Prem Rawat, der über die Essenz des Lebens predigte, über die wunderschöne Realität der menschlichen Existenz und so weiter. Max schwebte herum wie eine erleuchtete Seele und meditierte jeden Tag stundenlang. Er hatte so eine ruhige Ausstrahlung, dass es schon wieder etwas verstörend wirkte.
Ich weiß gar nicht einmal mehr, was er arbeitete, wenn er überhaupt einen Job hatte. Im Alter von 16 Jahren schien Max nur ein weiterer Teenager ohne Zukunft zu sein. Seine Eltern hatten sich getrennt, als er noch ein Kind war, und seine Lehrer an der Schule in Leeds hielten ihn für einen Unruhestifter. Nachdem er bei seinen GCSE-Tests durchgefallen war, aber trotzdem an der Schule bleiben wollte, um sein Abitur zu machen, sagte man ihm, dass dies reine Zeitverschwendung wäre.
„Es war eine Herausforderung“, erzählte er mir. „Und das war genau das, was ich damals brauchte.“
Zwei Jahre später studierte er am renommierten Somerville College in Oxford Biologie.
Eines Abends, in einem Londoner Café, sagte er, dass er sich für eine Stelle als Englischlehrer in Japan beworben und eine Zusage bekommen habe. Er denke gerade darüber nach, ob er den Job annehmen solle. Das Nächste, was ich hörte, war, dass er das Land verlassen hatte. Nun, zwölf Jahre später, steht er vor seinem Haus in Kamigamo, einem wohlhabenden Bezirk im Norden Kyotos, und ist nicht damit zufrieden, wo der Taxifahrer angehalten hat. Auf Japanisch bittet er ihn, ein paar Meter weiter vor zu fahren.
Max spricht nicht nur fließend Japanisch, er hat auch ein Buch in dieser Sprache geschrieben und hält Vorträge über Kindheit, Lebensweise, Träume – eigentlich über alles, was die Leute von ihm hören wollen. Er scheint sich seine eigene kleine Gruppe an treuen Anhängern geschaffen zu haben – Maxiten, wenn man so will.
„Kommt herein“, sagt er, während er einen unserer Koffer nimmt und uns in einen kleinen Vorbau führt, wo wir unsere Schuhe ausziehen. Madoka, seine Frau, und sein zweijähriger Sohn Sen begrüßen uns, als wir das Haus betreten und eine Treppe nach oben gehen, die in einen kleinen, mit Tatamimatten ausgelegten Raum führt, in dem sich ein niedriger Tisch und einige Kissen befinden. Es ist noch immer sehr warm, deshalb haben wir auch nichts dagegen, als Max uns mit eigenartig riechendem Wasser besprüht.
„Effektive Mikroorganismen“, erklärt er uns. „Gute Bakterien. Das hilft nach einer langen Reise.“
Die Kinder kichern und genießen das kühle Spray. Mikroorganismen sind, wie wir bald erfahren, eines von Max’ Lieblingsthemen. Sie können für alles verwendet werden. Er trinkt sie, badet in ihnen und besprüht Dinge mit ihnen. Inklusive Menschen.
Etwas später begleite ich Max auf einem kleinen Spaziergang durch die Nachbarschaft. Mein Kopf ist nach unserer Reise um die halbe Welt immer noch nicht zur Ruhe gekommen, und alles erscheint ein wenig wie aus einem Comic. Die Straßen sehen so ordentlich und ruhig aus, das Straßenlicht wie mit Buntstift gezeichnet, und die Blätter des nahe gelegenen Waldes scheinen so, als wären sie einzeln gezeichnet worden. Hie und da fährt jemand auf einem quietschenden Fahrrad an uns vorbei.
Am Ende von Max’ Straße steht ein Schrein, umgeben von Bäumen. Max verbeugt sich höflich am mit roten Säulen eingefassten Eingang und deutet mir, dasselbe zu tun. Drinnen fühlt sich die Stille der Nacht noch stiller an, beinahe zum Greifen still. Wir folgen dem Kieselsteinweg bis zum eigentlichen Schrein. Das hervorstehende Dach und die dunklen Ecken tauchen im Laub der Bäume auf, fast wie ein lang vergessener Ort. Das melodische Zirpen der Grillen erfüllt die Dunkelheit. Ohne ein Wort zu sagen, folge ich Max bei einem simplen Ritual. Ich wasche meine Hände, läute eine stumme Glocke und verbeuge mich.
„Jetzt darfst du dir etwas wünschen“, flüstert Max mir zu.
Während ich so dastehe, fühlt sich diese mich einhüllende Stille beinahe magisch an. Ob das von dem Schrein kommt? Ich beschließe, dass wir diesem Schrein mit dem Verbeugen und dem Ritual eine gewisse Ehrerbietung erwiesen haben. Vielleicht wächst diese Ehrerbietung mit jeder Person, die diese Stätte besucht. Ich bin mir bewusst, dass ich mir etwas Größeres, Wichtigeres wünschen sollte, doch in diesem Moment fällt mir nur der Grund ein, weswegen ich nach Japan gekommen bin: Ekiden.
Ich spreche es nicht laut aus, aber ich bitte um Hilfe bei der Suche nach einem Ekiden-Team. Dann werfen wir eine Fünf-Yen-Münze in ein Kästchen, drehen uns um, verbeugen uns und verlassen den Schrein. Wir überlassen den Wunsch diesem zwischen Bäumen versteckten Ort und der Gnade der Shinto-Götter.
Am nächsten Abend gehe ich das erste Mal auf den Straßen Japans laufen. Max ist auch dabei. Er ist zwar kein Läufer, doch er meint, dass er es einmal ausprobieren wolle, solange ich hier sei. Früher einmal war er Kapitän der Fußballmannschaft seiner Schule gewesen.
„Yorkshire-Meister“, sagt er stolz.
Wir beginnen gemächlich. Obwohl ich in den letzten Monaten wegen der Reise so gut wie nicht gelaufen bin, fühle ich mich aufgrund des Mangels an richtigen Mahlzeiten in der Transsib recht leicht und jogge gemütlich neben Max her.
Es ist kurz vor 23 Uhr, als wir loslaufen, doch es ist noch immer sehr schwül. Nach dem geschäftigen Treiben untertags sind die Straßen nun wieder zu ihrer nächtlichen Stille zurückgekehrt, die nur gelegentlich durch die Geräusche eines langsam dahinrollenden Autos oder Fahrrads gestört wird. Ein Mann auf einem Moped fährt langsam die Straße hinunter, während sein Hund an der Leine neben ihm herläuft.
Max erzählt mir, dass seine Frau einen ehemaligen Arbeitskollegen namens Kenji Takao kontaktiert hat. Takao war ein professioneller Läufer und hat gute Kontakte in der Ekiden-Szene. Außerdem besitzt er ein Amateurteam, bei dem wir mitmachen dürfen. Das erste Training sei kommenden Freitagabend in Osaka.
Als mir – noch in England – bewusst wurde, dass ich ja kein professionelles Ekiden-Team brauchen würde, wurde mir unser künftiger Wohnort in Japan ziemlich egal. Ich hatte noch immer die Hoffnung, mich bei einigen Teams vorstellen zu dürfen und eines davon zu überzeugen, mich mitmachen zu lassen. So war es eine Option, nach Tokio zu ziehen, wo es sehr viele Ekiden-Mannschaften gibt. Doch in den Augen meiner Familie war dies weniger ideal, denn wir müssten lange suchen, bis wir eine Wohnung fänden, die größer als eine Schuhschachtel wäre. Kyoto war die nächstbeste Option. Zwar gibt es dort weniger Ekiden-Teams als in Tokio, aber immer noch genügend. Abgesehen davon ist die Stadt nur zwei Stunden mit dem Hochgeschwindigkeitszug von der Hauptstadt des Landes entfernt, und unser Freund Max lebt auch hier und hatte angeboten, uns dabei zu helfen, uns einzuleben und mir als Übersetzer auszuhelfen. Zudem ist Kyoto eine wunderschöne Stadt und liegt nahe dem Berg Hiei-zan, der Heimat der berühmten Marathonmönche. Diese Tendai-Buddhisten nutzen das Laufen, um spirituelle Erleuchtung zu erlangen, und absolvieren 1000 Marathons über 1000 Tage – eine unglaubliche Herausforderung, die nur wenige Menschen jemals erfolgreich abgeschlossen haben. Ich wusste nicht, ob die Möglichkeit bestand, einen dieser Mönche zu treffen, doch ich hoffte, es zumindest versuchen zu können.
Interessanterweise ist Kyoto auch der Geburtsort des Ekiden-Sports. Während der Edo-Zeit (1603 bis 1868) liefen Kuriere mit Botschaften zwischen Tokio und Kyoto, der alten kaiserlichen Hauptstadt, hin und her. Sie hielten an Versorgungsstationen, die entlang des Weges verstreut waren, um sich auszuruhen und zu stärken. Dabei gaben sie die Nachrichten meist an andere Kuriere weiter, die dann den nächsten Abschnitt der Strecke liefen. Dieser Tradition entstammt auch die Idee des Ekiden.
Das Wort „Ekiden“ setzt sich aus zwei japanischen Schriftzeichen zusammen, nämlich aus dem Schriftzeichen für „Station“ () und dem Schriftzeichen für „weiterleiten“ (). Um die Idee des Weitergebens einer Nachricht zu symbolisieren, tragen die Läufer ein Band über der Schulter, das Tasuki genannt wird und das immer an den nächsten Läufer übergeben wird. Der erste offiziell veranstaltete Ekiden-Wettbewerb startete im Jahr 1917 in Kyoto und führte über 508 Kilometer bis nach Tokio. Irgendwo in der Stadt gibt es eine Gedenktafel, die an den Start des Rennens erinnert.
Der letzte Grund, der für Kyoto sprach, war die Schule. In England gehen meine Kinder in eine Steiner-Schule, die einem anderen Lehrplan als konventionelle Schulen folgt. Wir hofften, dass ihnen, wenn sie in Japan auch in eine Steiner-Schule gingen, der Wechsel weniger schwerfallen würde und der Lehrplan etwas vertrauter wäre.
Steiner-Schulen gibt es auf der ganzen Welt. Auch hier in Japan. Eine der renommiertesten davon befindet sich in einem Vorort von Kyoto namens Kyotanabe. Also entschieden wir uns für diesen Ort.
Bereits nach 20 Minuten muss Max stehen bleiben. Er schwitzt heftig und hat Seitenstechen. Ich jogge ein wenig auf der Stelle, um zu sehen, ob er sich wieder erholt, doch er schüttelt nur den Kopf. Ohne zu sprechen, gehen wir langsam wieder zurück zu seinem Haus. Nach einiger Zeit kommt Max wieder zu Atem. Er erzählt mir, dass Kenji, der ehemalige Läufer, den seine Frau kennt und der ein Amateurteam besitzt, aus Kyotanabe stammt, dem Ort, in dem die Schule liegt. Er wäre quasi unser Nachbar, wenn wir dort hinziehen.
Bevor wir bei Max’ Haus ankommen, bleiben wir wieder bei dem Schrein stehen, trinken etwas von dem glasklaren Wasser dort und sammeln uns etwas. Am Eingang des Schreins befindet sich ein kleiner Kinderspielplatz. Ein junges Paar sitzt verlegen händchenhaltend auf einer kleinen Bank und versucht, so unauffällig wie möglich zu erscheinen, während Max zu den Schaukeln hinübergeht.
Er hatte mir von einem Freund erzählt, einem Yogalehrer, der ihm einige Tricks beigebracht hat. Und nun will er mir eines dieser Kunststücke vorführen. Max zieht sich auf die Querstange hinauf und dreht sich mit seinem Oberkörper nach vorne, bis seine Beine in die Höhe ragen. Mit konzentriertem Blick atmet er tief ein, schwingt seine Beine hinauf und über die Stange zurück wieder in die Startposition. Immer weiter rotiert er um die Stange und atmet dabei kräftig aus. Das Pärchen auf der Bank versucht, nicht hinzusehen. Nach ein paar weiteren Umdrehungen stoppt er und hängt mit dem Kopf nach unten von der Stange.
„Ein alter Sprinttrainer an der Uni hat mir einmal gesagt, wenn du zehn von diesen Schwüngen hintereinander machen kannst, kannst du die 100 Meter in unter zwölf Sekunden laufen. Schon für einen brauchst du eine Menge Kraft“, sagt er.
Darauf konzentriert er sich wieder und dreht sich noch einmal um die Stange, während ich zusehe. Dann lässt er sich wieder auf den Boden hinunter und wischt sich den Staub von den Händen.
„Ich bin ziemlich außer Übung. Im Moment schaffe ich nur sechs“, erklärt er.
Ein Haus in Japan zu finden, das man für länger als sechs Monate mieten kann, ist nicht so einfach für eine britische Familie. Ich habe von vielen Seiten gehört, dass Japaner nur ungern an Ausländer vermieten. Japan wird oft als ein homogener Inselstaat dargestellt, der nur sehr wenig mit Ausländern zu tun haben will. Für über 200 Jahre war es das Nordkorea der Welt und stellte das Ein- und Ausreisen unter Todesstrafe. Ein wenig von diesem isolationistischen Gedanken ist noch immer vorhanden. Vor einigen Jahren musste der japanische Verkehrsminister, dessen Aufgabe es unter anderem war, den Tourismus im Land anzukurbeln, zurücktreten, da er meinte, dass die Japaner Ausländer nicht besonders mögen. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage fand heraus, dass es Hunderte von Hotels in Japan gibt, die offen zugeben, ausländische Gäste abzuweisen.
2002 führte das Harvard Institute of Economics eine umfassende Studie durch, die zum Ergebnis kam, dass Japan eines der homogensten Länder der Welt ist. Das ganze Konzept von Japan als einzigartige, isolierte Insel wurde schon so oft von Japanern und Nicht-Japanern beschrieben, dass es sogar ein eigenes Genre dafür gibt: Nihonjinron. Dieses Konzept wird allerdings von einigen Gelehrten als veraltete Form eines kulturellen Nationalismus abgetan. Aber noch bevor ich in Japan ankam, stieß ich bereits auf unzählige Türen, die sich auf meiner Suche nach einem Ekiden-Team, dem ich beitreten könnte, vor meiner Nase schlossen. So wie Brendan Reilly es in seiner E-Mail geschrieben hatte: „Japan kann manchmal eine frustrierend verschlossene Gesellschaft sein.“
Just zu jenem Zeitpunkt, als wir am Beginn unserer Reise nach Japan mit dem Eurostar kurz davor waren, in den Channel-Tunnel einzufahren, rief mich Max am Handy an.
„Dhar, ich habe ein Haus für euch gefunden, aber du musst mir jetzt sagen, ob ihr es nehmen wollt oder nicht.“
Inzwischen zog die Landschaft Kents am Fenster vorbei. Uma fragte mich, ob ich ihr etwas vorlesen würde, und Ossian sprang laut singend auf seinem Sitzplatz auf und ab.
„Das Haus ist wirklich schön und nicht besonders teuer. Und es liegt nicht weit von der Schule entfernt“, meinte Max.
„Wir nehmen es“, antwortete ich.
Es war die erste konkrete Zusage, die ich bekam, seit ich mit den Arrangements für unseren Umzug nach Japan begonnen hatte. Und ich wollte diese Chance nicht verpassen. Abgesehen davon hatten wir bereits so viel dem Zufall überlassen, dass es im Moment egal war, wo wir wohnen würden. Meiner Meinung nach hatten wir kaum eine andere Wahl, als auf Gott zu vertrauen. Und auf Max.
Ein paar Sekunden später fuhr der Zug in den Tunnel ein, und die Verbindung riss ab.
„Sieht so aus, als hätten wir ein Haus, wenn wir dort sind“, sagte ich zu Marietta, die vor mir saß.
„Wirklich? Wie ist es?“
„Keine Ahnung.“
Das Haus ist schmal und hoch und passt genau zwischen zwei ähnliche Gebäude in einer kleinen, steilen Sackgasse in Kyotanabe. Um dorthin zu gelangen, zwängen wir uns alle in Max’ kleinen roten Sportwagen. Kaum sitzen wir drin, besprüht er wieder zuerst uns mit effektiven Mikroorganismen und dann das Auto. Er besprüht sogar die Reifen und erklärt uns, dass sie sich dadurch weniger schnell abnutzen.
Wir fahren durch die Stadt, vorbei am kaiserlichen Palast und hinaus in die Vororte südlich von Kyoto, wo wir auf die Autobahn auffahren, die sich auf hohen Betonpfeilern in die Lüfte erhebt. Die Straßen biegen und kreuzen sich, dass man sich beinahe nicht mehr auskennt, und ehe wir uns versehen, befinden wir uns wieder auf Straßenniveau, wo wir an eintönigen Flächen mit Reisfeldern und vereinzelten Lagerhäusern, Scheunen und alten Plakatwänden vorbeikommen.
Nach etwa zehn Minuten erreichen wir wieder eine verbaute Gegend, mit großen Einkaufszentren, Parkplätzen und einem McDonalds Drive-Through.
„Willkommen in eurer neuen Nachbarschaft“, sagt Max, während Marietta und ich nervöse Blicke austauschen.
Die Kinder sind ganz aufgeregt, als wir an einer Feuerwehrstation vorbeikommen. Die Feuerwehrautos glänzen rot und sind vielleicht halb so groß wie die, die wir aus England kennen. Auch ein kleiner Ambulanzwagen parkt vor der Station.
Während wir weiterfahren, ertappe ich mich dabei, vergeblich nach einem Park zwischen den vielen Gebäuden Ausschau zu halten oder nach Anzeichen einer Grünfläche, auf der man spielen, laufen oder sich irgendwie anders vom Betondschungel erholen könnte.
An einem Tante-Emma-Laden biegen wir rechts ab und fahren einen steilen Hügel hinauf, vorbei an der Steiner-Schule und in ein Wohnviertel. Wir befinden uns noch immer in den Sommerferien, und die Straßen sind ruhig. Es hat etwa 30 Grad. Die Häuser stehen nahe an der Straße und so knapp nebeneinander, dass kaum eine Person dazwischenpasst. Bei fast allen Häusern sind die Rollläden unten.
Schließlich halten wir vor dem Haus, das für die nächsten sechs Monate unser Heim sein wird. Wir steigen aus. Wir sind sicher ein Kuriosum hier in der Gegend, doch es gibt kein Anzeichen dafür, dass uns jemand heimlich beobachtet. Max schließt die Eingangstür auf. Drinnen ist es dunkel. Die Jalousien sind unten, und das Haus ist komplett leer. Keine Möbel, Töpfe oder Pfannen. Nicht einmal ein Kühlschrank oder eine Waschmaschine.
„Lasst uns einkaufen gehen“, sagt Max.