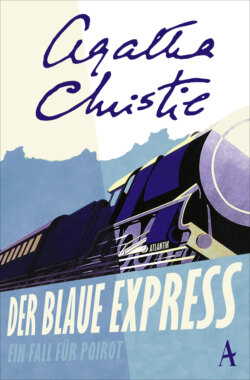Читать книгу Der blaue Express - Agatha Christie - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Achtes Kapitel Lady Tamplin schreibt einen Brief
Оглавление»Tja«, sagte Lady Tamplin, »tja.«
Sie ließ die Kontinental-Ausgabe der Daily Mail sinken und schaute hinaus auf die blauen Fluten des Mittelmeeres. Der goldfarbene Mimosenzweig, der über ihrem Kopf hing, gab einen wirkungsvollen Rahmen für ein sehr reizendes Bild ab. Eine goldhaarige, blauäugige Dame in einem sehr kleidsamen Negligé. Es ließ sich nicht leugnen, dass das goldene Haar der Kunst einiges verdankte, ebenso wie der weißrosa Teint, aber das Blau der Augen war ein Geschenk der Natur, und mit vierundvierzig konnte Lady Tamplin noch immer als Schönheit gelten.
So reizend sie auch gerade dreinblickte – Lady Tamplin dachte ausnahmsweise einmal nicht an sich. Das heißt nicht an ihr Aussehen. Sie befasste sich mit ernsteren Dingen.
Lady Tamplin war eine bekannte Erscheinung an der Riviera, und ihre Partys in der Villa Marguerite waren mit Recht berühmt. Sie war eine Frau von beträchtlicher Lebenserfahrung und hatte vier Männer gehabt. Der erste war lediglich ein Irrtum gewesen, daher sprach die Lady nur selten von ihm. Er war so vernünftig gewesen, lobenswert prompt zu sterben, und seine Witwe heiratete daraufhin einen reichen Knopffabrikanten. Auch dieser war nach drei Jahren Eheleben in eine andere Sphäre entschwunden – angeblich nach einem fröhlichen Abend mit seinen Zechkumpanen. Danach kam Viscount Tamplin, der Rosalie sicher auf jene gesellschaftlichen Höhen gehoben hatte, wo sie zu wandeln wünschte. Sie behielt ihren Titel, als sie zum vierten Mal heiratete. Dieses vierte Unterfangen hatte sie aus reinem Vergnügen getätigt. Mr Charles Evans, ein außerordentlich gut aussehender junger Mann, siebenundzwanzig, mit bezaubernden Umgangsformen, großer Liebe zum Sport und ein leidenschaftlicher Liebhaber aller kostspieligen Dinge dieser Welt, hatte überhaupt kein eigenes Geld.
Lady Tamplin war mit dem Leben allgemein glücklich und zufrieden, hatte aber bisweilen leichte Besorgnisse wegen des Geldes. Der Knopffabrikant hatte seiner Witwe ein beträchtliches Vermögen hinterlassen, aber, wie Lady Tamplin häufig sagte, »was so dies und das angeht …« (dies war der Wertverlust der Aktien durch den Krieg, das waren die Extravaganzen des seligen Lord Tamplin). Es ging ihr noch immer recht gut, aber recht gut war kaum zufriedenstellend für eine mit Rosalie Tamplins Temperament.
An diesem besonderen Januarmorgen öffnete sie daher ihre blauen Augen außerordentlich weit, als sie eine gewisse Notiz in der Zeitung gelesen hatte, und äußerte dieses unverfängliche einsilbige Wort »tja«. Die einzige andere Person auf dem Balkon war ihre Tochter, Lenox Tamplin. Eine Tochter wie Lenox war ein trüber Dorn in Lady Tamplins Auge, ein Mädchen ohne jedes Taktgefühl. Sie sah älter aus, als sie tatsächlich war, und ihr spezieller sardonischer Humor war, um es gelinde auszudrücken, ungemütlich.
»Liebling«, sagte Lady Tamplin, »stell dir bloß mal vor.«
»Was gibt’s denn?«
Lady Tamplin nahm die Daily Mail auf, gab sie ihrer Tochter und wies mit aufgeregtem Zeigefinger auf die interessante Meldung.
Lenox las sie bar jener Erregung, die ihre Mutter zeigte.
»Na und?«, fragte sie. »So was passiert doch dauernd. In allen Dörfern sterben doch dauernd geizige alte Frauen, die dann ihren treuen Gesellschafterinnen ein Millionenvermögen hinterlassen.«
»Ja, Liebes, weiß ich«, sagte ihre Mutter, »und ich nehme an, das Vermögen ist gar nicht so groß, wie man behauptet; Zeitungen sind so unzuverlässig. Aber selbst wenn man die Hälfte abzieht …«
»Tja«, sagte Lenox, »sie hat es nicht uns hinterlassen.«
»Nicht direkt, Liebes«, sagte Lady Tamplin, »aber dieses Mädchen, diese Katherine Grey, ist eigentlich eine Kusine von mir. Eine der Greys aus Worcestershire. Meine eigene Kusine! Stell dir das vor!«
»Aha«, sagte Lenox.
»Und ich frage mich …«, sagte ihre Mutter.
»Was da für uns drin ist«, beendete Lenox, mit dem schrägen Lächeln, das ihre Mutter immer so schwierig zu verstehen fand.
»Ach, Liebling«, sagte Lady Tamplin, mit einem Hauch von Vorwurf in der Stimme.
Es war wirklich nur ein Hauch, denn Rosalie Tamplin war an die Offenherzigkeit ihrer Tochter und ihre ungemütliche Art, die Dinge beim Namen zu nennen, gewöhnt.
»Ich frage mich«, sagte Lady Tamplin, wobei sie wieder ihre kunstvoll nachgezeichneten Augenbrauen zusammenzog, »ob – ah, guten Morgen, Chubby, mein Lieber; gehst du Tennis spielen? Wie nett.«
Auf diese Anrede hin lächelte Chubby ihr freundlich zu, bemerkte leichthin: »Wie blendend du in diesem pfirsichfarbenen Etwas aussiehst«, und schlenderte an ihnen vorüber, die Stufen hinab.
»Der liebe Junge«, sagte Lady Tamplin; sie blickte ihrem Gatten zärtlich nach. »Aber was wollte ich eben sagen? Ah!« Sie richtete ihre Gedanken wieder auf das Geschäftliche. »Ich frage mich …«
»Nun komm doch um Himmels willen zur Sache. Das sagst du jetzt zum dritten Mal.«
»Tja, Liebes«, sagte Lady Tamplin, »ich frage mich, ob es nicht sehr nett von mir wäre, der lieben Katherine zu schreiben und ihr vorzuschlagen, uns hier zu besuchen. Sie hat natürlich keinerlei Kontakt zur Gesellschaft. Es wäre doch viel netter für sie, von einer ihrer Verwandten eingeführt zu werden. Ein Vorteil für sie und ein Vorteil für uns.«
»Was meinst du denn, wie viel du ihr dafür abschwatzen kannst?«, fragte Lenox.
Ihre Mutter sah sie tadelnd an und murmelte:
»Natürlich müsste man irgendein finanzielles Arrangement treffen. Was so dies und das angeht – der Krieg – dein armer Vater …«
»Und jetzt Chubby«, sagte Lenox. »Er ist ein teurer Luxusgegenstand, wenn man so will.«
»Soweit ich mich erinnere, war sie ein nettes Mädchen«, murmelte Lady Tamplin, die ihren eigenen Gedanken nachging, »ruhig, hat sich nie vorgedrängt, keine Schönheit, und sie ist nie den Männern nachgelaufen.«
»Sie wird also die Finger von Chubby lassen?«, sagte Lenox.
Lady Tamplin sah sie vorwurfsvoll an. »Chubby würde nie …«, begann sie.
»Nein«, sagte Lenox, »das glaube ich auch nicht; er weiß doch viel zu gut, woher die Butter auf seinem Brot kommt.«
»Liebling«, sagte Lady Tamplin, »du hast so eine direkte Art, die Dinge auszudrücken.«
»Entschuldige«, sagte Lenox.
Lady Tamplin raffte die Daily Mail, ihr Negligé, ihre Handtasche und etliche Briefe zusammen.
»Ich werde der lieben Katherine sofort schreiben«, sagte sie, »und sie an die schönen alten Zeiten in Edgeworth erinnern.«
Sie lief ins Haus, leuchtende Entschlossenheit im Blick.
Anders als bei Mrs Samuel Harfield floss ihr die Korrespondenz leicht aus der Feder. Ohne Pause oder Mühe füllte sie vier Seiten, und als sie alles noch einmal las, hatte sie nicht das Bedürfnis, auch nur ein Wort zu ändern.
Katherine erhielt den vier Seiten langen Brief am Morgen ihres Eintreffens in London. Ob sie etwas zwischen den Zeilen herauslas oder nicht, ist eine andere Frage. Sie steckte ihn in die Handtasche und machte sich auf, um den Termin mit Mrs Harfields Anwälten wahrzunehmen.
Es handelte sich um eine alteingesessene Sozietät in Lincoln’s Inn Fields, und nach wenigen Minuten des Wartens wurde Katherine zum Seniorpartner geführt, einem freundlichen älteren Herrn mit klugen blauen Augen und väterlicher Art.
Zwanzig Minuten lang besprachen sie Mrs Harfields Testament und verschiedene juristische Fragen. Danach reichte Katherine ihm Mrs Samuels Brief.
»Das sollte ich Ihnen wohl zeigen, nehme ich an«, sagte sie, »wenn es auch ziemlich albern ist.«
Er las es mit einem leisen Lächeln.
»Ein ziemlich plumper Versuch, Miss Grey. Ich brauche Ihnen wohl kaum zu sagen, dass diese Leute nicht den geringsten Anspruch auf das Erbe haben, und wenn sie versuchen, das Testament anzufechten, wird ihnen kein Gericht recht geben.«
»Ich hatte es mir schon gedacht.«
»Die menschliche Natur ist nicht immer sehr klug. An Mrs Samuels Stelle hätte ich viel eher an Ihre Großmut appelliert.«
»Unter anderem darüber wollte ich mit Ihnen sprechen. Ich möchte diesen Leuten eine gewisse Summe zukommen lassen.«
»Sie sind dazu in keiner Weise verpflichtet.«
»Das weiß ich.«
»Und sie werden es nicht so annehmen, wie es gemeint ist. Vermutlich werden sie es als Versuch auffassen, sie billig auszuzahlen. Was sie aber nicht daran hindern wird, es anzunehmen.«
»Das sehe ich auch so, aber da kann man nichts machen.«
»Ich würde Ihnen raten, Miss Grey, diese Idee fallenzulassen.«
Katherine schüttelte den Kopf. »Ich weiß, Sie haben vollkommen recht, aber ich möchte es trotzdem so machen.«
»Sie werden das Geld nehmen und nachher erst recht über Sie herziehen.«
»Tja«, sagte Katherine, »sollen sie doch, wenn es ihnen Spaß macht. Jeder von uns amüsiert sich auf seine Weise. Immerhin waren sie Mrs Harfields einzige Verwandte, und wenn sie sie auch als arme Verwandte verachtet und sich nie um sie gekümmert haben, als sie noch lebte, kommt es mir nicht richtig vor, dass sie ganz leer ausgehen sollen.«
Sie setzte sich durch, sosehr ihr der Anwalt auch abriet, und bald darauf ging sie durch die Straßen Londons mit der angenehmen Sicherheit, nach Herzenslust Geld ausgeben und für die Zukunft die Pläne machen zu können, die ihr gefielen. Ihre erste Maßnahme war der Besuch im Geschäft einer Modistin.
Eine schlanke, ältliche Französin, die aussah wie eine verträumte Herzogin, empfing sie, und Katherine sagte mit einer gewissen Naivität:
»Ich möchte mich, wenn ich darf, ganz in Ihre Hände geben. Mein Leben lang bin ich sehr arm gewesen und verstehe nichts von Kleidern, aber jetzt bin ich zu etwas Geld gekommen und möchte wirklich gut gekleidet aussehen.«
Die Französin war entzückt. Sie hatte das Temperament einer Künstlerin, und dieses war früher am Vormittag arg misshandelt worden durch den Besuch einer argentinischen Fleischbaronin, die darauf bestanden hatte, die für ihren extravaganten Schönheitstyp am wenigstens geeigneten Modelle zu kaufen. Sie prüfte Katherine mit kühlen, klugen Augen. »Ja – ja, es wird mir ein Vergnügen sein. Mademoiselle hat eine ausgezeichnete Figur; schlichte Linien werden ihr am besten stehen. Außerdem ist sie très anglaise. Manche Leute wären beleidigt, wenn ich das sagte, aber Mademoiselle nicht. Une belle anglaise, es gibt keinen entzückenderen Stil.«
Die Manier einer verträumten Herzogin war plötzlich verschwunden. Sie sprudelte Anweisungen für ihre Mannequins heraus. »Clothilde, Virginie, schnell, meine Kleinen, das kleine tailleur gris clair und die robe de soirée soupir d’automne. Marcelle, mein Kind, das kleine complet aus crêpe de Chine, mimosenfarben.«
Es war ein herrlicher Vormittag. Marcelle, Clothilde, Virginie, gelangweilt und hochmütig, paradierten langsam im Kreis, wobei sie sich nach altehrwürdiger Mannequin-Art drehten und wanden. Die Herzogin stand neben Katherine und machte Notizen in ein kleines Buch.
»Eine ausgezeichnete Wahl, Mademoiselle. Mademoiselle hat sehr feinen goût. Ja, wahrhaftig. Mademoiselle kann nichts Besseres auswählen als diese kleinen complets, wenn sie, wie ich vermute, diesen Winter an die Riviera fährt.«
»Lassen Sie mich doch dieses Abendkleid noch einmal sehen«, sagte Katherine – »das in Rosé und Malve.«
Virginie erschien und kreiselte langsam vorüber.
»Das ist das hübscheste von allen«, sagte Katherine, als sie das erlesene Ensemble aus Malve und Grau und Blau betrachtete. »Wie haben Sie es genannt?«
»Soupir d’automne; ja, ja, das ist wirklich das Kleid für Mademoiselle.«
Warum kamen diese Worte Katherine mit einem leisen Gefühl von Traurigkeit wieder ins Gedächtnis, als sie den Salon verlassen hatte?
»›Soupir d’automne, das ist wirklich das Kleid für Mademoiselle‹.« Herbst, ja, es war Herbst für sie. Frühling oder Sommer hatte sie nie gekannt, und sie würde sie auch niemals kennenlernen. Sie hatte etwas verloren, das ihr nie zurückgegeben werden konnte. All die Jahre des Dienens in St. Mary Mead – und die ganze Zeit war das Leben an ihr vorübergegangen.
»Ich bin eine Närrin«, sagte Katherine. »Ich bin eine Närrin. Was will ich denn eigentlich? Also, vor einem Monat war ich zufriedener als jetzt.«
Aus ihrer Handtasche nahm sie den Brief, den sie am Morgen von Lady Tamplin erhalten hatte. Katherine war nicht dumm. Sie verstand sehr wohl die Nuancen dieses Briefs, und die Gründe für Lady Tamplins plötzlich bekundete Zuneigung zu einer so lange vergessenen Kusine waren ihr durchaus klar. Nutzen, nicht Vergnügen ließ Lady Tamplin die Gesellschaft ihrer lieben Kusine so sehr ersehnen. Nun ja, warum nicht? Beide Seiten würden profitieren.
»Ich fahre hin«, sagte Katherine.
Da ging sie gerade Piccadilly hinunter und begab sich zu Cook’s, um gleich Nägel mit Köpfen zu machen. Einige Minuten musste sie warten. Der Mann, mit dem sich der Angestellte gerade beschäftigte, würde auch an die Riviera reisen. Alles fährt jetzt dahin, dachte sie. Nun denn, zum ersten Mal in ihrem Leben würde sie nun auch tun, was »alle« taten.
Der Mann vor ihr drehte sich plötzlich um und ging, und sie nahm seinen Platz ein. Sie trug dem Angestellten ihr Anliegen vor, aber gleichzeitig beschäftigte sich ein Teil ihrer Gedanken mit etwas anderem. Das Gesicht dieses Mannes – irgendwie kam es ihr bekannt vor. Wo hatte sie ihn nur gesehen? Plötzlich erinnerte sie sich. Es war vor ihrem Zimmer im Savoy gewesen, an diesem Morgen. Sie war mit ihm auf dem Korridor zusammengestoßen. Merkwürdiger Zufall, ihm zweimal an einem Tag zu begegnen. Sie warf einen Blick über die Schulter, mit einem Gefühl des Unbehagens, dessen Grund sie nicht kannte. Der Mann stand im Eingang und schaute zu ihr zurück. Ein kalter Schauer überlief Katherine; sie hatte eine Vorahnung von Tragödie, von drohendem Unheil …
Dann schüttelte sie mit ihrer gesunden Vernunft den Eindruck ab und richtete ihre ganze Aufmerksamkeit auf das, was der Angestellte sagte.