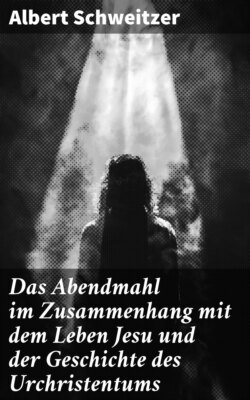Читать книгу Das Abendmahl im Zusammenhang mit dem Leben Jesu und der Geschichte des Urchristentums - Albert Schweitzer - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Der Einfluss der paulinischen Sühnetheorie auf die Fassung der synoptischen Leidensworte.
(Zweite Voraussetzung.)
ОглавлениеInhaltsverzeichnis
Es lässt sich kein Beweis führen, dass die synoptischen Leidensstellen durch paulinische Gedanken beeinflusst sind. Auch hier handelt es sich um eine Art Postulat, denn wenn es nicht gelingt, den juridischen Charakter von Mk 10 45 und Mk 14 24 auf Rechnung des paulinischen Mediums zu setzen, so muss man annehmen, dass Jesu Leidensgedanke selbst diese schroffe Sühnevorstellung enthalten habe. Darauf ist aber der modern-historische Lösungsversuch nicht eingerichtet.
Nun lässt sich aber beweisen, dass kein paulinischer Einfluss vorliegen kann! Nach Paulus sagt Jesus beim Abendmahl: Mein Leib für euch (I Kor 11 24). Dementsprechend heisst es auch Lk 22 19 u. 20: Mein Leib, der für euch gegeben wird, das Blut, das für euch vergossen wird. Die beiden älteren Synoptiker schreiben dafür immer: für viele. Mk 10 45 = Mt 20 28: zu geben sein Leben zur Sühne für viele. Mk 14 24 = Mt 26 28: mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele. Das eine Mal ist also das Publikum, welchem das Leiden zu gute kommt, genau bestimmt: es sind die Jünger. Das andere Mal handelt es sich um eine unbestimmte Mehrheit.
Mit dem Argument, dass es sachlich auf dasselbe hinauskomme, ist nichts gethan. Warum redete Jesus bei den älteren Synoptikern von den Vielen, bei Paulus von den Seinen? Die einzige Erklärung liegt darin, dass Paulus von dem Standpunkt der Gemeinde nach dem Tode Jesu schreibt. Danach kommt die Heilswirkung des Todes Jesu einer bestimmten Gemeinschaft zu gute, nämlich denen, die an ihn glauben. Die Jünger repräsentieren diese gläubige Gemeinschaft in den geschichtlichen Aussprüchen Jesu, weil man es sich vom Standpunkt der messiasgläubigen Gemeinde aus nicht anders vorstellen konnte, als dass Jesus mit den Worten über sein Leiden die Gläubigen gemeint habe.
Das altsynoptische »für viele« ist aber vom historischen Standpunkt aus gesprochen, wo Jesus noch nicht den Glauben an seine Messianität verlangt und wo deshalb die Mehrheit, denen sein Tod zu gute kommen soll, unbestimmt gelassen ist. Nur eines ist ihm gewiss, dass sie grösser ist als der Jüngerkreis; darum sagt er »für viele«. Hätte er gesagt »für euch« wie Paulus ihm zumutet, so hätten die Jünger daraus schliessen müssen, er sterbe für sie allein, da sie sich damals nicht, wie es Paulus und der Gemeinde geläufig war, als Repräsentanten einer zukünftigen messiasgläubigen Gemeinschaft fühlen konnten.
Ist aber dieses »für viele« stehen geblieben, trotzdem Paulus aus der Gemeindevorstellung heraus es instinktiv durch »für euch« ersetzen muss, obwohl er dadurch ein historisch unmögliches Wort schafft: so ist man nicht berechtigt, in der überlieferten Form des altsynoptischen Leidensgedankens irgendwie paulinische Beeinflussung anzunehmen. Die schroffe Sühnetheorie bei den Synoptikern ist also historisch. Eine Abschwächung, wie sie der modern-historische Lösungsversuch voraussetzen muss, ist unberechtigt.
Nun stellt sich die Aufgabe, in der Deutung der Aussprüche Jesu gerade dem »für viele« gerecht zu werden. Weil sie dies nicht gethan haben, sind alle Darlegungen über die Bedeutung des Todes Jesu, von Paulus bis Ritschl, unhistorisch. Man setze statt der gläubigen Gemeinschaft, mit der sie operieren, die unbestimmte und unqualifizierte Mehrheit des historischen Wortes ein, dann werden ihre Ausführungen einfach sinnlos. Historisch ist allein diejenige Deutung, welche begreiflich macht, warum nach Jesus die durch seinen Tod gewirkte Sühne einer mit Absicht unbestimmt gelassenen Mehrheit zu gute kommen soll.