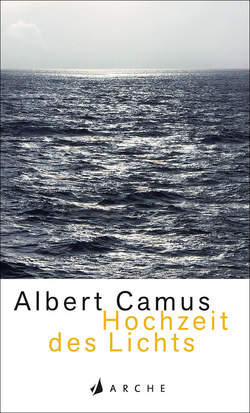Читать книгу Hochzeit des Lichts - Альбер Камю, Albert Camus, Albert Camus - Страница 4
Der Wind in Djemila
ОглавлениеEs gibt Orte, wo der Geist stirbt um einer Wahrheit willen, die ihn verneint. Als ich nach Djemila kam, wehte es, und die Sonne schien; aber das ist eine andere Geschichte. Jetzt will ich nur sagen, dass eine drückende Stille über allem lag – reglos wie das Gleichgewicht einer Waage. Einige Vogelschreie, der gedämpfte Ton der dreigelochten Flöte, das Getrippel von Ziegen – all diese Geräusche brachten mir die Stille und Trostlosigkeit des Ortes erst zu Bewusstsein. Hin und wieder flog flügelklatschend und schreiend ein Vogel aus den Trümmern. Jeder Weg, jeder Pfad zwischen den Häuserresten, die großen gepflasterten Straßen zwischen den leuchtenden Säulen, das riesige, auf einer Anhöhe zwischen Triumphbogen und Tempel gelegene Forum – alle enden in jenen Schluchten, die von allen Seiten Djemila umgeben, das wie ein ausgebreitetes Kartenspiel unter dem endlosen Himmel liegt. Und dort ist man nun, einsam und umringt von Stille und Steinen; und der Tag geht hin, und die Berge wachsen und werden violett. Aber der Wind bläst über die Hochebene von Djemila. Mitten in diesem großartigen Durcheinander von Sonne und Wind und lichtgrellen Ruinen nimmt die schweigende Verlassenheit der toten Stadt den Menschen mehr und mehr in sich hinein und verschlingt ihn.
Man braucht viel Zeit, um nach Djemila zu gelangen. Es ist keine Stadt, wo man haltmacht, um später weiterzufahren. Djemila führt nirgendwo hin und erschließt keinerlei Landschaft. Es ist ein Ort, den man wieder verlässt. Die tote Stadt liegt am Ende einer langen, vielfach gewundenen Straße, die immer wieder ihr Erscheinen verheißt und deshalb so ermüdend lang wirkt. Endlich, tief eingelassen zwischen hohen Bergen auf dem blassen Hochplateau, taucht das gelbliche Skelett eines Knochenwaldes auf: Djemila, Gleichnis und sichtbare Lehre, dass überall nur Geduld und Liebe uns bis ans klopfende Herz der Welt gelangen lassen. Dort, zwischen ein paar Bäumen, liegt die gestorbene Stadt und verteidigt sich mit all ihren Bergen und all ihren Trümmern gegen billige Bewunderung, malerisches Missverstehen und törichte Träume.
Den ganzen Tag waren wir in diesem dorrenden Glanz umhergeirrt. Langsam schien der Wind, den man am frühen Nachmittag kaum fühlte, mit jeder Stunde zu wachsen und das ganze Land zu füllen. Er kam von weit her aus einer Lücke zwischen den östlichen Bergen, eilte vom Horizont herbei und warf sich in jähen Sprüngen zwischen die sonnenglühenden Trümmer. Unermüdlich blies und jagte er durch die Ruinen, drehte sich in einer Kies- und Staubwolke im Kreise, hagelte auf die durcheinandergeworfenen Steinquadern nieder, schlang sich brünstig um jede Säule und stürmte mit gellem Geheul über das Forum, das wehrlos unterm Himmel lag. Ich flatterte wie ein Segel im Wind. Mein Magen zog sich zusammen; meine Augen brannten, meine Lippen sprangen auf, und meine Haut trocknete aus, bis ich sie kaum noch als meine empfand. Durch sie hatte ich sonst die Schrift der Welt, die Zeichen ihrer Huld oder ihres Zornes, entziffert, wenn ihr sommerlicher Atem sie erwärmte oder der Reif seine Frostkrallen in sie schlug. Jetzt aber, stundenlang vom Wind gepeitscht und geschüttelt, betäubt und ermattet, ging mir das Gefühl für die Oberfläche, die meinen Leib zusammenhielt, verloren. Der Wind hatte mich geschliffen wie Flut und Ebbe den Kiesel und hatte mich bis zur nackten Seele verbraucht. Ich war nur noch ein Teil von jener Kraft, die mit mir tat, was sie wollte, und mich immer entschiedener in Besitz nahm, bis ich ihr schließlich ganz gehörte, sodass mein Blut im gleichen Rhythmus pulste und dröhnte wie das mächtige allgegenwärtige Herz der Natur. Der Wind verwandelte mich in ein Zubehör meiner kahlen und verdorrten Umgebung; seine flüchtige Umarmung versteinte mich, bis ich, Stein unter Steinen, einsam wie eine Säule oder ein Ölbaum unter dem Sommerhimmel stand.
Dies gewaltsame Wind- und Sonnenbad erschöpft meine gesamte Lebenskraft, die kaum noch in mir die matten Flügel regt, kaum sich zur Klage aufrafft, kaum sich zur Wehr setzt. Schließlich bin ich, in alle Winde verstreut, alles vergessend, sogar mich selbst, nur noch dieser wehende Wind und im Wind diese Säule und dieser Bogen, dieses glühende Pflaster und dieses bleiche Gebirge rings um die verlassene Stadt. Nie habe ich in einem solchen Maße beides zugleich, meine eigne Auflösung und mein Vorhandensein in der Welt, empfunden.
Ja, ich bin vorhanden; und jäh wird es mir klar, dass ich an eine Grenze rühre wie ein für immer eingekerkerter Mensch, für den alles vorhanden ist; aber auch wie ein Mensch, der weiß, dass »morgen« wie »gestern« sein wird und ein Tag wie der andere. Denn wenn ein Mensch seines Vorhandenseins innewird, erwartet er nichts mehr. Es sind die banalsten Landschaften, die einen Seelenzustand widerspiegeln. Ich aber suchte in diesem Lande überall nach etwas, das nicht mir gehörte, sondern von ihm ausging: eine gewisse Freundschaft mit dem Tode, in der wir uns verstanden. Zwischen den Säulen, die jetzt schräge Schatten werfen, zergingen meine Ängste wie verwundete Vögel in der hellen Trockenheit der Luft. Alle Angst kommt aus lebendigen Herzen; aber jedes Herz wird Ruhe finden: Das weiß ich, und sonst nichts. Je mehr der Tag zur Neige ging, je stiller und fahler die Welt wurde unter dem Aschenregen der einfallenden Dunkelheit, desto selbstverlorener und wehrloser fühlte ich mich gegen jenes langsame, innere Aufbegehren, das »Nein« sagte.
Wenige Menschen begreifen, dass es ein Verweigern gibt, das nichts mit Verzichten zu tun hat. Was bedeuten hier solche Worte wie Zukunft, Beruf und Fortkommen oder der Fortschritt des Herzens? Wenn ich eigensinnig nichts von »später« hören will, so vor allem, weil ich ohnehin nicht auf meinen gegenwärtigen Reichtum verzichten will. Ich mag als junger Mensch nicht glauben, dass der Tod der Beginn eines neuen Lebens ist. Für mich ist er eine zugeschlagene Tür. Ich sage nicht: Er ist eine Schwelle, die es zu überschreiten gilt – er ist ein furchtbares und schmutziges Abenteuer! Alles, was man mir einreden will, möchte dem Menschen die Last seines Lebens abnehmen. Aber ich sehe die großen Vögel mit ihren schweren Schwingen über Djemila kreisen und verlange nach einer gewissen Lebenslast und bekomme sie. Ganz aufgehen in diesem Wunsch: zu dulden – und alles Übrige zählt schon nicht mehr. Ich bin zu jung, als dass ich vom Tode reden könnte. Müsste ich’s dennoch – hier würde ich das rechte Wort finden, das zwischen Schrecken und Schweigen das klare Wissen um einen Tod ohne Hoffnung bekennt.
Man lebt mit ein paar vertrauten Ideen – zwei oder drei. Je nach der Umgebung, in der man aufgewachsen, und je nach den Menschen, denen man begegnet ist, poliert man sie und gibt ihnen ein neues Gesicht. Um eine eigne Idee zu haben, über die man reden kann, dazu braucht’s wenigstens zehn Jahre. Das entmutigt begreiflicherweise ein wenig. Derweilen aber wird dem Menschen das schöne Antlitz der Welt vertrauter. Bisher sah er ihr grad ins Gesicht. Nun muss er einen Schritt zur Seite tun und ihr Profil betrachten. Ein junger Mensch aber sieht der Welt ins Gesicht. Er hat noch nicht die Zeit gehabt, sich den Gedanken des Todes oder des Nichts zurechtzuschleifen, obschon seine Schrecken ihn quälen. Grade dies aber ist Jugend: diese bittere Zwiesprache mit dem Tode, diese körperliche Angst des Tieres, das die Sonne liebt. Im Gegensatz zu allem, was man sagt, macht Jugend sich in diesen Dingen nichts vor. Sie hat dazu weder Zeit noch Neigung. Und sonderbar: Vor dieser zerklüfteten Landschaft, vor der düsteren Feierlichkeit dieses versteinerten Schreis, der Djemila heißt, vor dieser toten Hoffnung und diesen erstorbenen Farben begriff ich, dass ein Mensch, der wert ist, so genannt zu werden, am Ende seines Lebens diese Zwiesprache erneuert, die paar, ihm seit Langem geläufigen Ideen verleugnet und jene Unschuld und Wahrhaftigkeit wiederfindet, die in dem Blick des frei seinem Schicksal gegenübertretenden antiken Menschen leuchten. Er gewinnt seine Jugend zurück, aber nur indem er dem Tode die Hand reicht. Wie verächtlich hingegen alle Krankheit! Krankheit ist ein Heilmittel gegen den Tod, auf den sie uns vorbereitet. Das Erste, was der Lehrling in ihrer Schule lernt, ist Mitleid mit sich selber. Sie hilft dem Menschen bei seinem angestrengten Versuch, sich vor der Gewissheit des absoluten Todes zu drücken. Aber ich sehe Djemila und weiß: Der einzige wahre Fortschritt der Kultur, den von Zeit zu Zeit ein Mensch für sich verwirklicht, besteht darin: bewusst zu sterben.
Es erstaunt mich immer wieder, wie dürftig unsere Ideen über den Tod sind, da wir doch all unsere andern Ideen so eifrig hin und her wenden. Der Tod ist entweder gut, oder er ist böse. Man fürchtet ihn oder ruft ihn herbei (wie es heißt). Dies beweist aber auch, dass das Einfache als solches über unser Begreifen geht. Was ist das, was wir »blau« nennen? Wie können wir’s denken? Das Gleiche gilt für den Tod. Über den Tod und über die Farben können wir nicht reden. Und doch ist dieser Mensch, den ich vor mir sehe, schwer wie die Erde, eine Vorgestalt dessen, was mich erwartet, und mir unendlich wichtig. Aber kann ich ihn »denken«? Ich sage mir: Ich muss sterben; aber was heißt das? Ich kann’s weder glauben noch an mir erfahren, sondern immer nur an andern. Ich habe Leute sterben sehen, vor allem Hunde. Das Entsetzliche ist: sie zu berühren. Ich denke dann an Blumen, an das Lächeln der Frauen, an Liebe und begreife, dass meine Todesangst nur die Kehrseite ist meiner Lebensgier. Ich beneide alle, die künftig leben werden und die Wirklichkeit der Blumen und Frauen in Fleisch und Blut erleben. Ich bin neidisch, weil ich das Leben allzu sehr und mit schicksalhafter Selbstsucht liebe. Was kümmert mich die Ewigkeit! Eines Tages liege ich vielleicht im Bett, und jemand sagt zu mir: »Sie sind kein Feigling, ich will aufrichtig mit Ihnen reden. Sie werden bald sterben.« Und ich liege da mit meinem ganzen Leben, meiner ganzen herzabschnürenden Angst und starre ihm fassungslos ins Gesicht. Das Blut steigt mir zu Kopf und klopft in den Schläfen. Wahrscheinlich würde ich alles um mich her kurz und klein schlagen.
Aber die Menschen sterben widerwillig. Man sagt ihnen: »Wenn du wieder gesund bist …«, und dann sterben sie. Das will ich nicht. Und wenn die Natur bisweilen lügt, so sagt sie bisweilen auch die Wahrheit. Djemila an diesem Abend sagt die Wahrheit; und wie traurig, wie eindringlich redet seine Schönheit! Ich will vor mir und der Welt nicht lügen noch mich belügen lassen. Ich will klar sehen bis ins Letzte und will mein Ende betrachten mit allem Neid und aller Angst, die mich schütteln. Je mehr ich mich von der Welt trenne und mich anklammere an das Los des lebenden Menschen, statt in den alles überdauernden Himmel zu schauen, desto größer wird meine Todesangst. Bewusst sterben bedeutet: die Kluft zwischen uns und der Welt verringern und freudlos und im Bewusstsein, dass die Herrlichkeit dieser Welt für immer vorbei ist, das Ende auf sich nehmen. Und das Klagelied der Hügel von Djemila gräbt mir dies bittre Wissen tief in die Seele.
Gegen Abend machten wir uns auf den Heimweg und stiegen die Hänge wieder hinauf, die ins Dorf führen. Wir hörten, wie jemand erklärte: »Dies hier ist die Heidenstadt, und dieser Teil, der von ihr wegdrängt, gehörte den Christen. Später …« Ja, so war’s. Menschen und Gesellschaftsformen sind hier aufeinandergefolgt, und Eroberer haben die Spuren ihrer Unteroffizierskultur dem Lande aufgedrückt. Sie hatten niedrige Vorstellungen von Größe, die sie an der bloßen Oberfläche ihres »Imperiums« maßen. Das Unbegreifliche ist, dass diese Ruinen dies Ideal so schlicht widerlegen. Denn dieses Skelett einer Stadt, die sich am Abend verliert, dieser Triumphbogen, über den weiße Taubenschwärme kreisen, reden nicht von ehrgeizigen Eroberern. Die Erde ist auf die Dauer stets mächtiger als die Geschichte. Dieser versteinerte, im Schweigen der Berge und des Himmels verlorene Schrei, Djemila – ich verstehe, was er verkündet: Helle und Gleichmut, die wahren Zeichen der Verzweiflung wie der Schönheit. Das Herz schrumpft ein vor dieser Größe, die wir bereits verlassen. Djemila bleibt hinter uns unter seinem klaren, trauernden Himmel. Jenseits der Hochebene ruft ein ferner Vogel; auf den Hügelabhängen hört man das plötzliche kurze Rascheln der Ziegen; und aus der gelassenen Ruhe des Abends taucht die Steinwand eines Altars mit dem Antlitz eines Hörner tragenden Gottes.