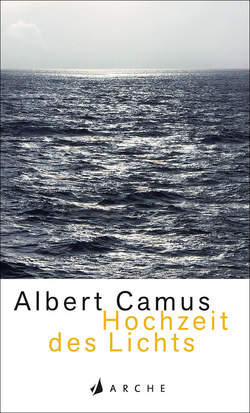Читать книгу Hochzeit des Lichts - Альбер Камю, Albert Camus, Albert Camus - Страница 5
Sommer in Algier
Оглавлениеfür Jacques Heurgon
Unsere Liebe zu einer Stadt ist oft eine heimliche Liebe. Städte wie Paris oder Prag oder sogar Florenz gehen nicht leicht aus sich heraus und gefallen sich in dieser Zurückhaltung.
Einige Städte aber, die das Glück haben, am Meer zu liegen – und unter ihnen Algier –, öffnen sich dem Himmel wie ein Mund oder eine Wunde. Was wir in Algier lieben, gehört allen: das Meer an jeder Straßenecke, die Lichtfülle, die Schönheit der Rasse. Doch dieses Hingegebensein ohne Scham birgt auch sein Geheimnis. In Paris kann einen die flügelschlagende Sehnsucht ins Weite verzehren. Hier aber hat der Mensch alles, was er begehrt, in Fülle und kann sich Rechenschaft ablegen von seinem Reichtum.
Man muss sicherlich lange in Algier gelebt haben, ehe man begreift, wie sehr eine im Übermaß schenkende Natur den Menschen verarmen kann. Wer etwas lernen, sich erziehen, sich bessern will, ist hier verloren. Dies Land gibt keine Lehren. Es verspricht nichts und hält auch nicht mit Hoffnungen hin. Es begnügt sich zu geben, und zwar im Überfluss. Es ist ganz und gar für die Augen da, und sobald man es genießt, kennt man es auch. Seine Genüsse kennen kein Heilmittel, und seine Freuden keine Hoffnung. Es verlangt klare sehende Seelen, die keinen Trost brauchen. Es will, dass man sich zu seiner Klarheit wie zu einem Glauben bekennt. Seltsames Land, das dem Menschen, den es ernährt, beides zugleich gibt: Glanz und Elend! So ist es nicht weiter erstaunlich, dass die reiche Sinnlichkeit dieser Menschen mit dem äußersten Elend zusammentrifft. Jede Wahrheit hat ihre Bitterkeit. Ist es da verwunderlich, dass ich dieses Land nie mehr liebe, als wenn ich unter seinen ärmsten Menschen bin?
Die jungen Männer können hier gleichermaßen ihre Jugend wie ihre Schönheit ausleben. Dann kommen der Abstieg und das Vergessenwerden. Sie haben aufs Fleisch gesetzt und wussten, dass sie verlieren müssen. Wer jung und gesund ist, findet in Algier überall eine Freistatt und feiert überall Triumphe: die Bucht, die Sonne, die roten und weißen Farbspiele der das Meer säumenden Terrassen, die Blumen und die Sportplätze, die jungen, frischen Mädchen – alles lädt ihn ein. Wer aber seine Jugend verloren hat, sucht vergebens, wo er bleiben soll und wo er seiner Schwermut entfliehen kann. Anderswo gibt es Plätze genug – Italiens Terrassen, Europas Klöster, die harmonischen Hügel der Provence –, wo der Mensch sich retten und schmerzlos von sich selber befreien kann. Hier aber verlangt alles die Einsamkeit und das Blut der jungen Menschen. Der sterbende Goethe rief nach »mehr Licht«. In Belcourt und Bab-el-Oued hocken die Alten hinten in den Cafés und hören zu, wie die glatt gescheitelten jungen Leute prahlen.
Der Sommer in Algier weiht uns in all diese Dinge ein. In diesen Monaten ist die Stadt verlassen und leer; nur der Himmel und die Armen sind geblieben. Mit den Letzteren steigen wir hinab zum Hafen, zu seinem sonnenwarmen Wasser und seinen sonnenbraunen Frauenleibern. Abends kehren diese Armen ermattet vom Genuss dieser Reichtümer zurück zu ihrer Petroleumlampe auf dem wachstuchbedeckten Tisch – ihrem einzigen Besitz.
In Algier sagt niemand »ein Bad nehmen«, sondern »sich ein Bad leisten«, se taper un bain. Man badet im Hafen, und man ruht sich aus auf den Bojen. Schwimmt man an einer Boje vorbei, auf der bereits ein hübsches Mädchen sitzt, so ruft man den Kameraden zu: »Eine Möwe, sag ich dir!« Das sind harmlose Vergnügungen. Und offenbar sind sie das Ideal dieser jungen Leute; denn die meisten von ihnen treiben es so den ganzen Winter, setzen sich jeden Nachmittag nackt in die Sonne und verzehren ihr bescheidenes Mahl. Keiner von ihnen hat die öden Traktate der Naturschwärmer gelesen – diese Protestanten des Fleisches (denn es gibt Systematiker des Leibes, die ebenso hoffnungslos borniert sind wie gewisse Systematiker des Geistes); aber sie fühlen sich wohl in der Sonne. Man kann die Wichtigkeit dieser Gewohnheit für unsere Epoche nicht hoch genug einschätzen. Zum ersten Mal nach zweitausend Jahren gibt es am Strand wieder nackte Leiber. Zwanzig Jahrhunderte lang haben die Menschen sich bemüht, der griechischen Unbefangenheit und Schamlosigkeit Sittsamkeit beizubringen und das nackte Fleisch unter allerhand Kleidern zu verstecken. Heute sind diese Zeiten vergessen; und die Jünglinge, die am Strand des Mittelmeeres um die Wette laufen, reichen den Athleten von Delos die Hand. Wer so mit seinem Leib unter Leibern lebt, lernt, dass der Leib seine eigenen Wünsche und Launen und, wenn man mir ein offenbar sinnloses Wort gestattet, seine eigne Seele hat.[1]
Die Entwicklung des Leibes wie die des Geistes hat ihre Geschichte, ihre Fortschritte, ihre Rückfälle und ihre Mängel. Betrachten wir zum Beispiel die Farbe. Wer im Sommer regelmäßig im Hafen badet, kann beobachten, wie die weiße Haut eines jeden Leibes zunächst goldbraun und dann bronzebraun wird, bis sie zuletzt eine gewisse Tabakfarbe annimmt, womit der Körper an der Grenze seiner Anpassungsfähigkeit angelangt ist. Über dem Hafen erhebt sich das weiße Würfelgewirr der Kasbah. Befindet man sich mit dem Wasserspiegel auf gleicher Ebene, so bilden die braunen Leiber gegen den grellweißen Hintergrund der Araberstadt einen kupferfarbenen Fries. Je heißer es nun im August wird, desto mehr blendet das Weiß der Häuser und desto dunkler wird das Braun der Leiber. Der ganze Vormittag ist hingegangen mit Tauchen, Spritzen, Lachen und langen Paddelschlägen um die rot-schwarzen Frachtdampfer herum: die»Norweger«, die nach allen möglichen Holzsorten duften, die »Deutschen«, die einen Ölgeruch verbreiten; und die »Coaster«, die nach Wein und alten Fässern riechen. Um die Zeit, da der Himmel von Hitze überströmt, bringt das orangefarbene Kanu unsere braunen Leiber in fliegender Fahrt zurück. Der rhythmische Doppelschlag des Paddels setzt plötzlich aus; und wir gleiten in langem Bogen in das glatte Wasser des Hafens: eine brüderliche Bronzeschar junger Götter.
Aber schon hält die sommerliche Stadt an ihrem anderen Ende andere Freuden für uns bereit: Ich meine den Genuss ihrer schläfrigen Stille. Diese Stille ist ganz verschieden, je nachdem sie ein Kind des Schattens oder der Sonne ist. Es gibt die Mittagsstille auf dem Gouvernementsplatz, wo im Schatten der ihn einfassenden Bäume Araber geeiste Zitronenlimonade mit Orangenblüten verkaufen, das Glas zu fünf Sous. Ihr Ruf, »frisch! frisch!«, hallt über den leeren Platz. Dann ist es wieder still, die Sonne glüht; und ich höre, wie sich im Kruge des Verkäufers das Eis mit leisem Klickern umdreht.
Es gibt auch die Stille der Mittagsruhe. In den Straßen des Marineviertels kann man sie geradezu hören, wenn man vor den schmutzigen Friseurläden auf das melodische Summen der Fliegen hinter den Vorhängen aus Schilfrohr achtet. In den maurischen Cafés der Kasbah wiederum herrscht das Schweigen der Leiber, die wie gebannt dasitzen und nicht imstande sind, sich zu erheben, das Glas Tee vor sich zu verlassen, den eingeschlafenen Pulsschlag des Blutes wiederzufinden und mit ihm das Gefühl für Zeit.
Und dann gibt es die große Stille der Sommerabende. Welche geheimnisvollen Zeichen und Rufe mögen in dieser kurzen Zeitspanne wach werden, da der Tag in die Nacht hinübergleitet, dass sich Algier um diese Stunde so tief meinem Gedächtnis hat eingraben können? Wenn ich eine Zeit lang diesem Land fernbleibe, erscheinen mir seine Abende wie lauter Versprechungen eines ungreifbaren Glücks. Dann kehrt mein Herz zurück zu den Öl- und Mastixbäumen längs der Wege, die über die stadtbeherrschenden Höhen laufen. Ich sehe den grünen Horizont und die über ihm aufsteigenden Schwärme von schwarzen Vögeln. An dem plötzlich sonnenlosen Himmel breitet sich ein ganzes Volk kleiner roter Wolken aus und löst sich langsam auf. Fast gleich darauf erscheint, nachdem er sich tastend in der Dunkelheit des Himmels geformt und gefestigt hat, der erste Stern. Und dann, mit einem Schlage, ist es Nacht. Was wirkt den Zauber dieser flüchtigen algerischen Abende, dass sie allein so viele Dinge in mir wachrufen? Jene milde Süßigkeit, die sie auf meinen Lippen zurücklassen, ist schon verschwunden in der Nacht, noch ehe ich sie habe auskosten können. Und vielleicht liegt darin das Geheimnis ihrer Fortdauer. Die Zärtlichkeit dieses Landes ist scheu und überwältigend zugleich. Kaum aber fühlt das Herz ihre Gegenwart, so ist es ihr auch schon verfallen.
Das Dancing am Padovani-Strand ist alle Tage offen. In diesem rechteckigen riesigen Lokal, das in seiner ganzen Länge aufs Meer geht, tanzt die Jugend des ärmlichen Stadtviertels bis zum Abend. Dort habe ich häufig einen einzigartigen Augenblick abgewartet. Tagsüber ist der Saal durch schräge Bretter gegen Wind und Sonne geschützt. Ist die Sonne verschwunden, so nimmt man sie weg. Dann füllt sich der Saal mit einem seltsam grünen Licht, wie das Innere einer Riesenmuschel, deren Schalen Himmel und Meer heißen. Sitzt man weit genug weg von den Fenstern, so sieht man nichts als den Himmel, an dem die Gesichter der Tanzenden wie Schattenbilder nacheinander vorbeiziehen. Hin und wieder wird ein Walzer gespielt; dann drehen sich die schwarzen Profile auf dem grünen Hintergrund emsig umeinander wie ausgeschnittene Silhouetten, die man auf einer Grammofonplatte im Kreise laufen lässt. Dann kommt, sehr schnell, die Nacht mit all ihren Lichtern. Aber ich kann nicht in Worte fassen, worin das hinreißend Geheimnisvolle dieses kostbaren Augenblicks besteht. Immerhin erinnere ich mich an ein großes, prachtvolles Mädchen, das den ganzen Nachmittag getanzt hatte. Es trug eine Halskette aus Jasminblüten über seinem engen blauen Kleid, das von den Hüften bis zu den Beinen schweißnass war. Es lachte beim Tanzen und warf den Kopf in den Nacken. Kam es dicht an den Tischen vorbei, so ließ es einen Geruch von Körper und Blumen zurück. Wurde es dann Abend, so sah ich seinen Körper nicht mehr, der sich an seinen Tänzer presste – ich sah nur noch den hellen Jasmin und das dunkle Haar am Himmel kreisen; und wenn es den Kopf zurückwarf, hörte ich sein Lachen und sah, wie sich das Gesicht seines Tänzers plötzlich über seinen schwellenden Hals beugte. Meine Vorstellung von Unschuld verdanke ich solchen Abenden. Seitdem vermag ich diese von heftigen Leidenschaften erfüllten Geschöpfe nicht mehr zu trennen von jenem Himmel, an welchem ihre Begierden kreisen.
In den kleinen Kinos von Algier kann man hin und wieder Pfefferminzbonbons kaufen mit Zettelchen, auf denen in roter Schrift alles steht, was nötig ist, um eine Liebschaft ins Leben zu rufen: 1. Fragen: »Wann werden Sie mich heiraten?«; »Lieben Sie mich?«; 2. Antworten: »Bis zum Wahnsinn«; »Im Frühling«. Hat man das Terrain sondiert, so gibt man die Zettelchen seiner Nachbarin, die auf dieselbe Weise antwortet oder tut, als verstände sie nicht. In Belcourt ist es mehrfach passiert, dass auf diese Weise Ehen zustande gekommen sind und zwei Menschen sich durch einen Austausch von Pfefferminzbonbons fürs ganze Leben verbunden haben – ein hübscher Beweis für die Kindlichkeit dieses Volkes!
Jungsein bedeutet vielleicht, dass man berufen ist, mühelos und strahlend glücklich zu sein. Vor allem aber bedeutet es, dass man sich mit verschwenderischem Leichtsinn ins Leben stürzt. Die Männer in Belcourt und auch in Bab-el-Oued heiraten jung. Sie beginnen sehr früh zu arbeiten und erschöpfen die Erfahrung eines ganzen Lebens innerhalb von zehn Jahren. Ein Arbeiter von dreißig Jahren hat bereits seine sämtlichen Trümpfe ausgespielt und wartet, umgeben von seiner Frau und seinen Kindern, auf sein Ende. Sein Glück war kurz und heftig und kennt kein Erbarmen. Genauso sein Leben. Man begreift, dass er ein Kind dieses Landes ist, wo das Glück all seine Gaben wieder zurückfordert. In dieser Fülle und Verschwendung wird das Leben bestimmt durch große, jähe, anspruchsvolle und großmütige Leidenschaften. Man baut es nicht auf: Man verbrennt es; daher denn auch niemand nachdenkt oder besser zu werden trachtet. So ist hier beispielsweise die Vorstellung der Hölle nur ein liebenswürdiger Scherz. Solche Fantasien sind nur den Allertugendhaftesten erlaubt; und »Tugend«, glaube ich, ist in ganz Algerien ein Wort ohne Bedeutung. Deshalb fehlt es diesen Menschen nicht etwa an festen Grundsätzen. Man hat seine Moral, und zwar durchaus eine eigenwillige. Man lässt seine Mutter »nicht im Stich«. Man beschützt seine Frau auf der Straße. Man ist zuvorkommend gegen Schwangere. Man fällt nicht zu zweien über einen Einzelnen her, weil das »sich nicht gehört«. Wer diese einfachsten Gebote nicht beachtet, »ist kein Mann«; damit ist alles gesagt. Das scheint mir eine gerechte und gesunde Auffassung zu sein. Es gibt unter uns noch viele, die unbewusst diese ungeschriebene Straßenmoral respektieren – meines Wissens die einzige uneigennützige Moral. Aber genauso wenig trifft man hier die Krämerseele an. Die Gesichter um mich herum drückten stets Mitleid aus, wenn ein Mann von Polizisten abgeführt wurde. Und bevor überhaupt bekannt war, ob der Mann gestohlen hatte, ein Vatermörder oder schlichtweg ein Nonkonformist war, sagte man: »der Arme« oder sogar mit einem Anflug von Bewunderung: »Das ist ein Pirat.«
Es gibt Völker, die von Natur stolz und lebenslustig sind. Gleichzeitig sind grade sie am meisten der Langeweile ausgeliefert, und ihre Vorstellung vom Tode ist abstoßend banal. Die Belustigungen dieses Volkes sind albern, wenn man von den Freuden der Sinne absieht. Seit undenklichen Zeiten geben sich die Leute über dreißig zufrieden mit Unterhaltungen wie Kino, Kegelspielen, Vereinsfeiern und Gemeindefestlichkeiten. Nichts Trübsinnigeres als ein Sonntag in Algier! Wie kann man von diesem geistlosen Volk erwarten, dass es sich die tiefe Trostlosigkeit seines Lebens durch Mythen verhüllt? Alles, was mit dem Tode zu tun hat, wird als lächerlich oder als peinlich empfunden. In diesem Volke ohne Religion und ohne Idole lebt man gesellig und stirbt allein. Ich kenne keinen widerlicheren Ort als den in einer der schönsten Landschaften der Welt gelegenen Kirchhof des Boulevard Bru. Zwischen lauter Denkmälern von schlechtestem Geschmack und lauter schwarzen Gestalten zeigt der Tod sein trostlosestes, sein wahres Gesicht. »Alles vergeht, nur die Erinnerung bleibt«, steht auf den herzförmigen Votivtafeln. Alle sind zufrieden mit dieser lächerlichen Ewigkeit, mit der die liebevollen Überlebenden uns so billig abspeisen wollen. Es sind die gleichen Phrasen, mit denen jede Verzweiflung sich tröstet. Man redet mit dem Toten in der zweiten Person: »Unser Gedenken verlässt Dich nicht« – eine üble Heuchelei, die das, was bestenfalls ein schwarzer Schleim ist, mit einem Körper und mit Gefühlen ausstattet. An einer anderen Stelle liest man unter einer betäubenden Fülle von Blumen und Marmortauben das kühne Gelöbnis: »Nie soll Dein Grab ohne Blumen sein.« Aber etwaige Zweifel schwinden schnell; denn über die Inschrift neigt sich ein Strauß vergoldeter Gipsblumen, die den Überlebenden viel Zeit ersparen (genau wie jene »Immortellen«, die ihren pompösen Namen der Dankbarkeit jener eiligen Leidtragenden verdanken, die auf die schon fahrende Straßenbahn springen). Da man mit der Zeit gehen muss, so ersetzt man bisweilen die klassische Lerche durch ein perlgesticktes Flugzeug, an dessen Steuer ein alberner und mit einem überflüssigen Flügelpaar ausstaffierter Engel sitzt.
Man darf trotzdem nicht übersehen, dass diese Bilder des Todes stets eine Beziehung zum Leben behalten. Der beliebteste Scherz der algerischen Totengräber, die mit leerem Wagen fahren, besteht darin, den jungen Mädchen auf der Straße zuzurufen: »Steig ein, mein Schatz!« Der symbolische Charakter dieser Aufforderung, so peinlich er sein mag, ist unverkennbar. Ebenso kann es lästerlich wirken, wenn jemand beim Lesen einer Todesanzeige das linke Auge zukneift mit den Worten: »Der Arme hat ausgerungen«; oder wie jene Dame aus Oran, die ihren Gatten nie geliebt hatte, auszurufen: »Gott hat ihn mir gegeben; Gott hat ihn mir wieder genommen.« Letzten Endes aber sehe ich nicht ein, was am Tode heilig sein soll; hingegen empfinde ich deutlich den Unterschied, der zwischen Angst und Respekt besteht. In diesem Lande, wo alles uns auffordert zu leben, bebt auch alles zurück vorm Sterben. Und dennoch trifft die Jugend von Belcourt sich mit Vorliebe an der Friedhofsmauer, um Küsse und Zärtlichkeiten auszutauschen.
Ich begreife sehr wohl, dass ein solches Volk nicht nach jedermanns Geschmack ist. Hier spielt, im Unterschied zu Italien, die Intelligenz keine Rolle. Diese Rasse ist gleichgültig gegen den Geist. Stattdessen verehrt und bewundert sie den Leib. Er ist die Quelle ihrer Kraft wie ihres naiven Zynismus[2] und ihrer jugendlichen Eitelkeit, die man ihr so streng verweist, wie man ihr überhaupt ihre »Mentalität«, will sagen, ihre Lebensauffassung wie ihre Lebensweise, zum Vorwurf macht. Und man muss zugeben, dass eine gewisse Lebensfülle nicht ohne Ungerechtigkeit bestehen kann. Indessen hat dies Volk ohne Vergangenheit und ohne Überlieferung dennoch seine eigne Poesie, die freilich hart und sinnlich ist und, genau wie sein Himmel, nichts weiß von Zärtlichkeit – die einzige Poesie, die mich wirklich tief erregen und packen kann. Das Gegenteil eines zivilisierten Volkes ist ein Schöpfervolk. Ich habe die verwegene Hoffnung, dass diese Barbaren, die sich am Strand des Meeres tummeln, eines Tages – vielleicht unbewusst – eine Kultur schaffen werden, in der endlich die Größe des Menschen ihren wahren Ausdruck findet. Dieses ganz und gar gegenwärtige Volk kennt keine Mythen und keinen Trost. Es hat sich ganz und gar dieser Erde anvertraut und ist daher wehrlos gegen den Tod. Leibliche Schönheit hat die Natur in reichem Maße an diese Menschen verschwendet und mit ihr zugleich jene seltsame Lebensgier, die stets eine Folge solcher zukunftslosen Fülle ist. Alles, was man hier tut, lässt Widerwillen gegen alles Beständige und Gleichgültigkeit gegen alles Zukünftige erkennen. Man hat es eilig mit dem Leben; und wenn hier je eine Kunst entstehen sollte, so würde sie jenem Hass gegen die Dauer gehorchen, der die Dorier antrieb, ihre erste Säule aus Holz zu schnitzen. Und dennoch kann man in dem heftigen und erbitterten Antlitz dieses Volkes sowohl Maß wie Übertreibung erkennen, wie auch in diesem erbarmungslosen Sommerhimmel, dem man jede Wahrheit ins Gesicht sagen darf und in den keine trügerische Gottheit die Zeichen der Hoffnung oder der Erlösung geschrieben hat. Zwischen diesem Himmel und den zu ihm aufblickenden Gesichtern ist kein Platz für eine Mythologie, eine Literatur, eine Ethik oder eine Religion, sondern nur für Steine, Leiber und Sterne und für Wahrheiten, die sich mit Händen greifen lassen.
Sich einem Lande verbunden zu fühlen, einige Menschen zu lieben und zu wissen, dass es einen Ort gibt, wo das Herz seinen Frieden findet – lauter Gewissheiten, die viel für das Leben eines Menschen bedeuten, obschon man sich damit zweifellos nicht begnügen kann. Und doch sehnt sich der Mensch zu gewissen Zeiten mit allen Fibern nach dieser Heimat seiner Seele. »Ja, dorthin müssen wir zurückkehren.« Und ist es denn so erstaunlich, dass man diese Vereinigung, die Plotin ersehnte, hier auf Erden findet? Hier verkünden die Sonne und das Meer diese Einheit. Dem Herzen offenbart sie sich mit jenem fleischlichen Beigeschmack, der ihre Bitterkeit und ihre Größe ausmacht. Ich lerne, dass es kein übermenschliches Glück gibt und keine Ewigkeit außer dem Hinfließen der Tage. Diese lächerlichen und zugleich wesentlichen Gaben und diese so bedingten Wahrheiten sind die Einzigen, die mich erschüttern. Die andern »idealen« Wahrheiten zu begreifen, fehlt es mir an Seele. Ich behaupte nicht, dass man zum Tier werden soll, sondern nur, dass ich am Glück der Engel keinen Geschmack finde. Ich weiß nur dies: dass der Himmel länger dauern wird als ich. Und was soll ich ewig nennen außer den Dingen, die meinen Tod überdauern? Ich rede hier nicht einer billigen Zufriedenheit des Geschöpfes mit seinem Zustand das Wort. Das ist etwas ganz anderes. Es ist nicht immer leicht, ein Mensch zu sein, und erst recht nicht ein reiner Mensch. Rein sein aber heißt, jene Heimat der Seele wiederfinden, wo wir uns dieser Welt verwandt fühlen, wo das Blut in unsern Adern im gleichen Rhythmus pocht wie der glühende Puls der Mittagssonne. Es ist allbekannt, dass man sein Vaterland stets dann erkennt, wenn man es verliert. Das Land, das diejenigen unter seinen Kindern, die allzu sehr unter sich selber leiden, verleugnet, ist ihr eigentliches Geburtsland. Ich möchte nicht brutal oder übertrieben erscheinen: Aber schließlich ist das, was mich in diesem Leben verleugnet, zunächst einmal das, was mich tötet. Alles, was das Leben steigert, vermehrt zugleich seine Sinnlosigkeit. Der algerische Sommer hat mich gelehrt, dass eines noch tragischer als das Leiden ist: das Leben eines glücklichen Menschen. Es kann aber auch den Weg zu einem größeren Leben bedeuten, sofern es uns lehrt, nicht zu mogeln.
In der Tat prahlen viele mit ihrer Liebe zum Leben, um der eigentlichen Liebe auszuweichen. Man will genießen und erleben. Aber das ist der Gesichtspunkt des Geistes. Selten, dass einer die echte Berufung zum Genießer hat. Das Leben eines Menschen vollzieht sich ohne den Beistand seines Geistes, ohne sein Zurückweichen wie sein Vordringen, seine Einsamkeit und seine Gegenwart. Wenn ich sehe, wie diese Leute von Belcourt arbeiten, für Frauen und Kinder sorgen und oft, ohne zu murren, muss ich mich heimlich beinahe schämen. Sicherlich mache ich mir nichts vor. Die Menschen, von denen ich rede, wissen nicht viel von Liebe in ihrem Leben. Aber wenigstens haben sie sich vor nichts gedrückt. Es gibt Worte, deren Sinn ich nie ganz verstanden habe, wie etwa das Wort »Sünde«. Dennoch glaube ich sagen zu können, dass diese Menschen nicht gegen das Leben gesündigt haben. Denn wenn es eine Sünde gegen das Leben gibt, so besteht sie vielleicht nicht so sehr darin, an ihm zu verzweifeln, als darin, auf ein anderes Leben zu hoffen und sich der unerbittlichen Größe dieses Lebens zu entziehen. Diese Leute haben nicht gemogelt. Mit zwanzig Jahren waren sie durch ihre glühende Lebensgier die Götter des Sommers und sind es immer noch, obwohl ohne jede Hoffnung. Zweie von ihnen habe ich sterben sehn. Das Entsetzen malte sich auf ihren Zügen, aber sie sagten nichts. So soll es sein. Aus der Büchse der Pandora, in der alle Übel der leidenden Menschheit wimmelten, ließen die Griechen als Letztes und Schrecklichstes die Hoffnung schlüpfen. Ich kenne kein erschütternderes Symbol. Denn hoffen heißt zuletzt entsagen, wenn man auch das Gegenteil zu glauben pflegt. Und leben heißt: nicht entsagen.
Das wenigstens ist die bittere Lehre des algerischen Sommers. Aber schon schwankt der Sommer und neigt sich seinem Ende zu. Nach so viel Heftigkeit und Härte sind die ersten Septemberregen wie die ersten Tränen der erlösten Erde, als empfände selbst dieses Land ein paar Tage lang etwas wie Zärtlichkeit. In dieser Zeit verbreiten die Johannisbrotbäume ihren liebeerregenden Duft über ganz Algerien – abends, wenn nach dem Regen der feuchte Leib der Erde einen Geruch wie bittre Mandeln ausströmt und ausruht, nachdem er sich den ganzen Sommer der Sonne hingegeben hat. Aufs Neue bekräftigt dieser Duft die Hochzeit des Menschen und der Erde und erweckt in uns die einzige, wahrhaft männliche, hochherzig-vergängliche Liebe in dieser Welt.
Anmerkung
Zur Erläuterung diesen Bericht über eine Schlägerei, den ich in Bab-el-Oued gehört habe und Wort für Wort wiedergebe. (Der Erzähler spricht nicht immer wie der »Cagayous de Musette«, der Gauner in einem typischen Tanzlokal Algiers. Darüber sollte man sich nicht wundern. Die Sprache Cagayous’ ist oft literarisch, ich meine damit eine Neugestaltung. Die Leute aus dem »Milieu« sprechen nicht immer Argot. Sie verwenden nur Argotausdrücke, und das ist schließlich ein Unterschied. In Algier werden ein typisches Vokabular und eine ganz besondere Syntax verwendet. Aber erst wenn sie Eingang in die französische Sprache gefunden haben, kommt ihre Würze voll zur Geltung.)
Coco geht also auf ihn zu und sagt zu ihm: »Halt mal, hör auf.« Der andere darauf: »Was ’n los?« Coco dann zu ihm: »Ich werd dir ein paar schruppen.« – »Mir ein paar schruppen?« Der hält dann die Hand hinter den Rücken, aber nur als Vortäuschung. Darauf Coco zu ihm: »Halt nicht die Hand nach hinten, denn dann hau ich dir die 6-35 aus der Hand, und die Fresse polier ich dir eh.«
Der andere hat keine Hand gerührt. Und Coco hat nur einmal zugeschlagen, wirklich nicht zweimal, nur einmal. Der andere lag schon am Boden und machte: »Aua, aua!« Dann kamen allerhand Leute dazu; und damit fing die Schlägerei an. Erst ist einer auf Coco losgegangen, ein Zweiter, ein Dritter. Ich hab denen gesagt: »Sag mal, willst du meinem Bruder an die Wäsche?« – »Wer, dein Bruder?« – »Auch wenn er nicht mein Bruder ist, ist er doch wie mein Bruder.« Und damit verpasste ich ihm eine. Coco schlug zu, ich kloppte mit, Lucien haute auch drauf. Ich hatte einen in der Ecke und mit dem Kopf: boing, boing! Dann kamen die Polizisten. Die verpassten uns Handschellen, du. Mit knallroter Birne musste ich durch ganz Bab-el-Oued gehen. Vor der Gentleman’s Bar waren Kumpels und Puppen, sag ich dir. Knallrot war ich. Aber nachher hat Luciens Vater zu uns gesagt: »Ihr habt recht!«