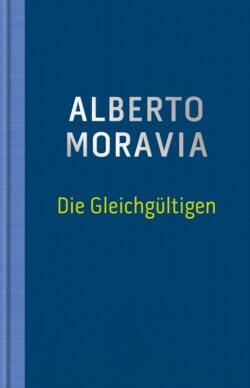Читать книгу Die Gleichgültigen - Alberto Moravia - Страница 5
ОглавлениеKAPITEL 3
Kurzer, aber quälender Weg durch den Flur. Carla schaute zu Boden und dachte flüchtig, dieser tägliche Gang müsse das Gewebe des alten Teppichs, der auf dem Fußboden lag, ganz abgenutzt haben; und auch die ovalen Spiegel, die an den Wänden hingen, dürften Spuren ihrer Gesichter und Gestalten bewahren, die sich seit vielen Jahren mehrmals täglich hier spiegelten, oh, nur für einen Augenblick, gerade mal so lange, dass ihre Mutter und sie die Schminke und Michele den Krawattenknoten kontrollieren konnten; in diesem Flur lauerten die Gewohnheit und die Langeweile und trafen jeden, der hier durchging, ins Innerste, als strömte ihr giftiger Geist direkt aus den Wänden. Alles blieb unverändert; der Teppich, das Licht, die Spiegel, die Glastür der Vorhalle zur Linken, das dunkle Treppenhaus rechts, alles wiederholte sich: Michele hielt einen Augenblick inne, um sich eine Zigarette anzuzünden, und blies das Streichholz aus, die Mutter erkundigte sich eitel bei ihrem Geliebten: »Nicht wahr, mein Gesicht sieht etwas müde aus heute Abend?« Leo antwortete gleichgültig, ohne die Zigarette aus dem Mund zu nehmen: »Aber nein, ich habe Sie nie so strahlend gesehen«, und sie selbst litt darunter; das Leben änderte sich nicht. Sie traten in das kalte Dunkel des rechteckigen Salons, den eine Art Bogen in zwei ungleiche Hälften unterteilte, und setzten sich in die Ecke gegenüber der Tür. Vorhänge aus dunklem Samt verhüllten die geschlossenen Fenster, einen Kronleuchter gab es nicht, sondern lediglich Lampen in Form von Kandelabern, die in regelmäßigen Abständen an den Wänden hingen. Drei von ihnen leuchteten und verbreiteten gedämpftes Licht in der kleineren Hälfte des Raumes, die andere jenseits des Bogens blieb in finsteres Dunkel getaucht, in dem man nur mühsam den Widerschein der Spiegel und die längliche Form des Flügels zu unterscheiden vermochte. Für eine Weile sprachen sie nicht. Leo rauchte entnervt, die Mutter betrachtete mit trauriger Würde ihre lackierten Fingernägel, Carla hatte sich fast bis zum Boden gebückt, um die Lampe in der Ecke anzuzünden, und Michele sah Leo an. Dann, als die Lampe brannte und Carla sich setzte, begann Michele zu sprechen: »Ich bin bei Leos Verwalter gewesen, und er hat mich mit einer Menge Geschwätz aufgehalten; die Essenz des Ganzen ist: Wie es scheint, verfällt in einer Woche die Hypothek, und daher müssen wir ausziehen und die Villa verkaufen, um Merumeci zu bezahlen …«
Die Mutter riss die Augen auf: »Der Mann weiß doch nicht, was er sagt …, das stellt er sich so vor …, ich hab ja schon immer behauptet, der hat was gegen uns …«
Schweigen. »Der Mann hat die Wahrheit gesagt«, murmelte Leo schließlich ohne aufzuschauen.
Alle sahen ihn an. »Aber Merumeci«, bat die Mutter händeringend, »Sie werden uns doch nicht so mir nichts, dir nichts wegschicken? Gewähren Sie uns einen Aufschub!«
»Ich habe Ihnen schon zweimal einen Aufschub gewährt«, sagte Leo. »Das genügt. Es würde ohnehin den Verkauf nicht verhindern …«
»Wieso das?«, fragte die Mutter.
Leo hob schließlich die Augen und schaute sie an: »Das kann ich Ihnen sagen: Wenn es Ihnen nicht gelingt, achthunderttausend Lire aufzubringen, weiß ich nicht, wie Sie mich bezahlen könnten, ohne die Villa zu verkaufen …«
Die Mutter begriff. Bodenlose Angst öffnete sich vor ihren Augen wie ein Abgrund. Sie wurde blass und schaute den Geliebten an. Aber Leo, der ganz in die Betrachtung seiner Zigarre versunken war, beruhigte sie nicht.
»Das bedeutet«, sagte Carla, »dass wir aus der Villa ausziehen und uns eine Wohnung mit wenigen Zimmern nehmen müssen?«
»Ja«, antwortete Michele, »genau das.«
Schweigen. Das Entsetzen der Mutter wuchs ins Unermessliche. Sie hatte nie etwas von den Armen wissen wollen. Sie hatte nicht einmal ihre Namen kennen wollen. Sie hatte die Existenz von Menschen, die mühselig arbeiten und ein schäbiges Leben führen, schlichtweg ignoriert. »Sie leben besser als wir«, hatte sie immer gesagt; »wir sind sensibler und intelligenter; daher leiden wir mehr als sie …« Jetzt war sie auf einmal gezwungen, sich unter sie zu mischen und die Masse der Elenden zu vergrößern. Sie empfand das gleiche Gefühl von Ekel, Demütigung und Angst, das sich ihrer seinerzeit bemächtigt hatte, als sie in einem offenen und ziemlich niedrigen Automobil durch eine Menge bedrohlicher, schmutziger Streikender gefahren war. Nicht die Unbequemlichkeit und die Entbehrungen, denen sie entgegensah, erschreckten sie, sondern der brennende Schmerz bei dem Gedanken, wie man sie behandeln würde, was ihre Bekannten sagen würden, die alle reich waren, angesehen und elegant. Sie sah sich schon verarmt, allein mit ihren beiden Kindern und ohne Freunde, von aller Welt verlassen, ohne Amüsements, Bälle, Feste und Unterhaltungen: die völlige Düsternis, die nackte Dunkelheit.
Sie wurde noch blasser: »Ich müsste mit ihm alleine sprechen, ohne Michele und ohne Carla«, dachte sie und klammerte sich an die Vorstellung, sie könnte ihn verführen …, dann würde er begreifen.
Sie schaute ihren Geliebten an. »Gewähren Sie uns noch einen Aufschub, Merumeci«, schlug sie unsicher vor, »dann werden wir das Geld schon irgendwie aufbringen.«
»Irgendwie?«, fragte der Mann mit einem leicht ironischen Lächeln.
»Die Banken …«, schlug die Mutter tapfer vor.
Leo lachte: »Oh, die Banken.« Er beugte sich vor und starrte der Geliebten ins Gesicht: »Die Banken«, erklärte er ihr, »verleihen Geld nur gegen Sicherheiten, und bei dem allgemeinen Geldmangel, der augenblicklich herrscht, verleihen sie überhaupt nichts; aber angenommen, sie würden es tun …: Welche Art von Garantie könnten Sie bieten, Verehrteste?«
»Tadellose Schlussfolgerung«, bemerkte Michele; gerne hätte er sich für diese lebenswichtige Frage ereifert und protestiert. »Schließlich«, dachte er, »handelt es sich um unsere Existenz; es kann sein, dass wir von einem Augenblick auf den anderen nicht mehr wissen, wovon wir eigentlich leben sollen.« Aber trotz aller Anstrengung empfand er ihren Ruin als etwas Fremdes. Als sähe er jemanden ertrinken und schaute zu, ohne sich zu rühren.
Ganz anders die Mutter: »Gewähren Sie uns diesen Aufschub«, sagte sie stolz, in kerzengerader Haltung, und betonte jedes Wort, »und Sie können sich darauf verlassen, am Verfallstag kriegen Sie Ihr Geld, bis auf den letzten Centesimo, ohne jeden Zweifel.«
Leo lachte sanft, während er den Kopf neigte. »Das kann ja sein … Aber wozu dann der Aufschub? Warum nicht die Tricks, mit denen Sie das Geld in einem Jahr beschaffen wollen, jetzt gleich anwenden, um mich auszuzahlen?«
Das Gesicht gesenkt, wirkte er so ruhig und überlegen, dass der Mutter angst und bange wurde; ihre Augen irrten von Leo unentschlossen zu Michele und dann zu Carla; da waren sie, ihre beiden schwachen Kinder, die nun die Nöte der Armut erleben sollten; sie wurde plötzlich von übertriebener Mutterliebe erfasst: »Hören Sie, Merumeci«, begann sie in einschmeichelndem Tonfall, »Sie sind doch ein Freund der Familie, Ihnen kann ich alles sagen … Es geht ja nicht um mich, ich bitte nicht für mich um Aufschub; ich selbst wäre auch bereit, in einer Dachkammer zu hausen …« Sie hob den Blick zur Decke und fuhr fort: »Bei Gott, wenn ich an mich dächte …, aber ich muss doch Carla verheiraten … Sie kennen die Gesellschaft … An dem Tag, da ich die Villa verlassen und in irgendeine winzige Wohnung ziehen müsste, würden uns alle die kalte Schulter zeigen … Die Leute sind so … Finden Sie mir dann einen Mann für meine Tochter?«
»Ihre Tochter«, sagte Leo mit geheucheltem Ernst, »ist so schön, dass sie jederzeit Verehrer finden würde.« Er sah Carla an und zwinkerte ihr zu, aber eine tiefe, unterdrückte Wut erfüllte das Mädchen: »Wer soll mich denn heiraten«, hätte sie ihrer Mutter am liebsten ins Gesicht geschrien, »mit diesem Mann im Haus und bei deiner Verfassung?« Sie war gekränkt und verletzt durch die Unbefangenheit, mit welcher die Mutter, sonst nie sehr um sie bemüht, sie jetzt als nützliches Argument für ihre Zwecke ins Feld führte. Das alles musste ein Ende haben, sie würde sich Leo hingeben, und so würde niemand sie mehr zur Frau wollen. Sie schaute der Mutter in die Augen: »Lass mich aus dem Spiel, Mama«, sagte sie hart, »ich habe mit dieser Sache nichts zu tun, und so soll es auch bleiben.«
In diesem Augenblick ertönte aus der Ecke, wo Michele saß, ein bitteres und in seiner Falschheit schmerzliches Lachen; die Mutter wandte sich um. »Weißt du«, sagte er, wobei er sich anstrengte, seiner gleichgültigen Stimme einen sarkastischen Tonfall zu verleihen, »weißt du, wer uns als Erster verlassen wird, wenn wir aus der Villa ausziehen? Rate mal.«
»Ich weiß nicht.«
»Leo«, brach es aus ihm hervor, und er zeigte mit dem Finger auf den Mann, »unser Leo.«
Leo wollte protestieren. »Ach, Merumeci?«, entgegnete die Mutter beeindruckt und verunsichert, und sie blickte ihren Geliebten an, als wollte sie in seinem Gesicht lesen, ob er tatsächlich eines solchen Verrats fähig wäre. Dann plötzlich, mit pathetischem Sarkasmus in den Augen und im Lächeln, brach es aus ihr heraus: »Aber sicher …, natürlich, wie dumm von mir, dass ich nicht selbst draufgekommen bin …« An ihre Tochter gewandt wiederholte sie: »Natürlich, Carla, Michele hat recht … Der Erste, der so tun wird, als hätte er uns nie gekannt, natürlich erst, nachdem er das Geld kassiert hat, wird Merumeci sein … Nein, protestieren Sie nicht …« Ihr Lächeln wurde beleidigend: »Es ist ja nicht Ihre Schuld, so sind die Männer alle, ich könnte schwören, er wird mit einer seiner ach so reizenden und eleganten Freundinnen an mir vorbeistolzieren, und kaum sieht er mich, wird er den Kopf abwenden, natürlich, mein Lieber, dafür könnte ich die Hand ins Feuer legen …« Sie schwieg einen Augenblick. Dann schloss sie verbittert und resigniert: »Natürlich, schon Jesus wurde von seinen besten Freunden verraten.«
Unter diesem Schwall von Beschuldigungen legte Leo seine Zigarre ab: »Du bist ja noch ein Junge«, sagte er, an Michele gewandt, »deshalb nehme ich dich nicht ernst.« An die Mutter gewandt fuhr er fort: »Aber dass Sie, gnädige Frau, auf die Idee kommen, ich könnte wegen irgendeines Verkaufs meine besten Freunde verlassen, das hätte ich nicht erwartet, nein, wirklich, das nicht.« Er schüttelte den Kopf und griff wieder zu seiner Zigarre.
»Wie falsch er ist«, dachte Michele amüsiert. Dann wurde ihm plötzlich wieder klar, dass er der Bestohlene war, der Gefoppte, der Geschmähte, dass sein Erbe und seine Würde und die seiner Mutter auf dem Spiel standen. »Beschimpfen müsste man ihn«, dachte er, »eine Szene machen.« Er begriff, dass er an diesem Abend schon ein Dutzend besserer Gelegenheiten hatte verstreichen lassen, um einen Streit zu provozieren. Zum Beispiel, als Leo einen weiteren Aufschub verweigert hatte. Jetzt war es zu spät: »Das hättest du nicht erwartet, was?«, sagte er, lehnte sich im Sessel zurück und schlug die Beine übereinander. Er zögerte, dann fügte er ohne jede Regung hinzu: »Gauner.«
Alle wandten sich um, die Mutter überrascht, der Mann langsam, die Zigarre aus dem Mund nehmend: »Was hast du gesagt?«
»Ich will sagen«, hob Michele an und ergriff mit beiden Händen die Armlehnen seines Sessels, weil er in seiner Gleichgültigkeit nicht die Gründe fand, die ihn zu dieser vehementen Beschimpfung provoziert hatten. »Ich will damit sagen, dass Leo uns ruiniert hat und jetzt noch so tut, als wäre er unser Freund, obwohl er es nicht ist.«
Schweigen. Missbilligung. »Hör mal zu, Michele«, sagte Leo und schaute den Jungen aus zwei völlig ausdruckslosen Augen an, »mir ist schon vor einer Weile aufgefallen, dass du heute Abend Streit provozieren willst, warum, weiß ich nicht. Das tut mir leid, aber ich sag dir gleich, das klappt nicht. Wärest du ein Mann, dann wüsste ich, wie ich dir zu antworten hätte. Aber du bist ein verantwortungsloser Junge … Deshalb ist es das Beste, du gehst ins Bett und schläfst erst mal eine Nacht darüber.« Er schwieg und nahm wieder seine Zigarre. Dann fügte er plötzlich hinzu: »Und du fängst gerade jetzt damit an, wo ich drauf und dran bin, euch die günstigsten Bedingungen vorzuschlagen.«
Schweigen. »Merumeci hat recht«, warf nun die Mutter ein, »wirklich, Michele, er hat uns nicht ruiniert, und er ist immer unser Freund gewesen … Warum beschimpfst du ihn so?«
»Ach so«, dachte der Junge, »jetzt verteidigst du ihn!« Er war plötzlich zutiefst irritiert über sich selbst und die anderen. »Wenn ihr nur wüsstet, wie gleichgültig mir das alles ist«, hätte er ihnen am liebsten ins Gesicht geschrien. Sie alle, die aufgeregte und egoistische Mutter, der falsche Leo und sogar Carla, die ihn verdutzt ansah, erschienen ihm in diesem Augenblick lächerlich, aber gleichzeitig beneidenswert, weil sie in dieser Wirklichkeit verhaftet waren und das Wort »Gauner« als eine echte Beschimpfung erachteten, während für ihn dies alles, die Gesten, die Worte, die Gefühle, nur ein müßiges Schauspiel waren.
Nun wollte er jedoch seinen einmal begonnenen Weg bis zum Ende gehen: »Was ich gesagt habe, ist die reine Wahrheit«, verkündete er ohne Überzeugung.
Leo zuckte angewidert und missmutig die Schultern: »Tu mir einen Gefallen«, entfuhr es ihm, und er klopfte heftig die Asche seiner Zigarre ab, »tu mir nur diesen einen Gefallen …« Schon wollte die Mutter ihrem Geliebten mit einem »Du hast verdammt noch mal unrecht, Michele« beispringen, da öffnete sich hinten in der Ecke, wohin nur wenig Licht drang, ein Stück weit die Tür, und der blonde Kopf einer Frau erschien.
»Gestatten?«, fragte der Kopf, und alle drehten sich um. »Oh, Lisa«, rief die Mutter aus, »ja, komm nur herein!« Die Tür öffnete sich ganz, und Lisa trat ein. Ihr türkisfarbener Mantel umhüllte den fülligen Körper und reichte ihr bis fast zu den winzigen Füßen. Der Kopf mit dem runden, silberblauen Hütchen erschien noch kleiner über den breiten Schultern, die der Wintermantel zusätzlich betonte. Der Mantel war weit geschnitten, und doch zeichneten sich die Brust und die üppigen Hüften in einer Fülle schwellender und geschwungener Linien darunter ab. Hingegen erstaunten die Hände und die Füße durch ihre Feingliedrigkeit, und unter der wuchtigen Glocke des Mantels konnte man bemerkenswert schlanke Fesseln ausmachen.
»Störe ich auch nicht?«, fragte Lisa, während sie näher kam, »es ist spät, ich weiß, aber ich habe hier in der Nähe zu Abend gegessen, und da ich durch eure Straße kam, konnte ich der Versuchung nicht widerstehen, euch einen Besuch abzustatten, und so bin ich hier …«
»Ich bitte dich«, sagte die Mutter, sie stand auf und ging der Freundin entgegen. »Ziehst du den Mantel nicht aus?«, fragte sie.
»Nein«, entgegnete Lisa, »ich bleibe nur kurz, dann gehe ich wieder. Nun, ich werde ihn aufknöpfen, damit mir nicht zu warm wird.«
Sie machte den Gürtel auf, und ein auffälliges, glänzendes Kleid aus schwarzer Seide kam zum Vorschein, mit großen bläulich schimmernden Blumen. Sie begrüßte Carla, »guten Abend, Carla«, dann Leo, »ah, Merumeci ist auch da, unmöglich, ihn hier nicht zu treffen«, und Michele, »wie geht’s, Michele?« Dann setzte sie sich neben die Mutter auf das Sofa.
»Was hast du für ein schönes Kleid an«, sagte die Mutter und zog Lisas Mantel ein wenig auf. »Nun, was gibt es Neues?«
»Gar nichts«, entgegnete Lisa und blickte in die Runde. »Aber was macht ihr für komische Gesichter, man sollte meinen, ihr hättet euch gestritten und ich hätte euer Streitgespräch durch mein Kommen unterbrochen.«
»Aber nicht doch«, protestierte Leo und bedachte Lisa durch den Rauch seiner Zigarre hindurch mit einem heuchlerischen Blick. »Nicht doch, die allergrößte Fröhlichkeit hat hier bisher geherrscht.«
»Wir haben über alles und nichts gesprochen«, sagte die Mutter, nahm eine Zigarettenschachtel und hielt sie der Freundin hin. »Rauchst du?«
An diesem Punkt mischte sich Michele wie üblich zur Unzeit ein: »Was du sagst, ist die Wahrheit«, erklärte er, indem er sich vorbeugte und Lisa aufmerksam ansah, »wir haben uns gestritten, und du hast unser Streitgespräch unterbrochen.«
»Oh«, sagte Lisa mit einem gezwungenen, maliziösen Lächeln und fügte, ohne jedoch aufzustehen, hinzu: »Dann gehe ich. Nicht um alles in der Welt möchte ich einen Familienrat unterbrechen.«
»Das kommt überhaupt nicht in Frage«, widersprach die Mutter, und mit einer tadelnden Grimasse an Michele gewandt: »Dämlicher Kerl.«
»Ich dämlich?«, sagte der Junge und dachte: »Das steht mir gut an, ja, dämlich, zumal ich mich unbedingt für deine Angelegenheiten begeistern will.« Ein schreckliches Gefühl von Nutzlosigkeit und Schwermut überkam ihn, er ließ den Blick über den feindlichen Schatten des Salons gleiten, dann über die Gesichter der anderen. Leo schien ihn mit einem spöttischen Lächeln zu betrachten, wenn es auch auf seinen fleischigen Lippen kaum erkennbar war. Dieses Lächeln war unverschämt. Ein starker, ein normaler Mann hätte sich daran gestoßen und protestiert. Er hingegen nicht … Er blieb gleichgültig, mit diesem gewissen demütigenden Gefühl von Überlegenheit und mitleidiger Verachtung … Und doch begehrte er im Innern ein weiteres Mal gegen die eigene Ehrlichkeit auf. »Protestieren«, dachte er, »ihn erneut beschimpfen!«
Er schaute Leo an, und es brach mit farbloser Stimme aus ihm hervor: »Sag mal …, was gibt es da zu lächeln?«
»Ehrenwort«, hob Leo an, »ich …«, und er heuchelte die größte Verwunderung.
»Also«, sprach Michele und hob mit sichtlicher Anstrengung die Stimme. »Ja, so müsste man streiten«, dachte er jetzt und erinnerte sich an einen Wortwechsel, den er in der Straßenbahn verfolgt hatte, zwischen zwei gleichermaßen dicken und gewichtigen Herren. Jeder der beiden hatte die Anwesenden zu Zeugen aufgerufen und mit beredten Worten die eigene Ehrbarkeit, den Beruf und die Kriegsverletzungen ins Feld geführt, überhaupt alles, was die Zuhörerschaft in Rührung versetzen konnte, um am Ende den Gegner mit lautstarkem Gebrüll zu übervorteilen und sich in eine aufrichtige Wut hineinzusteigern. So musste er es auch machen. »Glaub nicht, ich sei, nur weil Lisa gekommen ist, nicht in der Lage zu wiederholen, was ich vorher gesagt habe, von wegen, ich wiederhole es: Gauner!«
Alle sahen ihn an. »Also wirklich …«, platzte die Mutter entrüstet heraus.
Lisa betrachtete Michele neugierig. »Wieso? Was ist denn geschehen?«, fragte sie. Leo unterdessen rührte sich nicht und ließ auch kein Anzeichen von Kränkung erkennen. Er stieß lediglich ein falsches, lautes und verächtliches Lachen aus. »Na, das ist ja reizend«, sagte er, »geradezu reizend, nicht einmal mehr lächeln darf man …« Dann fügte er abrupt hinzu: »Jetzt hat der Spaß aber ein Ende.« Er erhob sich aus seinem Sessel und schlug mit der Faust auf den Tisch: »Es reicht … Entweder entschuldigt sich Michele bei mir, oder ich gehe.« Alle begriffen, dass die Angelegenheit jetzt ernst wurde und jenes Lachen bloß der bläuliche Blitz war, der dem Donner vorausgeht.
»Merumeci hat vollkommen recht«, sagte die Mutter mit harter Miene und in gebieterischem Ton. Das Verhalten ihres Sohnes reizte sie bis zur Weißglut, und sie fürchtete, der Geliebte könnte diese Situation nutzen, um mit ihnen zu brechen. »Dein Verhalten ist geschmacklos … Ich befehle dir, dich zu entschuldigen …«
»Aber ich versteh nicht …, warum ist Merumeci ein Gauner?«, fragte Lisa in dem offensichtlichen Begehren, die Situation noch zu verschlimmern. Einzig Carla rührte sich nicht und sprach kein Wort. Ein elender und unangenehmer Widerwille bedrückte sie. Ihr war, als schwappe die beängstigende Flut der ganzen kleinen Ereignisse dieses Tages jeden Augenblick über sie hinweg und spüle ihre Geduld fort. Sie senkte leidend die Lider und betrachtete die dümmlichen, gereizten Gesichter der anderen vier.
»Oho«, entgegnete Michele ironisch, ohne sich zu rühren. »Du befiehlst es mir? Und wenn ich nicht gehorche?«
»Dann«, antwortete Mariagrazia, nicht ohne eine gewisse pathetische und theatralische Würde, »würdest du deiner Mutter Kummer machen.«
Für einen Augenblick schaute er sie an, ohne zu sprechen. »Du würdest deiner Mutter Kummer machen«, wiederholte er still für sich, und der Satz schien ihm zugleich lächerlich und tiefsinnig. »Nun«, dachte er mit aufgesetztem Widerwillen, »es handelt sich um Leo, ihren Geliebten, und doch zögert sie nicht, sich als Mutter mit einzubringen. Aber der Satz lautete: Du würdest deiner Mutter Kummer machen. Widerwärtig und zugleich unwiderlegbar.« Er wandte den Blick von dem sentimentalen Gesicht der Mutter ab. Auf einmal vergaß er all seine Vorsätze, aufrichtig und zornig zu sein. »Ach«, dachte er, »schließlich ist mir doch alles gleichgültig … Warum soll ich mich nicht entschuldigen und ihr diesen verdammten Kummer ersparen?« Er hob den Blick, aber er wollte die Wahrheit sagen, den anderen seine ganze freche Gleichgültigkeit beweisen. »Und ihr glaubt also«, begann er, »dass ich nicht fähig sei, mich bei Leo zu entschuldigen? Also, wenn ihr wüsstet, wie gleichgültig mir das alles ist.«
»Das sagt man so dahin«, unterbrach ihn die Mutter.
»Wie wenig mir all das bedeutet«, fuhr Michele aufgeregt fort, »könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen … Mithin brauchst du dich nicht zu ängstigen, Mama … Wenn du willst, entschuldige ich mich nicht nur bei Leo, nein, ich küsse ihm auch die Füße.«
»Nein, entschuldige dich nicht«, bemerkte in diesem Moment Lisa, welche die Szene mit allergrößter Aufmerksamkeit verfolgt hatte. Alle schauten sie an. »Ich danke dir herzlich, Lisa«, fiel die Mutter gekränkt und theatralisch ein. »Dafür, dass du meinen Sohn gegen mich aufhetzt.«
»Wer hetzt deinen Sohn gegen dich auf?«, entgegnete Lisa ruhig. »Aber ich glaube, es ist nicht der Mühe wert.«
Leo sah sie aus dem Augenwinkel an. »Es passt mir nicht, von einem Jungen so beschimpft zu werden«, sagte er mit harter Stimme. »Ich habe eine Entschuldigung verlangt, und ich werde sie bekommen.«
»Wäre es nicht das Beste, alles zu vergessen und sich wieder zu vertragen?« Carla hatte ihr halb naives, halb entnervtes Gesicht nach vorne gebeugt.
»Nein«, sagte die Mutter, »Merumeci hat recht. Michele muss sich bei ihm entschuldigen.« Michele stand auf. »Das werde ich tun, keine Sorge. Also, Leo«, sagte er zu dem Mann, »ich entschuldige mich aufrichtig dafür, dich beschimpft zu haben.« Einen Moment zögerte er; wie leicht ihm diese demütigenden Worte über die Lippen gegangen waren! »Und ich verspreche dir, dass ich es nicht wieder tun werde«, endete er mit der ruhigen Stimme und der Gleichgültigkeit eines sechsjährigen Kindes.
»Schon gut, schon gut«, sagte Leo, ohne ihn anzusehen.
»Dummkopf«, hätte Michele ihm gerne ins Gesicht geschrien, als er ihn jetzt so sicher in seiner Rolle verankert sah. Aber vor allem war die getäuschte Mutter zufrieden: »Michele ist ein guter Sohn«, sagte sie, indem sie ihn mit plötzlicher Zärtlichkeit für den Jungen ansah. »Michele hat seiner Mutter gehorcht.«
Die Schamesröte der Demütigung, welche zuvor, als er sich bei Leo entschuldigt hatte, noch nicht auf Micheles Wangen getreten war, flammte angesichts dieses Unverstandes plötzlich auf: »Ich habe getan, was ihr wolltet«, sagte er brüsk, »und jetzt gestattet, dass ich zu Bett gehe, denn ich bin müde.« Er wandte sich wie eine Marionette auf dem Absatz um und trat, ohne jemanden zu grüßen, in den Flur hinaus. In dem Augenblick jedoch, als er durch die Halle schritt, bemerkte er, dass ihm jemand hinterhergerannt kam. Er drehte sich um; es war Lisa. »Ich bin heute Abend hierhergekommen«, sagte sie atemlos und bedachte ihn mit einem neugierigen und leidenschaftlichen Blick, »um dir zu sagen, dass ich dich diesem Verwandten von mir, wann immer du magst, vorstellen kann … Er könnte dir eine Arbeit besorgen … in seiner Firma oder sonst wo.«
»Danke sehr«, sagte Michele und betrachtete sie seinerseits.
»Du musst aber zu mir nach Hause kommen, damit ich euch vorstellen kann.«
Im gleichen Maße, in dem Lisas Verlegenheit wuchs, wurde der Junge ruhiger und nüchterner. »Wann?«
»Morgen«, sagte Lisa. »Komm morgen Vormittag, möglichst früh … Er wird gegen Mittag eintreffen, aber das spielt keine Rolle … Wir werden ein bisschen reden, nicht wahr?« Sie schwiegen beide und schauten sich an. »Und warum hast du dich bei Leo entschuldigt?«, fragte sie plötzlich erregt. »Du hättest es nicht tun dürfen.«
»Wieso?«, fragte er. »Ach«, dachte er, »darauf wolltest du hinaus.«
»Es würde zu lange dauern, dir das jetzt zu erklären«, sagte Lisa, und ihre Stimme nahm auf einmal einen sehr geheimnisvollen Tonfall an. »Wenn du morgen kommst, erfährst du es.«
»Nun gut … dann also bis morgen«, entgegnete Michele, gab ihr die Hand und wandte sich zur Treppe.
Lisa kehrte in den Salon zurück; die anderen drei hatten sich in der Ecke unter dem Lampenschirm versammelt. Die Mutter, die in all ihrer Farbenpracht im vollen Licht saß, sprach von Michele: »Es ist offensichtlich«, erklärte sie ihrem Geliebten, der sich im Sessel zurückgelehnt hatte und sie mit völlig stumpfem Blick ansah, ohne mit der Wimper zu zucken, »dass es ihn sehr viel gekostet hat, sich zu entschuldigen … Er ist nicht von der Sorte, die leicht nachgibt … Er ist stolz.« Ihr Ton wurde herausfordernd. »Stolz und geradeheraus, so wie ich.«
»Daran zweifle ich nicht«, sagte Leo, hob die Augenlider und warf Carla einen langen Blick zu. »Aber dieses Mal hat er gut daran getan nachzugeben.« Alle drei schwiegen. Der Vorfall hatte sich erschöpft. Mit leisen Schritten, als ginge sie das alles gar nichts an, trat Lisa hinzu.
»Sind Sie mit dem Wagen da, Merumeci?«, fragte sie.
Die drei wandten sich um. »Mit dem Wagen«, wiederholte der Mann überrascht. »Ja sicher, mit dem Wagen.«
»Dann fahren Sie mich nach Hause«, sagte Lisa, »wenn es Ihnen nichts ausmacht.«
»Ich bitte Sie, es wird mir ein Vergnügen sein.« Leo erhob sich und knöpfte die Jacke zu. »Dann wollen wir mal«, hob er an, aber innerlich glühte er. Nicht nur, dass er bei Carla nichts hatte ausrichten können, jetzt musste er auch noch Lisa nach Hause begleiten.
Doch die unfassbare Eifersucht der Mutter kam ihm zu Hilfe. Zwischen Leo und Lisa hatte es viele Jahre zuvor eine Liebesbeziehung gegeben, sie wollten sogar heiraten. Dann war sie, bereits Witwe, auf den Plan getreten und hatte der besten Freundin den Verlobten weggeschnappt. Das war eine sehr alte Geschichte, aber … Wenn es den beiden in den Kopf käme, wieder anzubändeln? Sie wandte sich an Lisa: »Nein, geh nicht gleich«, sagte sie, »ich habe mit dir zu reden.«
»Ja gut«, entgegnete Lisa und täuschte Verlegenheit vor. »Aber dann kann Merumeci mich nicht mehr nach Hause begleiten.«
»Oh, darüber machen Sie sich keine Sorgen«, erklärte Leo, und diesmal war es ihm wirklich ein Vergnügen. »Ich kann im Flur warten oder hier. Reden Sie nur mit Ihrer Freundin, ich werde auf Sie warten.« Und mit Blick auf die Tochter fügte er hinzu: »Carla wird mir Gesellschaft leisten.«
Carla erhob sich langsam, nickte mit ihrem großen Kopf und kam näher. »Wenn ich jetzt bei ihm bleibe«, dachte sie, »ist alles aus.« Leo sah sie verschwörerisch an, wie ihr schien, und dieses unterstellte Einverständnis war ihr zuwider. Aber was hätte es genützt, sich zu sträuben? Eine schmerzliche Ungeduld ergriff von ihr Besitz. »Mit allem ein Ende machen«, wiederholte sie für sich und ließ den Blick über den düsteren Salon streifen, wo so viele verheißungsvolle Tage dahingegangen waren. Die Gruppe, die sie um den Lampenschirm bildeten, kam ihr steif und lächerlich vor. Mit all dem hier ein Ende machen, dachte sie wieder, und in ihrer zögerlichen Selbstaufgabe schien sie einer Feder gleich, die ein Treppenhaus hinabtrudelte.
Daher protestierte sie nicht, sprach sie nicht.
»Aber Sie wissen doch nicht, wie lange ich Lisa aufhalten werde«, widersetzte sich die Mutter. »Gehen Sie nur, fahren Sie. Für Lisa werden wir später ein Taxi rufen.« Ihre Stimme war einschmeichelnd, die Stimme der Eifersucht. Leo war freundlich, aber unnachgiebig. »Ich werde warten, was soll’s? Eine Minute mehr oder weniger. Ich warte gerne.«
Die Mutter begriff, dass sie verloren hatte. Sie würde die beiden, Leo und Lisa, nicht trennen können. »Klar«, dachte sie, »er will auf sie warten, um dann mit zu ihr nach Hause zu gehen.« Sie musterte ihre Gesichter. Dieser Gedanke erschien ihr entsetzlich. Sie wurde noch blasser, und die Eifersucht flammte unverhohlen in ihren Augen auf. »Nun gut«, sagte sie schließlich, »dann gehen Sie, warten Sie draußen, ich werde Ihnen Ihre Lisa nicht lange vorenthalten, da brauchen Sie überhaupt keine Sorge zu haben.« Sie machte mit der Hand eine drohende Geste, und um ihre Lippen zitterte ein bitterböses Lächeln. Leo sah sie mit undurchdringlichem Blick an, zuckte mit den Schultern und ging wortlos, gefolgt von Carla, hinaus.
Im Flur legte er, als wenn es nichts wäre, den Arm um die Taille des Mädchens. Sie bemerkte es, widerstand aber der Versuchung, sich ihm zu entwinden. »Das ist das Ende«, dachte sie, »das Ende meines alten Lebens.« Im Schatten glänzten die Spiegel und reflektierten im Vorbeigehen ihre aneinandergerückten Gestalten.
»Hast du bemerkt«, sagte sie laut. »Mama ist eifersüchtig auf Lisa …« Anstelle einer Antwort drückte der Mann ihre Flanke mit dem Arm fester an seinen harten Körper. So vereint traten sie ins Vestibül, einen engen Raum mit hohen, weißen Wänden und einem Fußboden mit Rautenmuster.
»Wer weiß«, fügte sie herablassend hinzu, als habe es keine weitere Bedeutung, »wer weiß, ob das nicht berechtigt ist.« Diesmal blieb der Mann stehen und wandte sich ihr zu, ohne sie loszulassen.
»Weißt du«, sagte er mit einem dümmlichen, plump erregten Lächeln, »auf wen sie eigentlich eifersüchtig sein sollte? Auf dich … ja, auf niemand anderes …«
»Jetzt haben wir’s«, dachte sie. »Auf mich? Wieso?«, fragte sie mit klarer Stimme. Sie schauten sich an. »Wirst du zu mir kommen?«, fragte Leo sie in fast väterlichem Ton. Er sah, wie sie den Kopf senkte und weder Ja noch Nein zu antworten schien. »Das ist der richtige Augenblick«, dachte er. Schon zog er sie an sich und war drauf und dran, sich hinterzubeugen und sie zu küssen, als Stimmen im Flur ihn warnten, dass die Mutter im Anmarsch war. Er erstickte beinahe vor Wut; das war jetzt das zweite Mal an diesem Tag, dass seine Geliebte im entscheidenden Moment alles verdarb. »Soll sie doch der Teufel holen«, dachte er. Man konnte ihre Stimme hören; sie war mit Lisa im Flur ins Gespräch verwickelt. Obwohl sie noch nicht an der Tür erschien, machte Carla, die jetzt unruhig geworden war, Anstalten, sich ihm zu entziehen. »Lass mich«, sagte sie, »Mama kommt.« Rasend schaute Leo sich um, sah zur Tür und konnte sich doch nicht dazu entschließen, diese biegsame Taille loszulassen. Da fiel sein Blick auf einen Vorhang rechts im Vestibül, hinter dem sich ein Ausgang verbarg. Er streckte den Arm aus, löschte das Licht. »Komm«, flüsterte er in der Dunkelheit und versuchte Carla in dieses Versteck zu zerren. »Komm da hinein, wir spielen deiner Mutter einen Streich.« Sie begriff nicht, widersetzte sich; ihre Augen leuchteten im Halbdunkel. »Wieso denn … wieso?«, wiederholte sie. Aber am Ende gab sie nach. Sie traten hinter den Vorhang und pressten sich in die Türnische. Leo schlang wieder seinen Arm um die Taille des Mädchens. »Jetzt wirst du sehen«, flüsterte er; aber Carla sah nichts. Aufrecht und steif stand sie da und schloss die Augen in der nachtschwarzen Dunkelheit hinter dem schweren, staubigen Vorhang und ließ es geschehen, dass Leos Hand über ihre Wangen und ihren Hals strich. »Jetzt wirst du sehen«, wisperte er; der Vorhang erzitterte von oben bis unten, und sie spürte, wie die Lippen des Mannes sich auf ihre Brust zu einem innigen Kuss von kurzer Dauer drückten und plump bis zu ihrem Kinn glitten, um schließlich auf ihrem Mund zu verweilen. Die Stimmen kamen näher, Leo schnellte wieder hoch. »Da ist sie«, flüsterte er, und sein Arm drückte sie in der Dunkelheit mit einer intimen und vertraulichen Kraft an sich, mit einer Sicherheit, die ihm zuvor gefehlt hatte.
Die Glastür öffnete sich; Carla schob den Vorhang ein wenig zur Seite und sah hindurch. Im erleuchteten Rahmen der offenen Tür schien die Gestalt der Mutter mit ihren tiefen Schlagschatten Erstaunen und Unverständnis auszudrücken: »Aber hier sind sie nicht«, rief ihre vertraute Stimme, und Lisa, die nicht zu sehen war, fragte vom Flur aus: »Wo sind sie denn hingegangen?«
Die Frage blieb ohne Antwort. Der Kopf der Mutter war angespannt, streckte sich vor, um das Vestibül auszukundschaften. Der Schatten ließ ihre Züge schärfer hervortreten und machte aus dem weichen, stark geschminkten Gesicht eine steinerne Maske pathetischer Verwirrung. Jede Falte, der offene Mund, starrend vor Schminke, die weit aufgerissenen Augen, das ganze Gesicht schien zu schreien: »Leo ist nicht mehr da …, Leo hat mich verlassen …, Leo ist gegangen.« Carla betrachtete sie mit einer Mischung aus Mitleid und Neugier. Sie spürte die Angst, die hinter dieser Maske zitterte, und sie glaubte schon das Gesicht jener Tage zu erkennen, wenn die Mutter vom Betrug des Geliebten mit ihrer Tochter erfahren würde. Dieses Schauspiel währte einen Augenblick; dann zog sich der Kopf zurück. »Seltsam«, hörte man noch ihre Stimme sagen, »Merumecis Mantel ist noch da, aber sie sind weg.«
»Vielleicht sind sie in der Diele«, warf Lisa ein, und so entfernten sie sich unter allerlei ungläubigen Vermutungen.
»Hast du gesehen?«, flüsterte Leo. Von Neuem beugte er sich hinab und presste das Mädchen an seine Brust. »Das ist das Ende«, dachte sie wieder und bot ihm den Mund dar. Ihr gefiel diese Dunkelheit, die sie daran hinderte, den Mann zu sehen, und ihr all ihre Illusionen beließ. Sie mochte dieses Täuschungsmanöver; dann trennten sie sich. »Und jetzt gehen wir hinaus«, flüsterte sie und öffnete den Vorhang mit den Händen. »Gehen wir, Leo, sonst merken sie noch was.«
Er folgte ihr widerwillig, und einer nach dem anderen kamen sie wie zwei Räuber aus ihrem Versteck. Im Lichtschein betrachteten sie sich: »Ist meine Frisur zerwühlt?«, fragte Carla. Er schüttelte den Kopf. Sie fügte hinzu: »Und was sagen wir jetzt Mama?«
Grobschlächtige Häme trat auf das erregte rote Gesicht des Mannes; er klopfte sich auf den Schenkel und lachte: »Ha, das war fein«, rief er, »wunderbar … Was wir ihnen sagen? Na, dass wir hier waren natürlich, die ganze Zeit.«
»Nein, Leo«, sagte Carla, schaute ihn zweifelnd an und verschränkte die Arme vor ihrem Bauch, »wirklich?«
»Wirklich«, wiederholte er. »Ach, da sind sie ja.«
Die Tür öffnete sich, und die Mutter erschien wieder. »Aber hier sind sie ja«, rief sie und wandte sich zu Lisa. »Und wir haben sie im ganzen Haus gesucht. Wo wart ihr denn?«
Leo machte eine verwunderte Geste. »Wir waren die ganze Zeit hier.«
Die Mutter sah ihn an wie einen armen Irren. »Reden Sie keinen Unsinn, ich bin soeben hier gewesen, und da war keiner, und alles war dunkel.«
»Dann«, sagte der Mann ruhig, während er den Mantel vom Kleiderhaken nahm, »kann das nur bedeuten, dass Sie an Halluzinationen leiden. Wir sind die ganze Zeit hier gewesen.« Zu dem Mädchen gewandt fügte er hinzu: »Nicht wahr, Carla?«
»Stimmt genau«, antwortete sie nach einem kurzen Zögern.
Es folgte eine bedrohliche Stille. Die Mutter hatte den Eindruck, dass alle sich über sie lustig machten, aber es gelang ihr nicht, die Gründe zu begreifen. Sie vermutete geheime Absprachen und dunkle Machenschaften. Unschlüssig, irritiert, spann sie ein Netz forschender Blicke zwischen Leo, Carla und Lisa.
»Sie sind verrückt«, sagte sie schließlich. »Vor fünf Minuten war hier niemand. Lisa kann das bezeugen, sie war bei mir«, fügte sie hinzu, mit dem Finger auf die Freundin weisend.
»Das ist wahr, hier war niemand«, sagte jene ruhig.
Wieder Schweigen. »Und Carla ist Zeugin, dass wir hier waren«, sagte Leo; und indem er einen anzüglichen Blick in Richtung des Mädchens warf, fügte er hinzu: »Das ist die reine Wahrheit, nicht wahr, Carla?«
»Es ist wahr«, gestand sie verwirrt und wurde sich zum ersten Mal der Tatsache bewusst, dass sie ohne jeden Zweifel, als die Mutter den Kopf zur Tür reingesteckt hatte, dort im Vestibül gewesen waren.
»Nun gut«, sagte die Mutter bitter, »gut, gut … Ihr habt recht, ich bin verrückt und Lisa auch.« Sie schwieg einen Augenblick.
»Dass Leo sich solche Scherze erlaubt«, brach es plötzlich, an Carla gewandt, aus ihr hervor, »ist seine Sache …, aber dass du dich über mich lustig machst, dafür solltest du dich schämen …, schöner Respekt vor deiner Mutter …«
»Aber es ist die reine Wahrheit, Mama«, protestierte Carla; jetzt wurde der Scherz schmerzhaft; wie ein Stachel drang er in die Unruhe, die sie erfüllte. »Wir waren im Vestibül«, hätte sie gerne hinzugefügt, »wir waren hinter dem Vorhang, ich und Leo, Arm in Arm.« Und sie stellte sich die Szene vor, die es bei diesen Worten gegeben hätte; aber es wäre die letzte gewesen, dann hätte alles ein Ende gehabt.
Jetzt sagte Lisa mit gelangweilter Miene: »Wollen wir gehen, Merumeci?« Und der Mann, bereit aufzubrechen, reichte der Mutter die Hand: »Denken Sie noch einmal darüber nach«, konnte er sich nicht verkneifen zu sagen und dabei zu lächeln. »Denken Sie die ganze Nacht darüber nach.« Worauf die Mutter mit einem Achselzucken entgegnete: »Nachts schlafe ich.« Dann umarmte sie Lisa und sagte leise zu ihr: »Also, denk daran, was ich dir gesagt habe.« Das Mädchen öffnete die Tür, und ein kalter Windhauch drang ins Vestibül. Die beiden traten heraus und verschwanden.