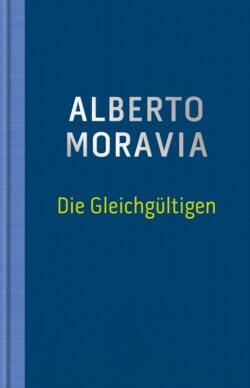Читать книгу Die Gleichgültigen - Alberto Moravia - Страница 7
ОглавлениеKAPITEL 5
Bei Lisa zu Hause schliefen keine Bediensteten. Sie wollte das nicht, und für die unvermeidlichen Dinge wie Kochen und Saubermachen ließ sie ein emsiges Wesen kommen, die Portiersfrau des Hauses. Dieses System funktionierte natürlich nicht ohne Unannehmlichkeiten, doch Lisa, die ein sehr freizügiges, ja ausschweifendes Leben führte, war es lieber so.
An diesem Morgen wachte sie spät auf. Seit geraumer Zeit kam sie erst nach Mitternacht heim, schlief freudlos und stand beinahe müder und nervöser auf als tags zuvor. Sie erwachte nur mühsam, und ohne sich zu bewegen oder den Kopf zu heben, blickte sie sich um: Eine spärliche, staubige Dunkelheit, durchlöchert wie ein Sieb von tausend Lichtstrahlen, erfüllte das Zimmer. In diesem Schatten erahnte man, als wären sie stumm und tot, die alten Möbel, die stillen Spiegel, die Kleidungsstücke, aufgehängt an dem dunklen Fleck, der Türe. Die Luft war schwer, sowohl vom Geruch des Schlafs wie von dem des Hausrats. Das Fenster war geschlossen. Lisa stand auf, ordnete ihr Haar, das ihr übers schweißgebadete Gesicht herunterhing, ging zum Fenster und öffnete die Läden. Ein weißer Tag flutete ins Zimmer. Sie schob die Gardine beiseite. Die Scheiben waren alle mit Wasserdampf beschlagen, es musste kalt sein. Durch diesen Nebel erahnte man die sanften, zarten, reinen Farben, ein Weiß, ein Grün, als wären sie in einer Wasserlache aufgelöst. Sie zerriss mit der Hand diesen flüssigen Schleier und sah sofort auf ein rötliches Dach, das so bar jeden Glanzes war, so trist und so verhangen, dass sie gar nicht erst hinaufzublicken brauchte, um festzustellen, ob der Himmel grau war. Sie löste sich, ging mechanisch ein paar Schritte durch das überfüllte Zimmer. Das große Ehebett aus ordinärem dunklem Nussbaum, vollgestopft mit zerwühlten weißen Laken, nahm viel Raum ein und stand so dicht neben dem rechteckigen Fenster, dass es ihr in manchen Winternächten, wenn sie unter den warmen Decken lag, richtig Spaß machte zu sehen, wie nur einen Meter von ihr entfernt die Regenfluten aus den Wolkenbrüchen der unendlichen Nacht an den quadratischen Scheiben herabströmten. Außer dem Bett gab es noch zwei große Schränke aus dem gleichen gewöhnlichen und übel riechenden Holz, mit riesigen angegilbten Spiegeln. Das Zimmer war von mittlerer Größe, doch bei diesen Möbeln war der Platz, der verblieb, um sich zu bewegen, ausgesprochen knapp.
Sie ging zum Kleiderständer. Sie hatte nur ein durchsichtiges Hemd an, das die Wölbungen des Körpers noch kürzer machte, die Beine waren bis zu der tiefen Falte zwischen den ausladenden Pobacken und den weißen härchenlosen Schenkeln gänzlich unverhüllt. Die muskulösen Brüste, die kaum tiefer hingen als im Alter von zwanzig, quollen in zwei glatten durchäderten Schwellungen halb hervor. So annähernd nackt sah sie sich in einem Spiegel, weit nach vorne gebeugt, als wollte sie unterhalb dieses viel zu kurzen Schleiers den dunklen Flecken des Schoßes verbergen, und sie befand, dass sie abgenommen habe, zog einen Morgenmantel über und ging ins Bad.
Dieses war ein kleiner, grauer, kahler und kalter Raum, die Rohre waren matt lackiert, die Wanne aus emailliertem Metall, es gab nur einen einzigen, ziemlich rostigen Spiegel, ein feuchter Schatten lag in den Ecken. Lisa knipste das Licht an. Ihr fiel ein, dass es drei Tage her war, seit sie sich zuletzt am ganzen Körper gewaschen hatte, und dass es an der Zeit wäre, ein Bad zu nehmen. Sie zögerte. War es wirklich unumgänglich? Sie betrachtete ihre Füße: Die Nägel waren weiß und sahen sauber aus. Nein, es war durchaus nicht an der Zeit, zumal sie, was wahrscheinlich war, die Nacht mit Michele verbringen würde, und dann musste sie sich tags darauf gründlich reinigen. Sie traf ihren Entschluss, ging zu einem an der Wand befestigten Waschbecken, drehte die Hähne auf und wartete, bis es sich gefüllt hatte. Nun zog sie den Morgenmantel aus, streifte das Hemd bis zur Hüfte hinunter und wusch sich. Zuerst schnaubend und prustend das Gesicht, dann, mit Bewegungen, die das Wasser daran hindern sollten, die Brust und die Schultern zu den unteren, immer noch nachtwarmen Partien hinunterzulaufen, Hals und Achselhöhlen. Jedes Mal, wenn sie sich bückte, spürte sie, wie das Hemd ihren Rücken hochrutschte, eine Eiseskälte stieg von den Steinfliesen des Fußbodens auf: Zuletzt fand sie das Handtuch nicht und entfloh völlig blind und nackt, um aus dem Schlafzimmer ein neues zu holen.
Sie trocknete sich ab, setzte sich an den Toilettentisch. Kurzes Frisieren. Sie verwendete keine Pomaden, auch kein Schminkzeug, sie musste nur ein bisschen Puder auflegen, sich parfümieren und kämmen: Am Ende drehte sie dem Spiegel den Rücken zu und bückte sich, um die Strümpfe überzustreifen. jetzt gingen ihr abwechselnd zwei Gedanken durch den Kopf, der ans Frühstück und der an Michele. Sie mochte es, morgens beim Espresso köstliche Dinge zu essen, süße Konfitüren, kleine Teilchen, Butter, Krokant. Sie war naschsüchtig und konnte sich vom Tisch erst losreißen, wenn sie satt war. Doch heute, befürchtete sie, würde sie nüchtern bleiben müssen. »Wenn Michele in Kürze kommt«, dachte sie, »findet er mich besser nicht beim Essen vor … Was soll’s, dann eben ein anderes Mal.« Sie richtete sich auf, zog eine rosafarbene Garnitur an, dann einen Unterrock mit einem so engen Mieder, dass ihre Brust wie von einem Korsett eingeschnürt wurde. In ihrer Fantasie entstand, gleichsam zum Trost, das Bild eines bis über beide Ohren verliebten und schüchternen Michele, eines jungen, unerfahrenen Mannes, dem sie sich freudig zitternd hingeben würde. Endlich eine reine Liebe: »Nach dem Leben, das ich geführt habe«, dachte sie tief überzeugt, »tut ein bisschen Naivität ganz gut.« Schlaflose Nächte, ermüdende Vergnügen, freudlose Erregungen, dieser schmutzige Nebel verzog sich. Michele brachte ihr die Sonne, den blauen Himmel, die Offenheit, die Begeisterung, er würde sie achten wie eine Göttin, würde seinen Kopf auf ihre Knie legen. Sie empfand ein unstillbares Verlangen danach und konnte die Stunde kaum erwarten, da sie aus diesem Jungbrunnen trinken, zu dieser neuen Liebe zurückkehren würde, stammelnd, schamhaft, wie seit zwanzig Jahren nicht mehr. Michele war die Reinheit selbst: Sie würde sich diesem Jungen in aller Keuschheit hingeben, fast leidenschaftslos. Splitternackt würde sie ihm mit tänzelnden Schritten entgegengehen und sagen: »Nimm mich!« Es würde eine absolut ungewöhnliche Liebe sein, wie es sie nicht mehr gab.
Sie hatte sich fertig angezogen, verließ das Zimmer, ging durch den dunklen Korridor, betrat ihr lichterfülltes Boudoir. Dieses Zimmer war ganz in Weiß und Rosa gehalten. Weiß die Möbel und die Zimmerdecke, rosa die Teppiche, die Übergardinen, das Sofa. Drei große, anmutig verhangene Fenster verströmten ein ruhiges Licht. Auf den ersten Blick erschien alles rein und unschuldig, fielen tausend hübsche Dinge ins Auge, hier ein Stickkorb, dort eine kleine Bibliothek mit bunt eingebundenen Büchern, dann zarte Blumen auf lackierten Ablagen, Aquarelle unter Glas an den Wänden, kurz, eine Anzahl von Gegenständen, die einen zunächst denken ließen: »Ach, was für ein entzückender Ort, so hell und heiter, hier kann doch nur ein junges Mädchen wohnen.« Sah man jedoch genauer hin, änderte man seine Meinung. Dann merkte man nämlich, dass das Boudoir nicht jünger war als die übrige Wohnung, dann fiel auf, dass der Lack der Möbel abgeplatzt und vergilbt war, dass die Tapeten verblasst waren und hier und dort verschlissen, dass ein abgenutzter Stoff und schmuddelige Kissen das Ecksofa bedeckten. Noch ein Blick, und man war überzeugt: Es zeigten sich Risse in den Gardinen, Sprünge in den Glasscheiben der Aquarelle, die Bücher waren staubig und zerfleddert, und die Zimmerdecke bröckelte großflächig ab. War dann noch die Dame des Hauses anwesend, brauchte man gar nicht erst zu suchen, der ganze Verfall sprang einem ins Auge, wenn man die Frau nur ansah.
Lisa setzte sich an den Schreibtisch und wartete. Jetzt kehrte der Gedanke ans Frühstück zurück, sie hatte großes Verlangen danach, wusste aber nicht, wie sie’s anstellen sollte: »Wenn ich wenigstens wüsste, wann er kommt«, dachte sie missvergnügt, als sie auf die Uhr sah, die sie am Handgelenk trug. Doch schließlich wusste sie sich zu beherrschen, verzichtete erneut und kehrte zu ihren zärtlich grausamen und erregten Fantasien zurück. »Ich werde ihn auf dem Sofa Platz nehmen lassen«, dachte sie unvermittelt, »und ich werde mich hinter ihn legen …, wir werden ein bisschen plaudern …, dann werde ich ihn auf irgendein heikles Thema stoßen … und ihn ansehen …, wenn er nicht ganz unterbelichtet ist, wird er das verstehen.« Sie betrachtete das Sofa wie ein Instrument, dessen Güte und Wirksamkeit es zu bewerten galt. Und wenn alles gut ging, würde sie den jungen Mann warten lassen, um des subtilen Vergnügens willen, ihn seufzen zu sehen, und am Ende, nach ein paar Tagen, würde sie ihn zum Abendessen einladen und die ganze Nacht über bei sich behalten. Was für ein Abendessen würde das sein: Delikatessen und vor allem Wein. Sie würde jenes Kleid tragen, das ihr so gut stand, azurblau, und sie würde sich mit den wenigen Juwelen schmücken, die sie vor den Klauen ihres Exmannes hatte retten können. Der Tisch würde hier gedeckt sein, im Boudoir, das Esszimmer war weniger intim: ein Tisch für zwei Personen, voller köstlicher Dinge, Fisch, Pasteten aus Fleisch und Gemüse, Süßspeisen. Eine kleine Tafel, reichhaltig und glänzend, für zwei, nur zwei Personen, eine dritte würde nicht mehr hinpassen, nicht einmal, wenn man wollte … Mit dem Glanz der Freude und der Zärtlichkeit in den Augen würde sie sich ihrem teuren Jungen gegenübersetzen, auch wenn sie äße, würde sie nicht aufhören, ihn anzusehen, sie würde ihm Wein eingießen, viel Wein, sie würde in heiterem, neugierigem, anzüglichem, mütterlichem Ton mit ihm sprechen. Sie würde sich nach seinen kleinen Liebschaften erkundigen, würde ihn erröten machen. Sie würde ihm hin und wieder freundlich zuzwinkern, sie würden sich unter dem Tisch mit den Füßen berühren. Nach dem Abendessen würden sie gemeinsam den Tisch abräumen, dabei lachen, sich berühren und sich streiten, und das nur aus dem Verlangen heraus, sich zu besitzen. Danach würde sie sich entkleiden, einen Morgenmantel überstreifen und Michele einen der Pyjamas ihres Mannes anziehen lassen. Der würde ihm prächtig stehen, sie hatten beide die gleiche Statur, obwohl der Junge feingliedriger war. Auf dem Sofa sitzend, würden sie und Michele die verwirrende, die hinhaltende Freude dieses Vorabends ihrer ersten Nacht kennenlernen … und schließlich würden sie gemeinsam ins Schlafzimmer gehen.
Ein wenig von diesen Fantasien erregt saß sie am Schreibtisch. Sie hielt die Stirn gesenkt, und hin und wieder, als wollte sie Gedanken verscheuchen, richtete sie ihre Haare oder verdrehte sie, ohne jemals mit dem Denken aufzuhören, ihre Füße und betrachtete ihre Schuhe. Das Geräusch der Klingel beschleunigte ihren Herzschlag. Sie lächelte, sie betrachtete sich in einem Spiegel und ging in den Korridor.
Bevor sie die Türe öffnete, machte sie das Licht an. Michele trat ein.
»Vielleicht bin ich zu früh gekommen?«, sagte er, während er seinen Mantel und seinen Hut an den Kleiderständer hängte.
»Aber woher.« Sie gingen ins Boudoir und setzten sich aufs Sofa. »Wie geht’s?«, fragte Lisa. Sie nahm eine Schachtel mit Zigaretten und bot sie dem jungen Mann an. Er lehnte ab und wurde nachdenklich, seine Hände lagen auf den Knien.
»Gut«, sagte er schließlich. Stille.
»Wenn du erlaubst«, sagte sie, »strecke ich mich auf dem Sofa ein bisschen aus …, aber du …, bleib …, bleib …, schön gemütlich.« Sie zog die Beine hoch und streckte sich auf den Kissen aus. Michele sah ihre plumpen weißen Schenkel und lachte innerlich über sie. Der alte Gedanke kehrte wieder: »Offenbar will sie mich erregen.« Doch Lisa gefiel ihm nicht, ganz und gar nicht, und das alles ließ ihn völlig kalt.
Sie betrachtete den Jungen und dachte an das, was sie ihm hätte sagen können. Die Vorwände für mehr Intimität, die sich wenige Minuten zuvor noch so spontan angeboten hatten, waren ihr jetzt in ihrer Verwirrung entfallen. Der Kopf war leer, das Herz in Aufruhr, ihr fiel, wer weiß, wieso, die Szene vom Vorabend ein, dieser Streit zwischen Leo und Michele, der sie in dem Augenblick interessiert hatte. Sie zögerte, die Sprache noch einmal darauf zu bringen, doch die Vorstellung, sich an ihrem früheren Geliebten ein bisschen rächen zu können, indem sie dem Jungen, sofern er es nicht schon längst wusste, die Liebschaft seiner Mutter enthüllte, ermutigte sie. Danach könnte sie auf indirekten Wegen zu einer etwas anregenderen Unterhaltung übergehen.
»Ich wette«, sagte sie und blickte ihn an, »du brennst vor Verlangen zu erfahren, warum ich dich gestern Abend gebeten habe, dich nicht bei Leo zu entschuldigen.«
Er wandte sich ihr zu:
»Du bist es, die vor Verlangen brennt, es mir zu erzählen«, hätte er am liebsten geantwortet, hielt sich aber zurück. »Ich brenne nicht wirklich …, aber sag’s trotzdem.«
»Ich glaube, ich habe mehr Recht als jeder andere, dir die Augen zu öffnen«, begann sie.
»Daran habe ich keine Zweifel.«
»Man schweigt lange Zeit, man tut so, als sähe man nichts …, doch am Ende entstellt das Übermaß …, was ich gestern Abend gesehen habe, hat mich einfach aufgebracht.«
»Entschuldige«, sagte Michele, »was genau hat dich aufgebracht?«
»Die Entschuldigung gegenüber Leo.« Sie blickte ihn fest und ernst an. »Vor allem, dass deine Mutter, ausgerechnet sie, von dir eine derartige Demütigung verlangt hat.«
»Ah, jetzt verstehe ich«, und Micheles Gesicht wurde ironisch. »Ob sie mir die tolle Nachricht anvertrauen will, dass meine Mutter einen Geliebten hat?«, dachte er. Ihn überkam heftiger Abscheu gegen sich selbst und die Frau. »Vielleicht war es aber gar keine Demütigung«, fügte er hinzu.
»Das war es auf alle Fälle … und sogar eine doppelte, wenn du hören magst, was ich zu sagen habe …«
Er sah sie an: »Wenn ich dich jetzt an deinen Hüften packen oder dich in den Rücken zwicken würde«, dachte er, »wie schnell du dieses heimliche und würdevolle Getue sausen lassen und dich hin und her schmeißen würdest!«
»Ich will dich darauf aufmerksam machen«, sagte er, und er kam sich wirklich aufrichtig vor, »es ist mir überhaupt nicht wichtig, auch nur irgendetwas zu erfahren.«
»Ausgezeichnet«, antwortete Lisa kein bisschen verwirrt. »Du hast recht …, trotzdem fühle ich, dass ich reden muss …, hinterher wirst du mir dankbar sein. Also, du musst wissen, dass deine Mutter einen Fehler gemacht hat …«
»Nur einen?«
Zwischen den beiden Möglichkeiten, sich zu ärgern oder zu lachen, entschied sich Lisa für die zweite: »Sie wird tausend gemacht haben«, sagte sie lächelnd und kam dem Jungen ganz nahe. »Aber der hier war mit Sicherheit der größte.«
»Einen Augenblick«, unterbrach Michele sie, »ich weiß nicht, was du mir sagen willst …, aber wenn es, wie es aussieht, etwas Schlimmes ist, dann möchte ich doch wissen, wieso du mir das Ganze enthüllst.«
Sie sahen sich an. »Wieso?«, wiederholte Lisa und senkte langsam den Blick. »Na, weil du mich wahnsinnig interessierst und auch, weil ich dich gern habe und schließlich, das habe ich dir ja schon gesagt, weil gewisse Ungerechtigkeiten mich einfach aufbringen.«
Er wusste von der Beziehung, die es einmal zwischen Leo und ihr gegeben hatte. »Oder genauer gesagt«, dachte er, »es bringt dich auf, dass man ihn dir weggeschnappt hat, was?«, stimmte mit dem Kopf aber schwerfällig zu. »Da hast du recht, nichts ist schlimmer als Ungerechtigkeit! Also, sag schon, worin besteht dieser Fehler?«
»Also …, vor zehn Jahren lernte deine Mutter Leo Merumeci kennen …«
»Du willst mir doch nicht erzählen«, unterbrach Michele sie unter Vortäuschung größten Entsetzens, »dass Leo der Geliebte meiner Mutter ist!«
Sie sahen sich an. »Tut mir leid«, sagte Lisa mit schmerzlicher Einfachheit, »aber so ist es.«
Stille. Michele blickte zu Boden und hätte am liebsten gelacht. Seine Abscheu verwandelte sich in ein bitteres Gefühl von Lächerlichkeit.
»Und jetzt kannst du auch verstehen«, sagte Lisa, »wieso und wie sehr es mich aufgebracht hat, dass deine Mutter von dir verlangt hat, du sollest dich vor diesem Mann demütigen.«
Er regte sich nicht, er redete nicht. Er sah wieder seine Mutter, Leo und sich selbst, wie er gerade um Verzeihung bat, törichte, mickrige Figuren, hoffnungslos im viel größeren Leben verloren … doch diese Bilder verletzten ihn nicht, noch erregten sie in ihm irgendein Gefühl. Er hätte ganz anders sein mögen, empört, voller Groll, erfüllt von unauslöschlichem Hass. Stattdessen litt er darunter, in einem solchen Maße gleichgültig zu sein.
Er sah, wie Lisa sich aufrichtete und sich neben ihn setzte. »Komm schon«, sagte sie und legte unbeholfen eine tröstende Hand auf seinen Kopf. »Komm schon …, fasse dich …, ich verstehe ja, dass es wehtun muss …, da lebt man in dem Glauben, dass ein Mensch unserer Liebe, unserer Wertschätzung würdig ist, und dann … bricht plötzlich alles um einen herum zusammen …, aber das macht nichts …, das hier wird dir eine Lehre sein …«
Er schüttelte den Kopf und biss sich auf die Lippen, um nur ja nicht zu lachen. Lisa aber dachte, der Schmerz überwältige ihn: »Durch Schaden wird man klug«, sagte sie pathetisch und honigsüß und hörte nicht auf, mit ihrer Hand über die Haare des Jungen zu fahren. »Das bringt uns näher …, möchtest du, dass ich für dich werde, was deine Mutter war …, sag’s? Willst du, dass ich deine Freundin werde, deine Vertraute?« Sie meinte es aufrichtig, doch ihre Stimme flötete dermaßen falsch, dass Michele ihr am liebsten den Mund gestopft hätte. Aber er bewegte sich nicht, den Kopf hartnäckig gekrümmt. Und sah sich neben dieser Frau sitzen, auf dem Rand des Sofas, halb Büßer, halb Idiot … die Szene kam ihm so lächerlich vor, dass er, um nicht in Lachen auszubrechen, nur eins tun konnte: sich nicht bewegen.
Lisa wagte sich noch weiter vor: »Du wirst mir Besuche abstatten …, wir werden reden …, wir werden uns bemühen, eine neue Existenz aufzubauen und zu organisieren.« Er schaute sie verstohlen an …, rot unter dem blonden Schopf, rot und erregt. »Ach, so ist das also, wie du vorzugehen gedenkst«, dachte er. Ihm fiel der Verwandte ein, der am Vormittag vorbeikommen sollte. Warum also die ganze Sache nicht ernst nehmen und sich ihrer bedienen? Warum nicht weitermachen mit den Verstellungen?
Er hob den Kopf: »Das war hart«, sagte er wie jemand, dem es gelungen war, einen großen Schmerz zu besiegen. »Aber du hast recht …, ich muss mir eine neue Existenz schaffen.«
»Sicherlich«, pflichtete Lisa inbrünstig bei. Darauf folgte eine tiefe Stille. Beide täuschten in unterschiedlicher Absicht eine verträumte, gedankenschwere Zerstreutheit vor. Sie waren reglos beisammen und schauten zu Boden.
Ein Rauschen. Micheles Arm glitt hinter den Rücken der Frau und legte sich um ihre Hüfte. »Nein«, sagte sie sehr klar und ohne sich zu bewegen oder umzudrehen, als hätte sie auf eine innere Frage geantwortet. Michele lächelte widerwillig, er fühlte, wie ihn eine gewisse Verwirrung durchdrang, und zog sie noch enger an sich. »Nein, nein«, wiederholte sie mit schwächerer Stimme, gab aber nach und legte zerstreut ihren Kopf an die Schulter des Jungen. Schließlich, nach einem kurzen Augenblick sentimentaler Ratlosigkeit, fasste er sie am Kinn und küsste sie trotz des falschen stillen Protests ihrer Augen auf den Mund.
Sie lösten sich. »Du bist böse«, sagte Lisa und lächelte fast dankbar. »Böse und anmaßend.« Michele blickte auf und sah sie kalt an. Dann flog ein Lächeln über sein hageres, ernstes Gesicht. Er streckte eine Hand aus und kniff sie mit aller Kraft in die Rippen unter dem Arm. »Au, au«, schrie sie, lachte, riss ihren Mund auf und warf sich auf die Seite. »Au, au!« Sie zappelte mit den Armen, den Beinen. Schließlich fiel sie vom Sofa. In einer konvulsivischen Bewegung ihres gesamten Körpers rutschte das Kleid bis zum Bauch hoch, und die weiße Muskelmasse der kräftigen Schenkel kam zum Vorschein. Da lockerte Michele seinen Griff. Lisa setzte sich wieder und streifte den Rock über die Knie.
»Oh, das war perfide!«, wiederholte sie im Falsett und presste eine Hand gegen ihre keuchende Brust. »Oh, das war perfide!« Michele schwieg und betrachtete sie mit ernster und gewichtiger Neugier. »Stattdessen«, fügte sie hinzu und legte ihm die Hände auf die Schulter, »müsstest du es so tun, schau …« Sie näherte ihre herzförmig gespitzten Lippen denen des Jungen, berührte sie leicht und lehnte sich mit einem zufriedenen Glanz in den Augen wieder zurück. »So müsstest du es bei mir tun«, wiederholte sie dümmlich, um ihre Erregung zu verbergen.
Michele verzog den Mund, stand auf, ging im Boudoir umher, die Hände in den Hosentaschen, betrachtete die banalen Aquarelle, die an den Wänden hingen. Er war verwirrt und erregt. »Gefallen sie dir?«, hörte er unversehens hinter sich fragen. Er drehte sich um und sah Lisa. »Das ist Schund«, sagte er.
»Ach, eigentlich sind sie mir immer gut vorgekommen«, sagte die Frau beschämt.
Sie gingen wieder zum Sofa. Die Schläfen des Jungen hämmerten, seine Wangen glühten. »Das alles ist der letzte Dreck«, dachte er angewidert. Doch kaum hatten sie sich gesetzt, warf er Lisa auf die Kissen, als wollte er sie nehmen. Er sah dieses Gesicht die glänzenden Augenlider schließen und sich einer Ekstase überlassen, die teils widerlich, teils lächerlich war. Der Eindruck war dermaßen stark, dass jede Begierde verschwand. Er küsste kalt ihren Mund und verbarg dann mit einer Art Stöhnen seinen Kopf in ihrem Schoß. Dunkel. »Ich möchte bis zum Ende des Besuchs so verharren«, dachte er, »und sie nicht mehr ansehen und sie nicht mehr küssen.«
Er spürte, wie sich liebevolle Finger auf sein Haar legten und es glätteten.
»Was ist mir dir?«, fragte die vertraute falsche Stimme.
»Ich denke darüber nach«, antwortete er tiefgründig und schloss die Augen, »wie wenig es braucht, um aufrichtig zu sein, und wie wir stattdessen alles daransetzen, in die andere Richtung zu gehen.« Er seufzte: Es war ihm, als habe er über sich selbst gesprochen. »Wieso bin ich hier?«, dachte er. »Wieso lüge ich? Es wäre doch so leicht, die Wahrheit zu sagen und zu gehen.«
»Genau so ist es«, antwortete die Frau, ohne aufzuhören, ihm weiterhin über die Haare zu streicheln. »Stimmt genau …, aber jetzt brauchst du diese Gedanken nicht mehr zu haben. Du bist auf die anderen nicht mehr angewiesen. Jetzt bin ich da. Wir werden zusammen sein …, nichts auf der ganzen Welt soll uns kümmern.« Diese Worte sagte sie mit einer leidenschaftlichen Stimme, die den Jungen erschaudern ließ. »Wir werden ganz weit weg leben von allem, was dir missfällt, einverstanden? Weit weg von all diesem Dreck, diesem Elend …, du wirst mir dein Leben erzählen, von deinen Enttäuschungen, deinen Traurigkeiten, und ich gebe dir alle Liebe, die ich habe, die ich für dich aufbewahrt habe …, ich werde deine Gefährtin sein, einverstanden? Deine treue, ergebene Gefährtin, so ergeben, weißt du, dass sie dir still zuhört und dich mit ihren Zärtlichkeiten tröstet, so …, so …« Die Hand, mit der sie über den Kopf des Jungen strich, zog sich zusammen. Lisa beugte sich herab, küsste wild die Haare, den Nacken, während ihre fiebrigen Finger sich festklammerten, sie drückten nervös Micheles gekrümmte Schultern, ihr Herz zitterte: »Endlich liebe ich und werde geliebt«, dachte sie, »endlich.«
Michele rührte sich nicht. Er hatte noch nie Gelegenheit gehabt zu sehen, wie sich Lächerlichkeit derart mit Aufrichtigkeit, Falschheit mit Wahrheit vermischt. Eine abscheuliche Verlegenheit war in ihm. »Wenn sie wenigstens still sein würde«, dachte er, »aber nein, sie muss reden.« Bisweilen überkam ihn der hysterische Wunsch, die Wahrheit zu sagen, seine, die einzig mögliche, und dann wegzugehen. Doch ein Gefühl des Mitleids hielt ihn davon ab. Und hatte er Lisa nicht zuerst getäuscht mit seiner Umarmung? »Liebster … Liebster«, wiederholte sie, von dort oberhalb seines Kopfes, »du kannst dir gar nicht vorstellen, wie lieb du mir bist.«
»Du übertreibst«, hätte er am liebsten geantwortet. Aber seine Augen waren erfüllt von Dunkelheit, ihm war, als hätte er nie das Licht gesehen. Diese Worte, dieses Streicheln, diese Stimme beschworen das Bild einer Nacht ohne Hoffnung herauf.
Er hob den Kopf, er richtete sich auf, um sich hinzusetzen, rieb sich die geblendeten Augen. »Es wird an der Zeit sein, dass ich gehe«, sagte er. »Und wann kommt dieser Verwandte von dir?«
»Ich gehe ihn gleich anrufen«, sagte Lisa, die diese Frage offensichtlich nicht erwartet hatte, und verließ den Raum.
Er blieb alleine. Er stand auf und ging zur Wand. Zerstreut betrachtete er eines der Aquarelle. Dann, als wäre er in Gedanken versunken, näherte er sich der Türe und öffnete sie ein wenig. Das Telefon befand sich dort, fest in der Wand verankert, am Ende des dunklen Korridors, doch Lisa war nicht da. Dass sie hinausgegangen war, hatte ihn täuschen sollen. Dieser Verwandte existierte überhaupt nicht. Nur um diesen Jungen in ihre Wohnung zu locken, hatte sie gelogen.
»So tun als ob«, dachte er, als er die Türe vorsichtig wieder schloss, »genau darum handelt es sich, so tun als ob.« Er ging zur Wand zurück und betrachtete erneut das Aquarell, das ein rustikales Haus und ein paar Scheunen auf dem Land darstellte. Ein leichter, lästiger Widerwille bedrückte ihn. Als fühle man einen Brechreiz stärker werden, wolle ihm aber nicht nachgeben. Doch der Gedanke: »Im Grunde ist sie genau wie ich« rang ihm letzten Endes ein bisschen Mitgefühl für diese Lügnerin wider die Notwendigkeit ab. »Wir sind doch alle gleich«, dachte er. »Unter den tausend Arten, etwas zu tun, wählen wir immer die schlimmste.«
Einen Augenblick später ging die Türe auf, und Lisa kam herein. »Tut mir sehr leid«, sagte sie, »mein Verwandter ist beschäftigt …, er kann nicht kommen …, aber er sagt, morgen …, wenn du kannst, morgen, im Lauf des Nachmittags.«
Sie sahen sich an. Micheles Widerwillen und Mitleid wurden größer. Das ist zu viel. »Das geht zu weit«, dachte er. »Sie führt mich an der Nase herum. Und morgen wird es wieder die gleiche Geschichte sein: Komm morgen noch mal.« Ihm wurde klar, wenn er so täte, als hätte er nicht verstanden, würde es eine Art Komplizenschaft zwischen ihnen geben, eine falsch verstandene Verkupplung, die es ihnen in Erwartung des nicht existenten Verwandten erlauben würde, auch in allen anderen Dingen ohne besondere Skrupel unter einer Decke zu stecken.
»Nein«, sagte er, »morgen komme ich nicht.«
»Aber er kommt«, beharrte Lisa mit einer gewissen Dreistigkeit, »und wenn du nicht da bist …«
Michele legte eine Hand auf ihre Schulter und betrachtete sie: »Das ist doch alles lächerlich …, er wird nicht kommen …, warum sagst du nicht die Wahrheit?« Er sah, wie sie die Fassung verlor und, was schlimmer war, um seinen Blicken zu entgehen, ein schamloses, dreistes Lächeln aufsetzte, wie jemand, dem es nicht sonderlich leidtut, auf frischer Tat ertappt worden zu sein.
»Was für eine Wahrheit?«, wiederholte sie, ohne ihn anzublicken und ohne dieses Lächeln aufzugeben. »Ich verstehe dich nicht …, sollte nichts dazwischenkommen, ist er morgen ganz sicher hier …«
»Ich habe in den Korridor geschaut«, erklärte Michele ganz ruhig. »Du hast nicht telefoniert …, und diesen Verwandten gibt es gar nicht.«
Ein Augenblick der Stille. Dann entschied sich Lisa für die einfachste Haltung. Sie lächelte wieder, zog die Schultern ein bisschen hoch. »Wenn du also in den Korridor geschaut hast, wozu dann all diese Fragen?«
Michele beobachtete sie. »Merkt sie wirklich nicht«, dachte er, »dass man viel besser sein könnte als so?« Er wollte noch eine Anstrengung unternehmen. »Nein«, beharrte er, »nicht in dieser Weise …, das ist eine sehr ernste Sache …, statt diese Komödie abzuziehen, warum hast du nicht einfach gesagt ›Komm morgen wieder …, dann trinken wir gemeinsam Tee‹?«
»Das hätte ich sagen sollen, ich weiß …« Sie redete ohne jede Scham, eher schon etwas ungeduldig. »Das heißt also, dass du trotzdem kommst, nicht wahr? Und hab keine Angst, wenn ich jetzt mit meinem Verwandten noch nicht geredet habe, ich werde ganz gewiss mit ihm reden, so bald wie möglich.«
»Da siehst du’s«, dachte der Junge, »sie glaubt, meine Vorhaltung hatte etwas mit der Enttäuschung zu tun, ihren verdammten Verwandten nicht vorgefunden zu haben.« Sein Gesicht verhärtete sich. »Nein, ich komme nicht«, sagte er, »und rede mit niemandem.« Er verließ die Frau und ging in den Korridor.
Küchenduft erfüllte den engen Raum. »Dann ist es also wirklich so, und du kommst nicht?«, fragte sie halb bittend, halb ungläubig, als sie ihm den Hut hinhielt. Er blickte sie an und zögerte. Alles war entschieden sinnlos: Widerwille, Erbarmen, die Frau verharrte, wo sie stand, in ihrem Irrtum. Die Vergeblichkeit seiner Anstrengungen zu spüren tat weh, bedrückt von verzweifelter, quälender Langeweile, hätte er am liebsten geschrien. »Was würde es bringen, hierher zu kommen?«, fragte er.
»Was heißt: ›Was würde es bringen‹?«
»Es würde nichts bringen.« Er schüttelte den Kopf. »Gar nichts …, du bist, wie du bist …, nichts zu machen …, ihr seid alle so.«
»Was heißt ›so‹?«, beharrte sie und wurde rot, obwohl sie es nicht wollte.
»Kleinkariert, engstirnig …, die Liebe fürs Bett und in meinen Gedanken zuvorderst dein Verwandter«, hätte Michele am liebsten geantwortet. Stattdessen sagte er: »Einverstanden …, ich komme trotzdem.« Ein Augenblick der Stille. »Aber bevor ich gehe«, fügte er hinzu, »erklär mir eins: Obwohl du doch jetzt sicher bist, dass ich … dich liebe und deshalb zurückkomme, warum hast du weiterhin diesen Vorwand mit deinem Verwandten benutzt, statt mir die Wahrheit zu sagen?«
»Es wär mir nicht leicht gefallen«, erklärte sie nicht ohne Zögern, »dir zu enthüllen, dass ich das erste Mal diese Geschichte erfunden habe, damit du kommst.«
»Aber auch beim ersten Mal war es nicht nötig«, sagte Michele und beobachtete sie aufmerksam.
»Ja«, räumte sie demütig ein. »Du hast recht …, aber wer ist schon ohne Sünde? Und außerdem, diesen Verwandten gibt es wirklich, er ist sehr reich …, nur dass ich ihn schon lange nicht mehr gesehen habe.«
»Das genügt«, sagte Michele. Er nahm ihre Hand: »Also, bis morgen«, begann er. Doch er merkte plötzlich, dass Lisa ihn merkwürdig ansah und lächelte, halb schüchtern, halb schmeichelnd. Er begriff. »Dann sei’s«, dachte er, beugte sich hinunter, drückte Lisa an seine Brust und küsste sie auf den Mund. Dann ließ er sie los und ging. An der Türe drehte er sich um und grüßte noch einmal. Da sah er, dass sich Lisa wie ein junges Mädchen, das zum ersten Mal verliebt ist, verschämt und schüchtern hinter einem Mantel am Kleiderständer verbarg, dort, im Schatten des Vestibüls, und ihm, zwei Finger auf die Lippen gelegt, einen letzten Kuss zusandte.
»Schmierentheater«, dachte er. Und ohne sich noch einmal umzudrehen ging er die Treppen hinunter.